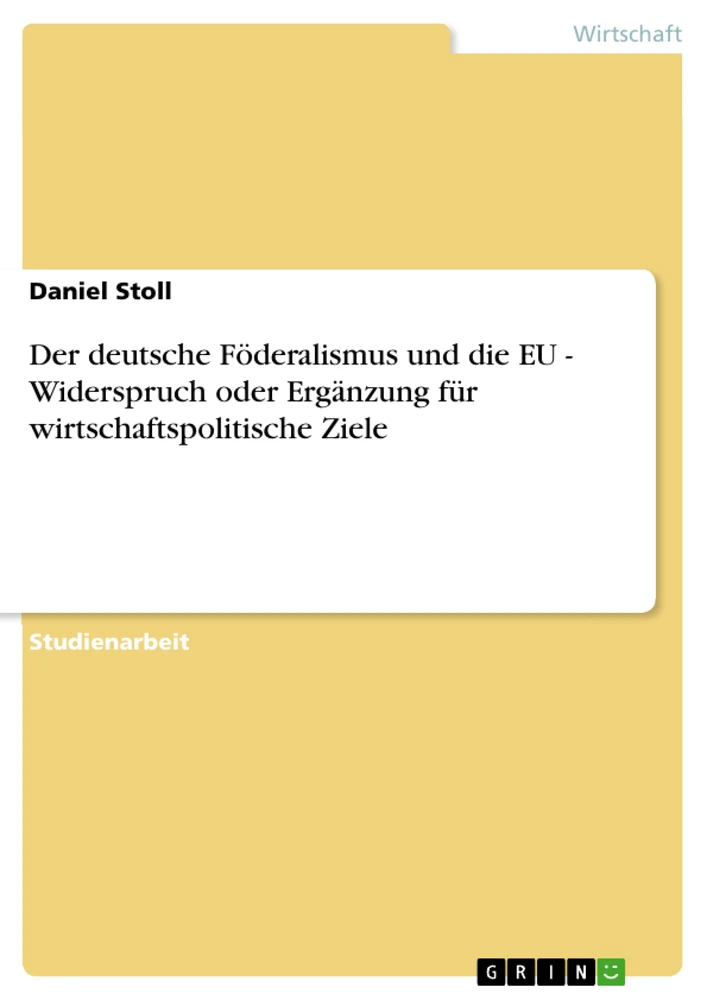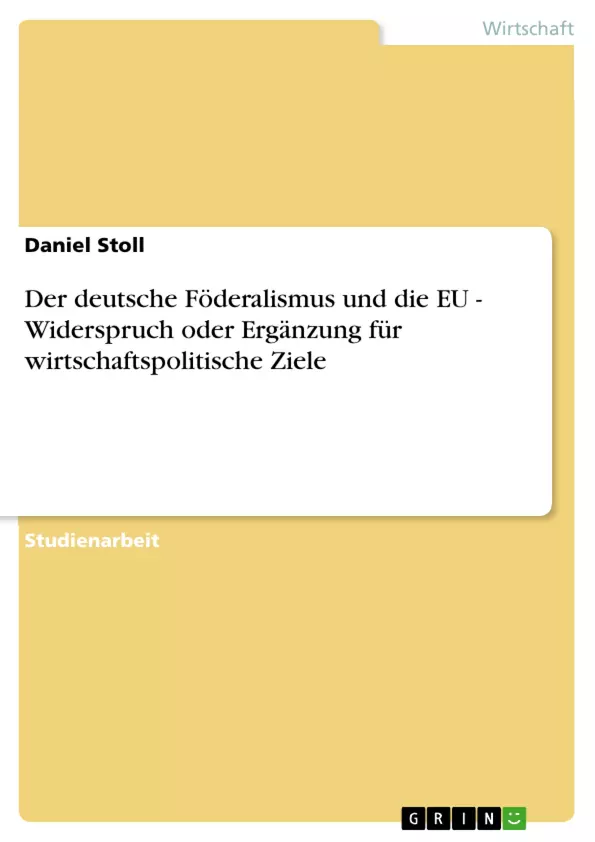Die Europäische Gemeinschaft hat sich in den letzten 60 Jahren kontinuierlich von einer wirtschaftlichen Interessensgemeinschaft mit wenigen Ländern zur heutigen Europäischen Union mit inzwischen 27 Ländern entwickelt
Im Jahr 2007 wurden durch den Lissaboner Vertrag neue Rahmenbedingungen festgelegt und aus der EG, sowie der Westeuropäischen Union(WEU) entstand die Europäische Union, welcher noch weitere Kompetenzen zugeordnet wurden.
Im Moment ist die EU ein Staatenbund und es stellt sich die Frage, ob es sinnvoll ist diese als Staatenverbund oder als Bundesstaat in der Zukunft zu gestalten.
Prinzipiell stellt sich die Frage, inwieweit die Autonomie der Mitgliedsstaaten erhalten bleiben soll, sowie welche Rechte und Pflichten den einzelnen Staaten zukommen sollen.
Als Vorbild könnte der deutsche Föderalismus dienen.
Der Föderalismus hat in Deutschland eine lange Tradition und steht für eine strikte Kompetenztrennung zwischen Bund und Ländern.
Die Europäische Gemeinschaft hat sich in den letzten 60 Jahren fortlaufend weiter entwickelt. Die Ansicht der EU-Bürger in den verschiedenen Ländern zur EU gehen zum Teil teilweise stark auseinander und so stellt sich die Frage, welche Entwicklung die EU nehmen soll, um zum einen eine starke Europäische Macht zu bilden und zum anderen die Bedürfnisse der einzelnen Mitgliedsländer zu stillen.
Es stellt sich die Frage, ob die Praxis des föderalen Prinzips der BRD auf die EU übertragbar und vor allem, ob dies auch sinnvoll ist. Im Verlauf dieser Wissenschaftlichen Arbeit möchte ich dies hinsichtlich wirtschaftspolitischer Ziele untersuchen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Föderalismus
- 2.1. Föderalismus in Deutschland
- 2.2. Föderalismus in der Euopäischen Union
- 3. Wirtschaftspolitik
- 3.1. Wirtschaftspolitik der BRD
- 3.2. Wirtschaftspolitik der EU
- 4. Vergleich der Wirtschaftspolitik von der BRD mit der EU
- 4.1. Angebotsorientierte Wirtschaftspolitik
- 4.1.1. Lohnpolitik
- 4.1.2. Arbeitszeitregelung
- 4.1.3. Steuerpolitik
- 4.2. Nachfrageorientierte Wirtschaftspolitik
- 4.2.1. Ausgabeerhöhung bei schwacher privatwirtschaftlicher Nachfrage
- 4.2.2. Ausgabesenkung bei Übernachfrage
- 4.2.3. Subventitionen zur Koordination der Nachfrage
- 5. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht die Beziehung zwischen dem deutschen Föderalismus und der Europäischen Union im Hinblick auf wirtschaftspolitische Ziele. Sie analysiert, ob das föderale Prinzip der Bundesrepublik Deutschland auf die EU übertragbar und sinnvoll ist.
- Entwicklung des Föderalismus in Deutschland und der EU
- Vergleich der wirtschaftspolitischen Ansätze der BRD und der EU
- Analyse der Auswirkungen des Föderalismus auf die wirtschaftspolitische Entscheidungsfindung in der EU
- Bewertung der Rolle des Föderalismus für die zukünftige Gestaltung der EU
- Diskussion der Herausforderungen und Chancen eines föderalen Modells für die EU
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 1: Einleitung
Dieses Kapitel führt in das Thema ein und beschreibt die Entwicklung der Europäischen Gemeinschaft von einer wirtschaftlichen Interessensgemeinschaft zu einer Union mit 27 Ländern. Es werden die Ursprünge des europäischen Integrationsprozesses sowie die wichtigsten Meilensteine der Entwicklung der EU beleuchtet.
Kapitel 2: Föderalismus
Das Kapitel behandelt das Konzept des Föderalismus, wobei die Bedeutung der strikten Kompetenzteilung zwischen Bund und Ländern im deutschen Föderalismus hervorgehoben wird. Es werden die historischen Wurzeln des deutschen Föderalismus sowie seine Entwicklung in den letzten 60 Jahren beleuchtet.
Kapitel 3: Wirtschaftspolitik
Dieses Kapitel beschäftigt sich mit der Wirtschaftspolitik der BRD und der EU. Es werden die wichtigsten wirtschaftspolitischen Ansätze und Instrumente beider Systeme vorgestellt.
Kapitel 4: Vergleich der Wirtschaftspolitik von der BRD mit der EU
Dieses Kapitel vergleicht die wirtschaftspolitischen Ansätze der BRD und der EU, insbesondere im Hinblick auf die angebots- und nachfrageorientierte Wirtschaftspolitik. Es werden verschiedene Aspekte der Wirtschaftspolitik, wie Lohnpolitik, Arbeitszeitregelung und Steuerpolitik, im Detail untersucht.
Kapitel 5: Fazit
Dieses Kapitel wird nicht zusammengefasst, da es die wesentlichen Ergebnisse der Arbeit und die abschließende Bewertung enthält.
Schlüsselwörter
Deutscher Föderalismus, Europäische Union, Wirtschaftspolitik, Angebotsorientierte Wirtschaftspolitik, Nachfrageorientierte Wirtschaftspolitik, Kompetenzteilung, Subsidiaritätsprinzip, Integrationsprozess, EU-Mitgliedsstaaten, wirtschaftspolitische Ziele.
Häufig gestellte Fragen
Kann der deutsche Föderalismus als Vorbild für die EU dienen?
Die Arbeit untersucht, ob die strikte Kompetenztrennung zwischen Bund und Ländern in Deutschland auf die EU übertragbar ist, um sowohl eine starke Macht als auch die Autonomie der Mitgliedsstaaten zu wahren.
Was ist der Unterschied zwischen einem Staatenbund und einem Bundesstaat?
Ein Staatenbund (wie die EU aktuell) ist ein Zusammenschluss souveräner Staaten, während ein Bundesstaat eine engere föderale Einheit mit geteilter Souveränität darstellt.
Welche wirtschaftspolitischen Ansätze werden verglichen?
Es erfolgt ein Vergleich zwischen angebotsorientierter (z.B. Lohn- und Steuerpolitik) und nachfrageorientierter Wirtschaftspolitik im Kontext der BRD und der EU.
Welche Rolle spielt das Subsidiaritätsprinzip?
Das Subsidiaritätsprinzip ist ein zentrales Element, um zu entscheiden, welche Aufgaben auf europäischer Ebene und welche auf nationaler oder regionaler Ebene gelöst werden sollten.
Was sind die Herausforderungen eines föderalen Modells für die EU?
Die größte Herausforderung besteht darin, die unterschiedlichen Bedürfnisse der 27 Mitgliedsländer mit den gemeinsamen wirtschaftspolitischen Zielen der Union in Einklang zu bringen.
- Quote paper
- Daniel Stoll (Author), 2010, Der deutsche Föderalismus und die EU - Widerspruch oder Ergänzung für wirtschaftspolitische Ziele, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/168957