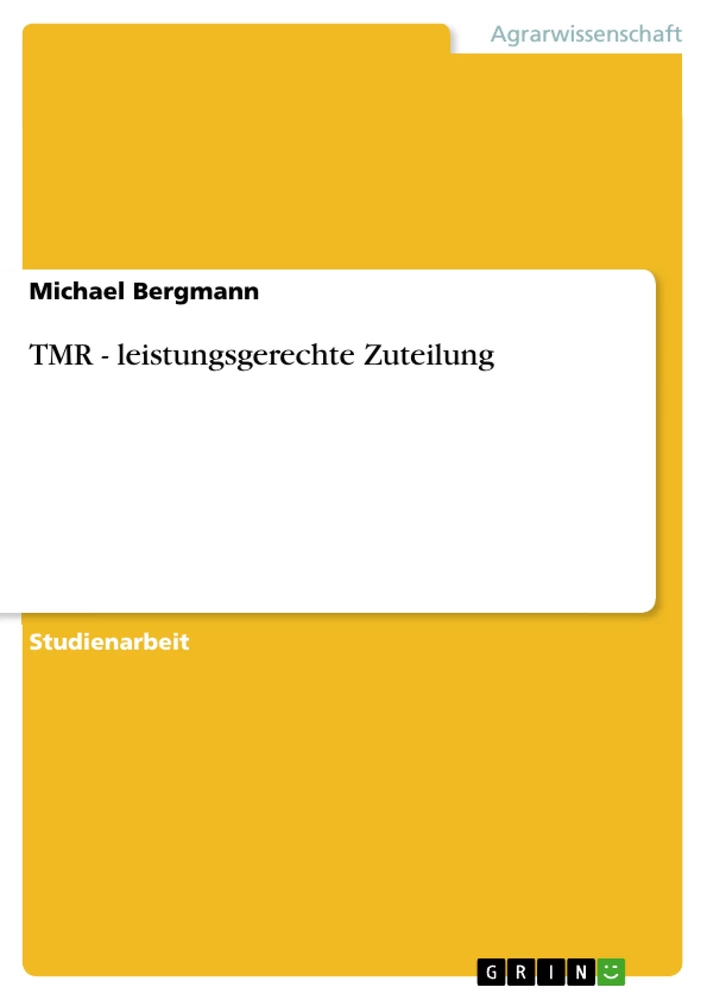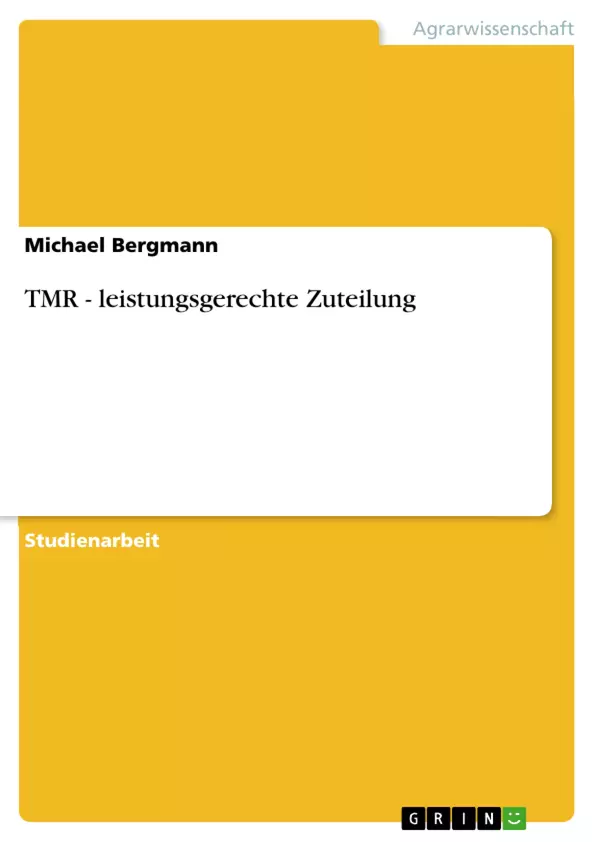Die Fütterung in der Milchviehhaltung beeinflusst die Kosten und die Leistungen der Betriebe maßgeblich. Ein gezieltes Vorgehen mit einer entsprechenden Fütterungsstrategie ist daher für eine erfolgreiche Milchproduktion unverzichtbar.
Die Bedeutung der Total Mischrationen (TMR) nimmt in den Milchviehbetrieben immer mehr zu.
In meinem Schwerpunktseminar „TMR- leistungsgerechte Zuteilung“ möchte ich auf den folgenden Seiten die Vorteile und die Möglichkeiten einer gezielten, leistungsgerechte Anwendung der TMR darstellen.
Inhaltsverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
Tabellenverzeichnis
1.0 Einleitung
2.0 Ziele einer erfolgreichen Milchproduktion
3.0 Definition und Vorteile einer TMR
4.0 Fütterungsstrategien bei einer TMR
4.1 Trockensteher Fütterung
4.2 Mehrphasige TMR
4.2.1 Anforderungen einer TMR an die Frühlaktation
4.2.2 Anforderungen an die Altmelker Ration
4.2.3 Färsengruppe
4.2.4 Gruppeneinteilung
4.3 Einphasige TMR
4.4 Teilmischration
5.0 Rationskontrolle
6.0 Ökonomische Bewertung der TMR
7.0 Fazit
Literaturverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
Abbildung 1 : Einfluss der Kraftfutterfütterg; Wattiaux M. (2005): Fütterungsrichtlinien; Ernährung und Fütterung; Babcock Institute for International Dairy Research and Development, University of Wisconsin/ USA; Kapitel
Abbildung 2: Phasen des Laktationszyklus; Wattiaux M. (2005): Fütterungsrichtlinien; Ernährung und Fütterung; Babcock Institute for International Dairy Research and Development, University of Wisconsin/ USA; Kapitel
Abbildung 3: Fettleber; Ziegler P. (2005) Fettleber aufspüren: Je früher, desto besser; DLZ Agrarmagazin 12/2005; Deutscher Landwirtschaftsverlag GmbH München
Abbildung 4 : Ängstliche Färse; Hulsen J. (2004) Fütterung und Verdauung, Kuhsignale; Roodbont Verlag; Zutphen Niederlande
Abbildung 5: Optimaler Verlauf BCS; Hulsen J. (2004) Fütterung und Verdauung, Kuhsignale; Roodbont Verlag; Zutphen Niederlande
Abbildung 6: Gruppenfütterung mit 4 Rationen; Rossow N. (2004): Fütterungsmanagement auf Leistung und Gesundheit in der Frühlaktation; dsp- Agrosoft Tagung vom 24.03.2004 in Paretz
Abbildung 7: Tageshöchstleistung und Laktationsverlauf; Wattiaux M. (2005): Fütterungsrichtlinien; Ernährung und Fütterung; Babcock Institute for International Dairy Research and Development, University of Wisconsin/ USA; Kapitel
Abbildung 8: Fähigkeit der Kuh auf eine ausgewogene Ernährung anzusprechen; Wattiaux M. (2005): Fütterungsrichtlinien; Ernährung und Fütterung; Babcock Institute for International Dairy Research and Development, University of Wisconsin/ USA; Kapitel
Abbildung 9: Rationskontrolle im Stall; Hulsen J. (2004) Fütterung und Verdauung, Kuhsignale; Roodbont Verlag; Zutphen Niederlande
Abbildung 10: Unterschied zwischen berechneter und umgesetzter Ration; N. N 2003 Das richtige TMR Konzept; TMR- Sonderedition Agritechnica 2003; Sano Tierernährung; Loiching
Abbildung 11: Kuh mit geringer Pansenfüllung; Hulsen J. (2004) Fütterung und Verdauung, Kuhsignale; Roodbont Verlag; Zutphen Niederlande
Abbildung 12: Investitionsaufwand für Fütterungssystem; Koesling T. (1999): Was steigt schneller, die Kosten oder die Erlöse; Fütterung der 10.000 Liter Kuh; DLG Verlag, Frankfurt
Tabellenverzeichnis
Tabelle 1: Effekt steigender Milchleistung auf die Stückkosten; Koesling T. (1999) Was steigt schneller, die Kosten oder die Erlöse; Fütterung der 10.000 Liter Kuh; DLG Verlag, Frankfurt
Tabelle 2: Beispiel Rationen für Trockensteher; Spiekers H. (2005): Praktische Fütterung; Erfolgreiche Milchviehfütterung; DLG Verlag; Frankfurt
Tabelle 3: Futteraufnahme; Spiekers H. (2005): Praktische Fütterung; Erfolgreiche Milchviehfütterung; DLG Verlag; Frankfurt
Tabelle 4: Nährstoffangaben zur Konzeption einer TMR; Spiekers H. (2005): Praktische Fütterung; Erfolgreiche Milchviehfütterung; DLG Verlag; Frankfurt
Tabelle 5: Nährstoffbedarf in Abhängigkeit zur Leistung; Losand B. (1999) Fütterungssysteme im Vergleich; Fütterung der 10.000 Liter Kuh; DLG Verlag, Frankfurt
Tabelle 6: Nährstoffversorgung zur Konzeption einer TMR für Altmelker; Spiekers H. (2005): Praktische Fütterung; Erfolgreiche Milchviehfütterung; DLG Verlag; Frankfurt
Tabelle 7: Anzahl der Tiere in Leistungsgruppen; Spiekers H. (2005): Praktische Fütterung; Erfolgreiche Milchviehfütterung; DLG Verlag; Frankfurt
Tabelle 8: Empfohlene Gehalte in TMR; Spiekers H. (2005): Praktische Fütterung; Erfolgreiche Milchviehfütterung; DLG Verlag; Frankfurt
Tabelle 9: Ausrichtung der Ration bei einer Halb- Mischration; Spiekers H. (2005): Praktische Fütterung; Erfolgreiche Milchviehfütterung; DLG Verlag; Frankfurt
Tabelle 10: Futterkosten je Kuh und Tag; Spiekers H. (2005): Praktische Fütterung; Erfolgreiche Milchviehfütterung; DLG Verlag; Frankfurt
1.0 Einleitung
Die Fütterung in der Milchviehhaltung beeinflusst die Kosten und die Leistungen der Betriebe maßgeblich. Ein gezieltes Vorgehen mit einer entsprechenden Fütterungsstrategie ist daher für eine erfolgreiche Milchproduktion unverzichtbar.
Die Bedeutung der Total Mischrationen (TMR) nimmt in den Milchviehbetrieben immer mehr zu.
In meinem Schwerpunktseminar „TMR- leistungsgerechte Zuteilung“ möchte ich auf den folgenden Seiten die Vorteile und die Möglichkeiten einer gezielten, leistungsgerechte Anwendung der TMR darstellen.
2.0 Ziele einer erfolgreichen Milchproduktion
Um die Rentabilität der Milchproduktion zu verbessern ist eine Optimierung der Stückkosten erforderlich.
Auswertungen von Beratungsbetrieben zeigen eindeutig, dass die Stückkosten bei einer Steigerung der Milchleistung von 7.500 auf 10.000 Liter je Kuh/Jahr sinken.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Tabelle 1: Effekt steigender Milchleistung auf die Stückkosten (Koesling 1999)
Bei den Fest und Gemeinkosten ist der Einspareffekt prozentual fast doppelt so hoch wie bei den variablen Kosten (Koesting 1999).
Die sinkenden Futterkosten je produziertem kg Milch entstehen dadurch, dass der anteilige Erhaltungsbedarf einer Kuh je erzeugtem kg Milch immer kleiner wird.
Eine Steigerung der Milchleistung auf 10.000 Liter und darüber hinaus ist damit ökonomisch sinnvoll und verbessert das Betriebsergebnis.
Mit steigenden Milchleistungen sind allerdings die Energiekonzentrationen im Futter weiter anzuheben. Daher müssen höhere Futterqualitäten und höhere Konzentratanteile verwendet werden. Dies beeinflusst allerdings die Kosten je Nährstoffeinheit.
Die physiologische Besonderheit der Wiederkäuer begrenzt aber die Energiedichte je kg Trockenmasse auf etwa 7,2 MJ/kg Trockenmasse Futter. Mit steigenden Leistungen ist es daher notwendig, dass die Kühe mehr Trockensubstanz aufnehmen müssen.
Durch einen zunehmenden Einsatz von stoffwechselstabilisierenden Komponenten und den Mehraufwendungen für die sichere Erzeugung von hervorragenden Silagequalitäten können die Futterkostenvorteile bei Hochleistungsherden allerdings egalisiert werden (Koesling 1999).
Gerade in hochleistenden Herden setzt sich das Fütterungssystem der Total Mischration (TMR) durch. Aufgrund der fütterungsphysiologischen Vorteile der TMR ist dieses System bei hohen Leistungsbereichen zu bevorzugen (Koesling 1999).
3.0 Definition und Vorteile einer Total Mischration
Bei einer Total Mischration werden alle Rationskomponenten für eine Kuhgruppe, also Grund und Kraftfutter, Mineralstoffe und Viehsalz gemischt und als Alleinfutter den Kühen vorgelegt.
Der wesentliche Aspekt dieses Fütterungsverfahrens ist, dass die Steuerung der Milchleistung hauptsächlich über die Menge des aufgenommenen Futters erfolgt (Losand 1999).
Die TMR bietet insbesondere bei hochleistenden Kühen Möglichkeiten zur Optimierung der Energie und Nährstoffversorgung. Ernährungsphysiologische Gründe für eine Nutzung des TMR Konzeptes in der Milchviehfütterung sind:
1) Stabilisierung der Milieubedingungen im Pansen.
Die TMR Fütterung bietet die Möglichkeit einer besseren Berücksichtigung der Pansenphysiologie gerade auch bei höheren Fütterungsintensitäten.
Der optimale pH- Wert im Pansen liegt bei 6,0- 6,5. Je mehr Kraftfutter gefüttert wird, desto niedriger ist der pH Wert im Pansen.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 1: Einfluss der Kraftfutterfütterung auf Pansen pH (Wattiaux 2005)
Wird zweimal täglich Kraftfutter gefüttert, so besteht 2 bis 3 Stunden nach der Fütterung der höchste Säuregrad im Pansen. Wird jedoch die gleiche Menge Kraftfutter unter das Grundfutter gemischt und über den Tag verteilt verabreicht, wird der Grad der Veränderung des Pansenmilieus gemildert (Abbildung 1) (Wattiaux 2005).
2) Durch die kontinuierliche, gleichförmige Futteraufnahme von Grund und Kraftfutter kann eine höhere Konzentratmenge toleriert werden als bei konventionellem Rationsaufbau. Grundfutter-TS: Kraftfutter-TS bis maximal 40:60 statt konventionell 60:40) (Coenen 1994)
3) Die TMR bietet ein kontinuierliches Angebot einer konstant zusammengesetzten Ration.
4) Durch die Auswahl von geeigneten Futterkomponenten unter Berücksichtigung der Abbaubarkeit und der Abbauraten kann bei der TMR eine Pansen Synchrone Fütterung erreicht werden. Durch solch einen aufeinander abgestimmten („synchronisierten“) Kohlenhydrat und Rohproteinabbau im Pansen wird eine maximale Effizienz der mikrobiellen Synthese erreicht (Coenen 1994)
5) Eine Optimierung des Trockensubstanzgehaltes (TS) ist in der Mischration möglich. Angestrebt ist ein TS Gehalt von mindestens 40% bis zu maximal 60% in der Gesamtration.
6) Die TMR ermöglicht eine Steigerung der Futtertrockenmasse Aufnahme auf näherungsweise 4kg/100kg Körpermasse und Tag. Durch die Optimierung der Verdauungsvorgänge im Pansen kann eine Erhöhung der TS-Futteraufnahme gegenüber herkömmlichen Fütterungstechniken um 0- 1,5 kg/Tier und Tag für realistisch gehalten werden Dieser Effekt ist umso größer, je schlechter vorher vorgelegt wurde und je größer die Unterschiede im Energiegehalt der eingesetzten Komponenten sind (Spiekers 2005).
7) Im Gegensatz zur festen Kraftfuttergabe kann die Kuh bei der TMR über die Menge des gefressenen Futters die Kraftfutteraufnahme selbst steuern. Bei einer Wiederkäuergerechten Rationsgestaltung kann die Gefahr einer Azidose geringer sein als bei separater Kraftfutter Zuteilung (Losand 1999).
Neben den ernährungsphysiologischen Vorteilen bieten sich weiterhin verfahrenstechnische Vorteile:
1) Eine Selektion seitens der Tiere bei den vorgelegten Einzelfuttermitteln ist bei einer richtig angewendeten Mischration nicht möglich. Daher kann der Landwirt die Ration gezielt steuern (Losand 1999).
2) Eine Verwendung von Futtermitteln mit geringer Schmackhaftigkeit oder besonderen Struktureigenschaften (NaOH behandeltes Getreide, Rübenblattsilage, Stroh, u.a) kann daher ohne Nachteile für die Futteraufnahme erfolgen (Coenen 1994).
3) Der Einsatz von „preiswerten“ Nebenprodukten aus der Lebensmittelherstellung (Backabfälle, Pressschnitzel, Treber, Pülpe) und betriebseigenen Einzelkomponenten (CCM, LKS, Feuchtgetreide) ist problemlos möglich (Coenen 1994).
4) Weiter Vorteile können sich in der Arbeitswirtschaft und der Ausgestaltung der Fressplätze ergeben. So kann bei einer TMR das Tier
- Fressplatzverhältnis im Vergleich zur Einzelkomponenten Fütterung auf max. 1- 2 erweitert werden (Spiekers 2005).
4.0 Fütterungsstrategien bei einer TMR
Die Notwendigkeit und Gestaltung der Gruppenbildung bei der TMR Fütterung wird seit Jahren sehr kontrovers diskutiert.
Wie in Abbildung 2 dargestellt, folgen Milchproduktion, Trockensubstanzaufnahme, Körpergewicht und die Energiebilanz einer Kuh während der Laktation einem typischen Muster der Veränderung.
Um bei der TMR Fütterung eine Unterversorgung mit Energie in der Frühlaktation und eine Überversorgung mit Energie bei nachlassender Milchleistung zu vermeiden, kann es sinnvoll sein, die Energiekonzentration der Ration dem Laktationsverlauf an zu passen. Dies geschieht durch die Bildung von Leistungsgruppen. Nur durch eine Gruppierung von Tieren mit ähnlichen Ansprüchen an die Energie und Nährstoffe der Ration wird eine bedarfsgerechte, ernährungsphysiologische, futterökonomischen sowie den umweltseitigen Anforderungen entsprechende Milchviehfütterung ermöglicht (Spiekers 2005).
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 2: Phasen des Laktationszyklus (Wattiaux 2005)
Neben den Leistungsgruppen kann es sinnvoll sein eine Färsengruppe einzurichten.
Bei sehr hohen Milchleistungen von über 9 000 l Milch ist es allerdings ebenso möglich mit nur einer Leistungsgruppe zu arbeiten.
Die Zahl der Fütterungsgruppen hängt neben der Herdenleistung von der Herdengröße und den baulichen Gegebenheiten ab.
Gerade in kleinern Betrieben ist aufgrund der zu geringen Tierzahl eine Gruppenbildung nicht möglich. In diesen Betrieben kann durch die zum Teil noch vorhandene Abrufstation eine Teil Misch Ration verfüttert werden. Bei diesem Verfahren wird eine aufgewertete Grundration mit dem Mischwagen vorgelegt und weitere leistungsabhängige Kraftfuttergaben an der Abrufstation zugeteilt.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Ziel einer erfolgreichen Milchproduktion laut diesem Dokument?
Das Ziel ist die Optimierung der Stückkosten, was durch eine Steigerung der Milchleistung pro Kuh und Jahr erreicht werden kann. Eine Milchleistungssteigerung auf 10.000 Liter oder mehr ist ökonomisch sinnvoll.
Was ist eine Total Mischration (TMR)?
Eine TMR ist eine Fütterungsmethode, bei der alle Rationskomponenten (Grundfutter, Kraftfutter, Mineralstoffe, Viehsalz) gemischt und als Alleinfutter an die Kühe verfüttert werden. Die Milchleistung wird hauptsächlich über die Futtermenge gesteuert.
Welche ernährungsphysiologischen Vorteile bietet eine TMR?
Eine TMR stabilisiert die Milieubedingungen im Pansen, ermöglicht eine höhere Konzentratmenge, bietet ein kontinuierliches Angebot einer konstanten Ration, ermöglicht eine Pansen synchrone Fütterung, optimiert den Trockensubstanzgehalt und steigert die Futtertrockenmasse Aufnahme.
Welche verfahrenstechnischen Vorteile hat eine TMR?
Bei einer TMR ist eine Selektion der Einzelfuttermittel durch die Tiere nicht möglich, die Verwendung von weniger schmackhaften Futtermitteln ist möglich, der Einsatz von preiswerten Nebenprodukten ist problemlos, und es kann das Fressplatzverhältnis optimiert werden.
Welche Fütterungsstrategien gibt es bei einer TMR?
Es gibt verschiedene Strategien, darunter mehrphasige TMR (mit Leistungsgruppen für Frühlaktation, Altmelker und Färsen), einphasige TMR (mit nur einer Leistungsgruppe) und Teilmischrationen. Unabhängig davon ist eine zweiphasige Trockensteherfütterung sinnvoll.
Warum ist die Gruppenbildung bei der TMR-Fütterung wichtig?
Die Gruppenbildung ermöglicht es, die Energiekonzentration der Ration an den Laktationsverlauf anzupassen und eine Unter- oder Überversorgung mit Energie zu vermeiden. Dadurch wird eine bedarfsgerechte, ernährungsphysiologische und futterökonomische Fütterung ermöglicht.
Was ist eine Teilmischration?
Bei einer Teilmischration wird eine aufgewertete Grundration mit dem Mischwagen vorgelegt, und weitere leistungsabhängige Kraftfuttergaben werden an der Abrufstation zugeteilt.
Warum ist eine zweiphasige Trockensteherfütterung wichtig?
Die zweiphasige Trockensteherfütterung bereitet die Kuh optimal auf die nächste Laktation vor und beugt Stoffwechselerkrankungen vor.
Welche Faktoren beeinflussen die Anzahl der Fütterungsgruppen?
Die Anzahl der Fütterungsgruppen hängt von der Herdenleistung, der Herdengröße und den baulichen Gegebenheiten ab.
Was sind die Ziele der Trockensteher Fütterung?
Die Ziele der Trockensteherfütterung sind die Vorbereitung auf die nächste Laktation und die Vermeidung von Stoffwechselstörungen wie Fettleber.
- Arbeit zitieren
- Michael Bergmann (Autor:in), 2005, TMR - leistungsgerechte Zuteilung, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/168974