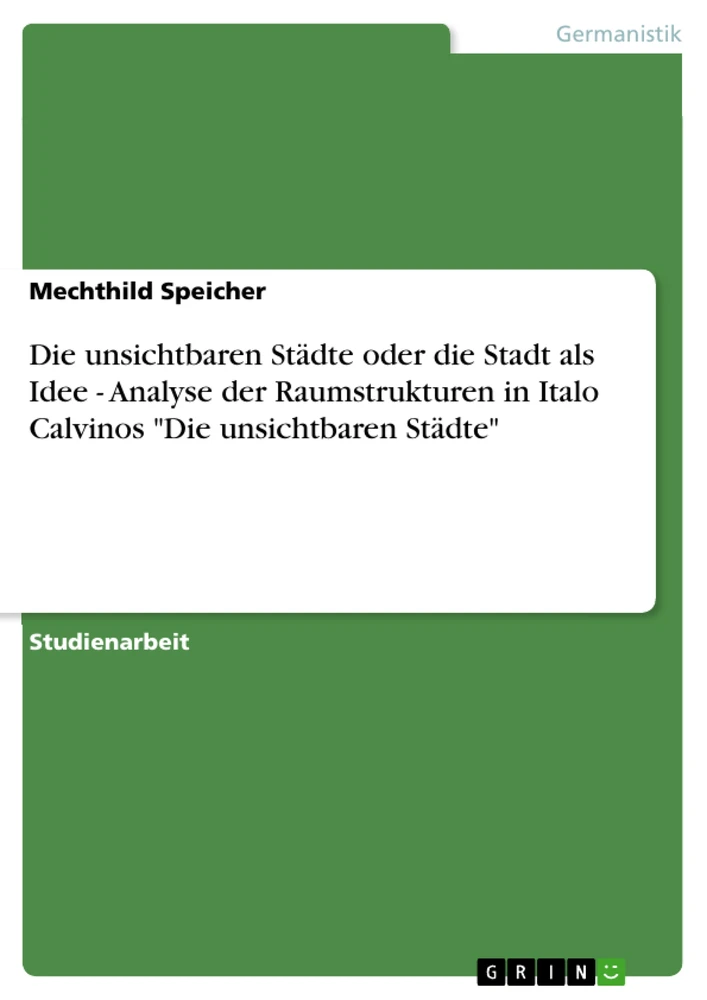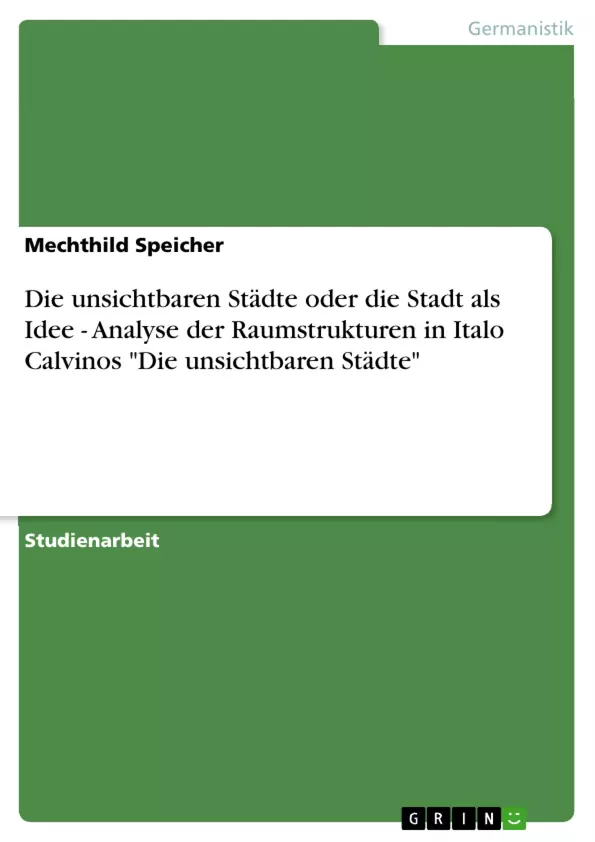Italo Calvinos Roman Die unsichtbaren Städte ist ein Text, der, obschon er kaum Handlung aufweist, sehr dicht gewebt ist. Das Nachdenken über dieses Buch gleicht einem dialektischen Prozess, dessen Erkenntnis sich Stufe um Stufe, durch Abwägen, Verwerfen und erneutes Zusammenfügen, allmählich vollzieht. Erst nach und nach gibt er seine Struktur frei, die, obgleich sie zunächst labyrinthisch erscheint, eine ‚filigrane Anordnung’ (vgl. Calvino, S.8) besitzt.
Untersucht wird die Bedeutung, die das Imperium Kublai Khans zunächst für den Kaiser hat, seine Bemühungen, es zu ordnen, und was Marco Polo diesen Mechanismen der Systematisierung entgegensetzt. Es ist ein allmählich voranschreitender Erkenntnisprozess, der im Dialog Kublai Khans und Marco Polos stattfindet, und die zentrale Rolle, die dem Dialog der beiden Protagonisten zukommt, wird sondiert. Als ein Werkzeug der Erkenntnis dient nicht zuletzt Fiktionalität; sie bestimmt wesentlich Gestaltungselemente des Romans. Das Suchen nach Nicht-Hölle inmitten der Hölle, erscheint am Ende des Buches als eine Art metaphysische Klammer, die einen Hinweis liefern kann auf die Deutung dessen, was die unsichtbaren Städte in Calvinos Roman letztlich bedeuten könnten.
Inhaltsverzeichnis
- EINLEITUNG
- DIE GESCHICHTE
- DIE TEXTGESTALT
- DER PLOT
- DAS LABYRINTHISCHE REICH
- DIE STRUKTUR DER LANDSCHAFT
- DIE LANDSCHAFT ALS SCHACHSPIEL
- DIE GLIEDERUNG
- DIE NARRATIVE LANDSCHAFT
- DER DIALOG
- DIE FIKTIONALITÄT
- DIE ZEIT
- DER RAUM
- DER ATLAS
- DER DARSTELLUNGSPROZESS
- VENEDIG
- DIE VOLLKOMMENE STADT UND DIE NICHT-HÖLLE
- DIE STADT UND DIE IDEE
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Seminararbeit befasst sich mit Italo Calvinos Roman „Die unsichtbaren Städte“ und untersucht dessen Struktur und Bedeutung. Die Arbeit betrachtet den Roman als einen dialektischen Prozess, in dem die beiden Protagonisten, Kublai Khan und Marco Polo, verschiedene Ansätze zur Ordnung und Interpretation des Imperiums entwickeln.
- Das Verhältnis von Ordnung und Chaos im Imperium Kublai Khans
- Die Rolle des Dialogs zwischen Kaiser und Kundschafter für die Erkenntnis
- Die Bedeutung von Fiktionalität für die Gestaltung des Romans
- Die Suche nach der „Nicht-Hölle“ inmitten der „Hölle“
- Die Stadt als Idee und ihre Beziehung zur Philosophie Platons und Hegels
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1: Einleitung Der Roman wird als dicht gewebt und labyrinthisch beschrieben. Die Arbeit untersucht die Bedeutung des Imperiums für Kublai Khan und die Rolle des Dialogs zwischen ihm und Marco Polo. Fiktionalität als Werkzeug der Erkenntnis und die Suche nach der „Nicht-Hölle“ inmitten der „Hölle“ werden ebenfalls als wichtige Themen vorgestellt.
- Kapitel 2: Die Geschichte Die historische Situation, auf der der Roman basiert, wird beleuchtet, wobei Kublai Khan als Kaiser Chinas und Marco Polo als Reisender im Dienste des Kaisers vorgestellt werden.
- Kapitel 3: Die Textgestalt Die Struktur des Romans mit seinen neun Kapiteln und den elf Kategorien von Stadtbeschreibungen wird erläutert.
- Kapitel 4: Der Plot Kublai Khans Streben nach dem Verständnis seines Reiches und die Rolle von Marco Polos Berichten im Dialog zwischen den beiden Protagonisten werden dargestellt.
- Kapitel 5: Das labyrinthische Reich Die Metapher des labyrinthischen Reiches als Repräsentation des Universums wird beleuchtet. Kublai Khans doppelte Fremdheit gegenüber seinem Reich und die „undurchsichtige Dichte“ des Imperiums werden erläutert.
- Kapitel 6: Die Struktur der Landschaft Marco Polos Fähigkeit, dem Kaiser eine Ordnung in seinem Reich aufzuzeigen, wird beschrieben. Die Systematik in Marco Polos Beschreibungen und Kublai Khans Versuch, ein generatives Stadtmodell zu konstruieren, werden untersucht.
- Kapitel 7: Die narrative Landschaft Die gegensätzlichen Modelle von Kaiser und Kundschafter werden dargestellt. Kublais deduktives Modell basiert auf Regeln, während Marco Polos induktives Modell von der Ausnahme ausgeht.
- Kapitel 8: Der Dialog Die besondere Art der Kommunikation zwischen Kaiser und Kundschafter wird beschrieben. Die Verwendung von Symbolen und Bildern durch Marco Polo und ihre Bedeutung für Kublai Khans Wahrnehmung des Imperiums werden analysiert.
Schlüsselwörter
Die Seminararbeit befasst sich mit den Schlüsselbegriffen „Die unsichtbaren Städte“, „Imperium“, „Dialog“, „Fiktionalität“, „Ordnung“, „Chaos“, „Nicht-Hölle“, „vollkommene Stadt“ und „Idee“. Diese Begriffe spiegeln die zentralen Themen des Romans wider und verweisen auf die philosophischen Ansätze von Platon und Hegel, die in der Arbeit untersucht werden.
- Quote paper
- Mechthild Speicher (Author), 2003, Die unsichtbaren Städte oder die Stadt als Idee - Analyse der Raumstrukturen in Italo Calvinos "Die unsichtbaren Städte", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/168975