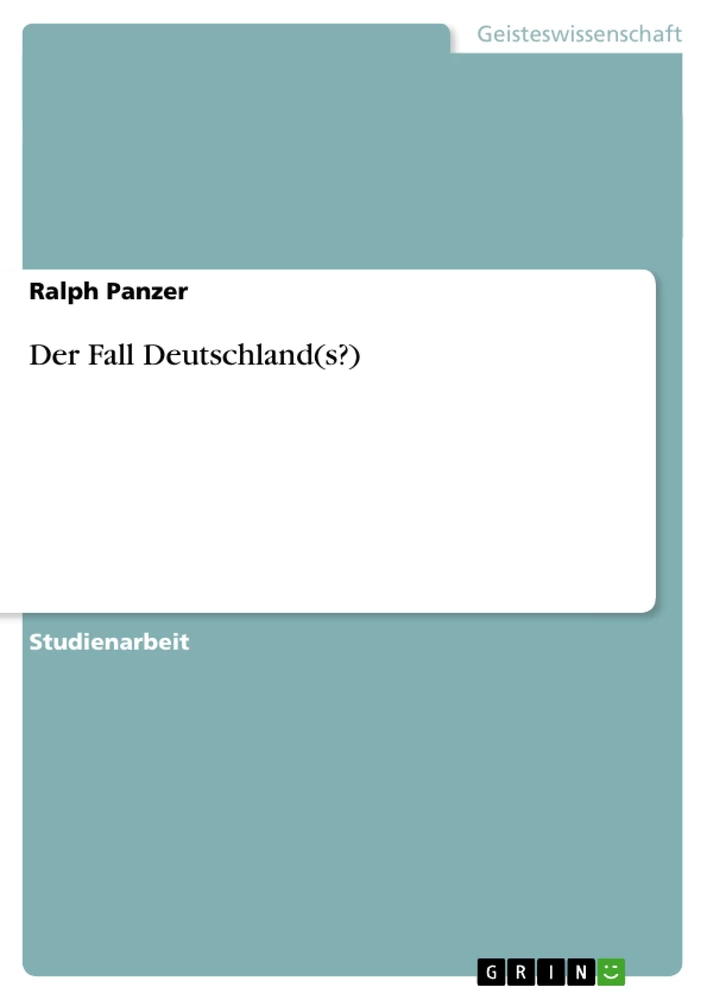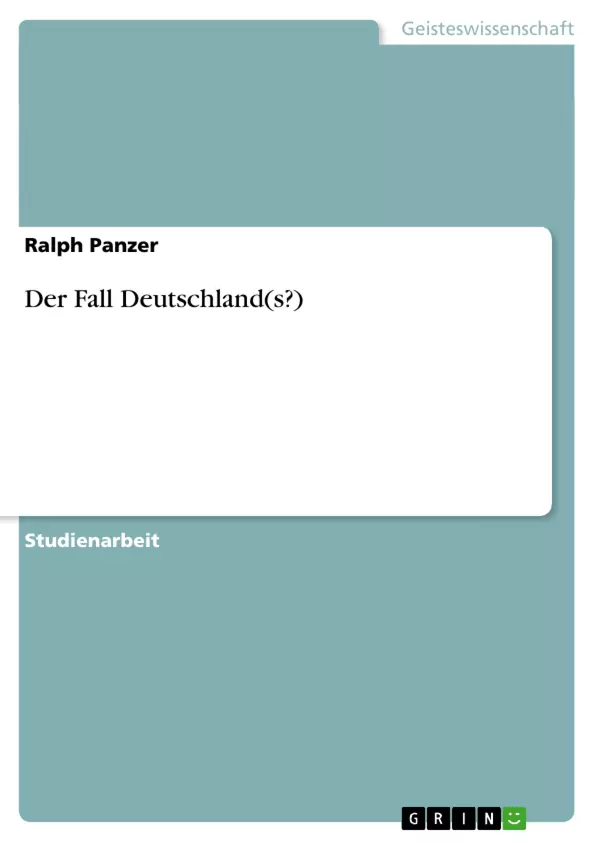In der Literatur über die Wohlfahrtsstaatsforschung wird vielfach über eine „Krise des
deutschen Wohlfahrtsstaates“ diskutiert. Was soll das sein? Als Krise des deutschen
Wohlfahrtsstaates wird ein Zustand akuter Schwierigkeiten in der Finanzwirtschaft
bezeichnet. Dieser Zustand ist zur Zeit in Deutschland gegeben. Die einzelnen
Probleme, die unter anderem durch einen Wandel in der Gesellschaft entstanden
sind und letztendlich diese Krise ausmachen, sollen in dieser Arbeit untersucht
werden. Auf Grundlage des Basistextes „Der Sozialstaat: Die deutsche Version des
Wohlfahrtsstaates – Überlegungen zu seiner typologischen Verortung“ (Kohl 2000),
auf dem das im Seminar gehaltene Referat aufbaute, wird im ersten Teil dieser
Hausarbeit ganz allgemein das Modell von Gøsta Esping-Andersen vorgestellt. Es
wird gezeigt, wo sich der deutsche Wohlfahrtsstaat in diesem Modell einordnet und
worin die Unterschiede zu anderen Wohlfahrtsstaaten bestehen. Des weiteren sind
dann im zweiten Teil dieser Arbeit folgende Fragen Gegenstand der Untersuchung:
1. Welche Herausforderungen und Probleme bieten sich dem deutschen
Wohlfahrtsstaat? 2. Wie kann er diesen Herausforderungen gerecht werden und die
Probleme lösen, bzw. welche Reformvorschläge gibt es? Und schließlich 3. Bleibt
der konservative, deutsche Wohlfahrtsstaat bei der Bewältigung seiner Probleme
seinem historischen Entwicklungspfad treu?
Anmerkung: Da es in der Wissenschaft keine eindeutige Trennung zwischen den
Definitionen der Begriffe „Sozialstaat“ und „Wohlfahrtsstaat“ gibt, werde ich diese
Begriffe im folgenden synonym verwenden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Wie bemisst man Wohlfahrt? Von Gøsta Esping-Andersen
- Die drei Dimensionen der Wohlfahrtsstaatlichkeit
- Der Grad der Dekommodifizierung
- Die Art der Stratifizierung
- Das Verhältnis von Markt, Staat und Familie
- Die drei Welten des Wohlfahrtskapitalismus
- Der konservative Typ
- Der liberale Typ
- Der sozialdemokratische Typ
- Die drei Dimensionen der Wohlfahrtsstaatlichkeit
- Die Entwicklung der Wohlfahrt in der Bundesrepublik Deutschland
- Probleme des Wohlfahrtsstaates und Lösungsansätze zu ihrer Bewältigung
- Arbeitslosigkeit in der deutschen Welt der Wohlfahrt
- Herausforderungen des deutschen Wohlfahrtsstaates
- Die Reform des deutschen Wohlfahrtsstaates
- Schlussbemerkung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Krise des deutschen Wohlfahrtsstaates, ausgehend von Gøsta Esping-Andersens Modell der drei Welten des Wohlfahrtskapitalismus. Die Zielsetzung besteht darin, die Herausforderungen und Probleme des deutschen Systems zu beleuchten und mögliche Lösungsansätze zu diskutieren. Dabei wird der Frage nachgegangen, ob der deutsche Wohlfahrtsstaat seinem historischen Entwicklungspfad treu bleibt.
- Die Typologie des Wohlfahrtskapitalismus nach Esping-Andersen
- Die Einordnung des deutschen Wohlfahrtsstaates in dieses Modell
- Die Herausforderungen und Probleme des deutschen Wohlfahrtsstaates
- Mögliche Reformen des deutschen Wohlfahrtsstaates
- Die zukünftige Entwicklung des deutschen Wohlfahrtsstaates
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung beschreibt den Kontext der Arbeit, indem sie die verbreitete Diskussion um die „Krise des deutschen Wohlfahrtsstaates“ einführt und die zentralen Forschungsfragen formuliert. Diese Fragen betreffen die Herausforderungen und Probleme des deutschen Wohlfahrtsstaates, mögliche Lösungsansätze und die Frage nach der Kontinuität des konservativen Modells. Die Arbeit stützt sich auf Kohl (2000) und verwendet die Begriffe „Sozialstaat“ und „Wohlfahrtsstaat“ synonym, da in der Wissenschaft keine klare Trennung besteht.
Wie bemisst man Wohlfahrt? Von Gøsta Esping-Andersen: Dieses Kapitel präsentiert das Modell von Gøsta Esping-Andersen, das die Typologie der Wohlfahrtsstaaten anhand von drei Dimensionen vornimmt: dem Grad der Dekommodifizierung der Arbeit, der Art der Stratifizierung und dem Verhältnis von Staat, Markt und Familie. Es wird deutlich, dass Esping-Andersen nicht nur Sozialausgaben betrachtet, sondern auch die politisch-ideologischen Leitvorstellungen in die Analyse mit einbezieht. Die drei Dimensionen liefern die Grundlage für die Unterscheidung der drei Welten des Wohlfahrtskapitalismus.
Die Entwicklung der Wohlfahrt in der Bundesrepublik Deutschland: (Da der Text keine weiteren Informationen zu diesem Kapitel liefert, kann hier keine Zusammenfassung erstellt werden.)
Probleme des Wohlfahrtsstaates und Lösungsansätze zu ihrer Bewältigung: Dieses Kapitel befasst sich mit den Herausforderungen und Problemen des deutschen Wohlfahrtsstaates, darunter die Arbeitslosigkeit. Es skizziert Lösungsansätze und Reformvorschläge, wobei die Frage im Raum steht, ob der konservative deutsche Wohlfahrtsstaat bei der Bewältigung seiner Probleme seinem historischen Entwicklungspfad treu bleibt. Die Kapitel analysiert die Herausforderungen des Wohlfahrtsstaates und diskutiert mögliche Wege zu deren Bewältigung. Es wird auf die Notwendigkeit von Reformen eingegangen, ohne jedoch konkrete Lösungsvorschläge im Detail zu präsentieren.
Schlüsselwörter
Wohlfahrtsstaat, Sozialstaat, Gøsta Esping-Andersen, Dekommodifizierung, Stratifizierung, Wohlfahrtskapitalismus, Deutschland, Reform, Herausforderungen, Arbeitslosigkeit.
Häufig gestellte Fragen zu: Analyse des deutschen Wohlfahrtsstaates nach Esping-Andersen
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert den deutschen Wohlfahrtsstaat im Kontext der „Krise des Wohlfahrtsstaates“. Sie untersucht die Herausforderungen und Probleme des Systems und diskutiert mögliche Lösungsansätze. Dabei wird insbesondere das Modell der drei Welten des Wohlfahrtskapitalismus nach Gøsta Esping-Andersen angewendet, um den deutschen Wohlfahrtsstaat einzuordnen und seine zukünftige Entwicklung zu beleuchten.
Welches Modell wird verwendet und was sind dessen Kernkomponenten?
Die Analyse basiert auf dem Modell von Gøsta Esping-Andersen, das den Wohlfahrtskapitalismus in drei Typen unterteilt: konservativ, liberal und sozialdemokratisch. Die Unterscheidung erfolgt anhand dreier Dimensionen: dem Grad der Dekommodifizierung (Entkoppelung der sozialen Sicherung von der Marktarbeit), der Art der Stratifizierung (gesellschaftliche Schichtung) und dem Verhältnis von Staat, Markt und Familie. Die Arbeit untersucht, wie sich der deutsche Wohlfahrtsstaat in dieses Modell einordnen lässt.
Welche Probleme des deutschen Wohlfahrtsstaates werden behandelt?
Die Arbeit thematisiert verschiedene Herausforderungen des deutschen Wohlfahrtsstaates. Ein Schwerpunkt liegt auf dem Problem der Arbeitslosigkeit im Kontext des deutschen Wohlfahrtssystems. Weitere Probleme und Herausforderungen werden angesprochen, jedoch ohne detaillierte Auflistung im vorliegenden Textzusammenfassung.
Welche Lösungsansätze werden diskutiert?
Der Text skizziert Lösungsansätze und Reformvorschläge für den deutschen Wohlfahrtsstaat, geht aber nicht auf konkrete Maßnahmen im Detail ein. Die zentrale Frage ist, ob der deutsche Wohlfahrtsstaat (als konservativer Typ) seinem historischen Entwicklungspfad treu bleiben kann oder ob grundlegende Reformen notwendig sind.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit umfasst eine Einleitung, ein Kapitel zur Theorie von Esping-Andersen (mit den drei Dimensionen und den drei Wohlfahrtstypen), ein Kapitel zur Entwicklung des deutschen Wohlfahrtsstaates (ohne detaillierte Zusammenfassung im vorliegenden Text), ein Kapitel zu Problemen und Lösungsansätzen und eine Schlussbemerkung. Ein Inhaltsverzeichnis und eine Zusammenfassung der Kapitel sind enthalten.
Welche Schlüsselbegriffe sind relevant?
Wichtige Schlüsselbegriffe sind: Wohlfahrtsstaat, Sozialstaat, Gøsta Esping-Andersen, Dekommodifizierung, Stratifizierung, Wohlfahrtskapitalismus, Deutschland, Reform, Herausforderungen, Arbeitslosigkeit.
Welche Quellen werden genannt?
Der Text erwähnt Kohl (2000) im Zusammenhang mit der Verwendung der Begriffe „Sozialstaat“ und „Wohlfahrtsstaat“ synonym.
- Quote paper
- Ralph Panzer (Author), 2002, Der Fall Deutschland(s?), Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/16901