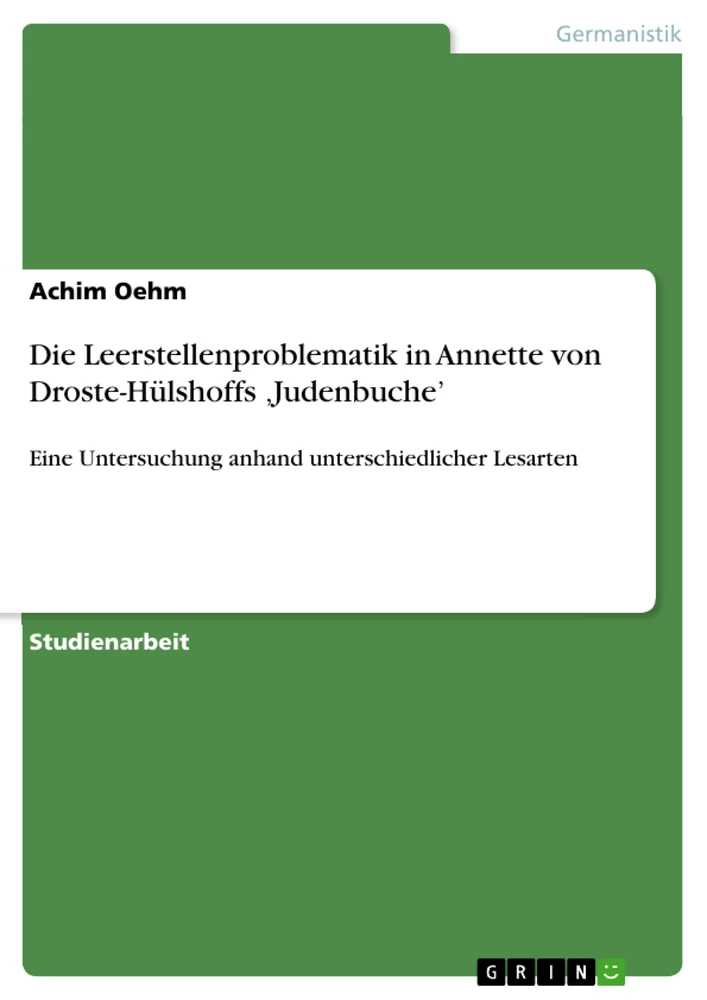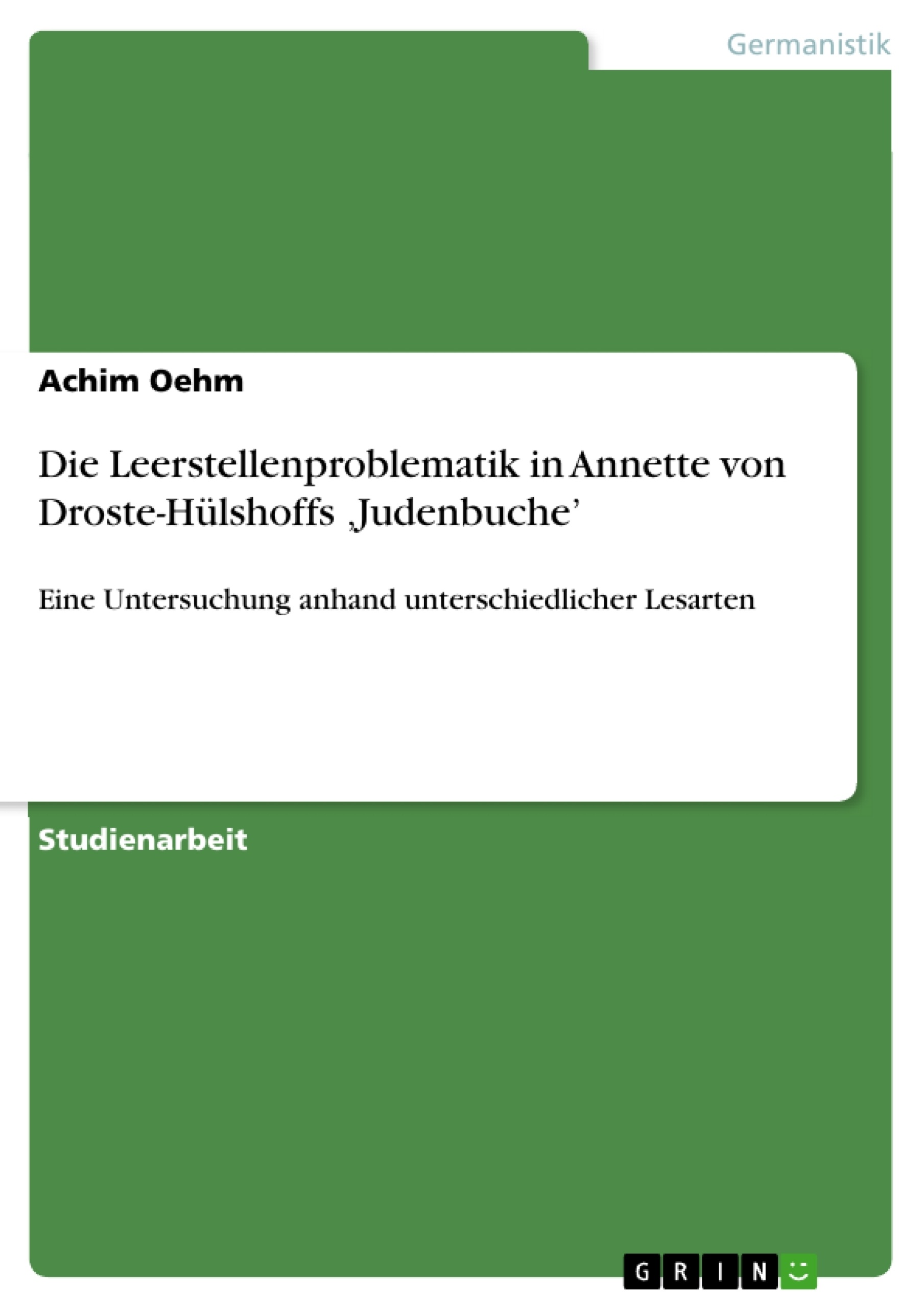Beim Bibliographieren der neusten Droste-Forschung stößt man allerdings unweigerlich auf ein Werk aus dem Jahr 2008 von Norbert Mecklenburg: Der Fall 'Judenbuche' - Revision eines Fehlurteils. Der Autor schlägt, nach eigener Angabe , eine ganze neue, kontroverse Les- und Deutungsart der Novelle vor.
Blickt man in der Forschung zurück, stellt man fest, dass Mecklenburg mit seinen Ansichten fast alleine da steht. Die Rezeptionen des Stoffes sind mehr als nur kontrovers , haben aber dennoch alle eine Gemeinsamkeit: Alle Interpreten sind sich einig darüber, dass die Autorin Droste-Hülshoff viele Leerstellen im Text hinterlassen hat, die es gilt interpretatorisch zu füllen. Genau mit diesen Leerstellen beschäftigt sich, unter besonderer Berücksichtigung zweier unterschiedlicher Les- und Interpretationsarten , diese Arbeit. Das Hauptaugenmerk liegt allerdings auf der, von Mecklenburg und Villö Dorothea Huszai proklamierten, Lesart. Da Mecklenburg und Huszai in ihren Ausführung sehr oft die Gegenseite ihrer Forschung beleuchten und diese sehr gut zusammenfassen, werden somit auch Aussagen von Autoren, deren Werke nicht direkt dieser Arbeit vorliegen indirekt verwendet (natürlich wird hierbei die gängige Zitierweise eingehalten und gekennzeichnet, welches geistige Gut von welchem Autor/Werk stammt).
Zunächst wird ein kurzer Überblick über den Inhalt der Geschichte wiedergegeben.
Danach werden einige der Leerstellen (die wichtigsten?) an Hand des Textes und der jeweiligen Thesen ausgewählter Sekundärliteratur überprüft. Der Fokus liegt hierbei auf der Schuldfrage der Hauptfigur Friedrich Mergel. Um diese Frage zu beantworten, soll geklärt werden, welche Geschehnisse im Text durch die richtige Interpretation eine Schlüsselfunktion erhalten.
Inhaltsverzeichnis (Table of Contents)
- 1. Einleitung
- 2. Lesart
- 3. Inhalt
- 4.1 Der lyrische Prolog
- 4.2 Die Figur des Ohms Simon Semmler
- 4.3 Das Geständnis des Lumpenmoises
- 4.4 Johannes Niemand und das Doppelgängermotiv
- 4.5 Der Mord am Förster Brandis
- 4.6 Die Schlussszene
- 5. Fazit
- 6. Bibliographie
- 6.1 Primärliteratur
- 6.2 Sekundärliteratur
Zielsetzung und Themenschwerpunkte (Objectives and Key Themes)
Diese Arbeit untersucht die Leerstellenproblematik in Annette von Droste-Hülshoffs "Judenbuche" und analysiert zwei unterschiedliche Lesarten des Textes. Ziel ist es, anhand dieser Lesarten die Schlüsselfunktionen der Leerstellen im Text herauszuarbeiten und die Schuldfrage der Hauptfigur Friedrich Mergel zu beleuchten.
- Die Bedeutung von Leerstellen in der Interpretation von literarischen Texten
- Die unterschiedlichen Lesarten der "Judenbuche" im Hinblick auf die Mordfrage
- Die Rolle von Friedrich Mergel als potentieller Mörder und seine moralische Verantwortung
- Die Bedeutung der sozialen Strukturen und des gesellschaftlichen Kontextes des 18. Jahrhunderts
- Die Analyse des Doppelgängermotivs und seiner Bedeutung für die Interpretation
Zusammenfassung der Kapitel (Chapter Summaries)
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die die "Judenbuche" als ein bedeutendes Werk deutscher Literatur des 19. Jahrhunderts vorstellt und die These der Leerstellenproblematik im Text einführt. Anschließend werden die beiden Lesarten des Textes, die Pro- und Anti-Mordthese, im Detail vorgestellt. Es wird diskutiert, wie die Interpretation der Leerstellen zu unterschiedlichen Deutungen der Geschichte führt.
In Kapitel 3 wird der Inhalt der Novelle zusammengefasst, wobei die besonderen Herausforderungen und die soziale Situation der Familie Mergel beleuchtet werden. Der Fokus liegt auf der Darstellung von Friedrichs Entwicklung und seinen Beziehungen zu den anderen Figuren. Dieses Kapitel bietet eine grundlegende Grundlage für die spätere Analyse der Leerstellen.
Kapitel 4 befasst sich mit den einzelnen Leerstellen des Textes, indem diese anhand der jeweiligen Thesen ausgewählter Sekundärliteratur untersucht werden. Die Analyse der Leerstellen konzentriert sich auf die Schuldfrage Friedrich Mergels und die Frage, welche Geschehnisse im Text durch die richtige Interpretation eine Schlüsselfunktion erhalten.
Schlüsselwörter (Keywords)
Die Arbeit konzentriert sich auf die Leerstellenproblematik, unterschiedliche Lesarten, die Schuldfrage Friedrich Mergels, soziale Strukturen, Doppelgängermotiv, "Judenbuche", Annette von Droste-Hülshoff, deutsche Literatur, 19. Jahrhundert.
Häufig gestellte Fragen
Was sind „Leerstellen“ in der Literaturwissenschaft?
Leerstellen sind unbestimmte Stellen im Text, die der Autor nicht explizit erklärt und die der Leser durch eigene Interpretation füllen muss.
Worum geht es in der Novelle „Die Judenbuche“?
Das Werk von Annette von Droste-Hülshoff behandelt ein Verbrechen im 18. Jahrhundert und die moralische sowie soziale Entwicklung der Hauptfigur Friedrich Mergel.
Welche kontroversen Lesarten der „Judenbuche“ gibt es?
Die Forschung unterscheidet vor allem zwischen der „Pro-Mordthese“ (Friedrich ist der Mörder) und der „Anti-Mordthese“, die alternative Deutungen zulässt.
Welche Rolle spielt das Doppelgängermotiv?
Die Figur des Johannes Niemand dient als Doppelgänger Friedrichs und verstärkt die Unklarheit über Identität und Schuld im Text.
Was kritisiert Norbert Mecklenburg an der bisherigen Forschung?
Mecklenburg schlägt eine Revision des „Fehlurteils“ vor und plädiert für eine neue Deutungsart, die soziale und strukturelle Aspekte stärker gewichtet.
- Arbeit zitieren
- Achim Oehm (Autor:in), 2010, Die Leerstellenproblematik in Annette von Droste-Hülshoffs ‚Judenbuche’, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/169024