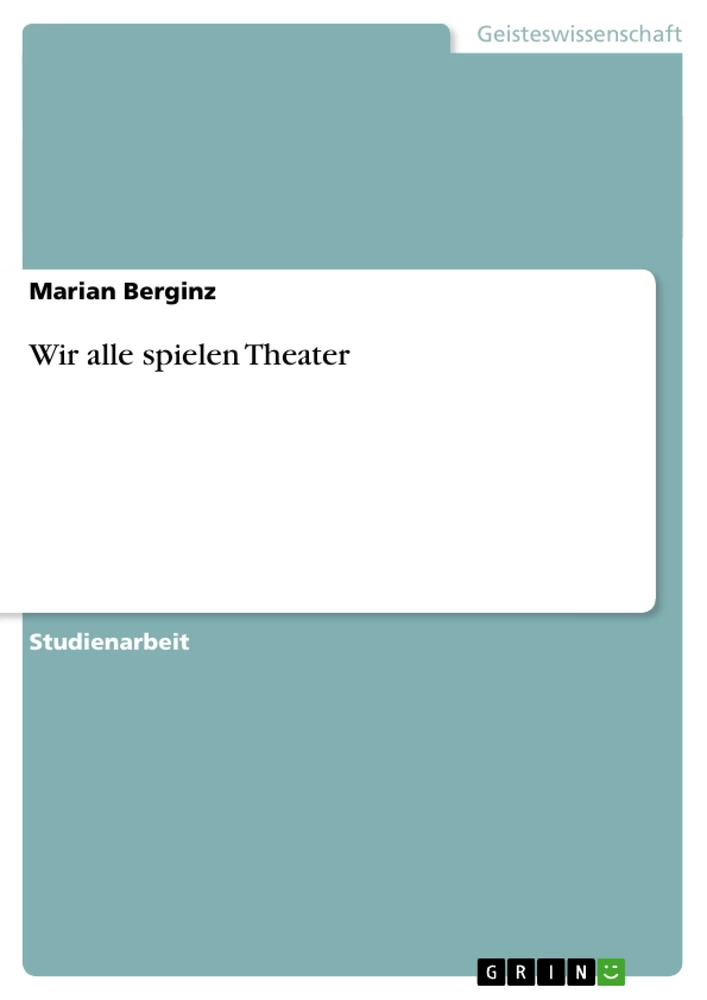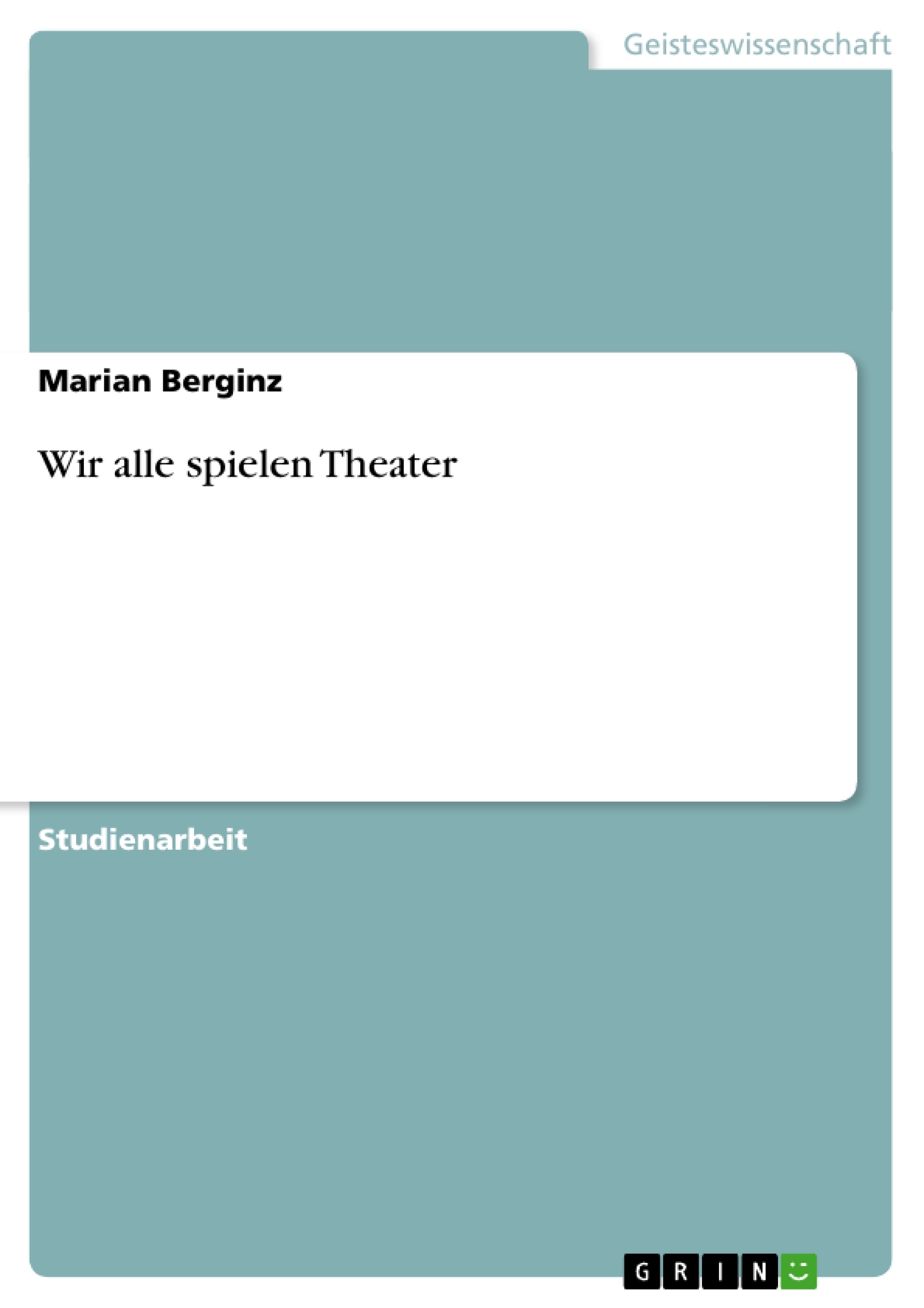Der symbolische Interaktionismus
ist im Gegensatz zu anderen soziologischen Theorien vorallem auf die kleinen Zusammenhänge in
konkreten Situationen ausgerichtet. Die Richtung entstand um die Jahrhundertwende in den USA,
vorallem in Chicago. Zu dieser Zeit gab es eine große Anzahl von Einwanderern, die sich zum
großen Teil in den Städten auf der Suche nach Arbeit niedergelassen hatten. Die Industrialisierung
hatte das Leben der Menschen grundlegend verändert und das nicht nur zum Guten. Dies alles
schlug sich natürlich auch auf den Universitäten nieder. Man verstand sich oft als „Anwälte sozialer
Reformen“ und hatte den Anspruch, Menschen irgendwie zu helfen. So auch Herbert Mead, der als
Begründer des Symbolischen Interaktionismus gilt. Man wollte ein neues Konzept entwickeln, aus
dem sich das menschliche Handeln „verstehen“ ließe. Große gesellschaftliche Vorgänge zu
„erklären“, war nicht das Ziel dieser Richtung. Es geht darum dem menschlichen Handeln einen
Sinn abzugewinnen. Wie der Name schon sagt, steht die Interaktion im Mittelpunkt. Mead
unterscheidet zwei Arten: „Nicht-symbolische“ und die „symbolische“ Interaktion. Die Letztere
unterscheidet sich dadurch von der Ersteren, dass das Ergebnis noch nicht feststeht und erst durch
Austausch von Gesten und Symbolen ausgehandelt wird. Diese Symbole können verbal oder nonverbal
sein; auf jeden Fall hat das Symbol die Eigenart, dass es nicht nur in dieser speziellen
Situation, sondern z.B. in der gesamten Gesellschaft verstanden wird. Im symbolischen
Interaktionismus wird davon ausgegangen, dass die Menschen aufgrund der Bedeutung handeln, die
die Dinge für sie haben. Sie entsteht in der Interaktion zwischen Menschen und wird mit Symbolen
ausgedrückt. Die Bedeutung ist aber nicht für alle Mal festgelegt, sondern wird immer neu
interpretiert und festgelegt. Eng verbunden mit dem Symbolischen Interaktionismus ist die Rolle.
Sie wird einem nicht total von vorne bis hinten vorgegeben, sondern man macht sie zu einem guten
Teil selber. Man versetzt sich in die Rolle des anderen und gestaltet derweil seine eigene aus. Hat
man seine eigene Rolle gefunden und kann man die seines Gegenüber genau einschätzen, ist
Rollenhandeln möglich. Zugleich mit der Konstruktion und der Festigung einer Rolle ergibt sich die
Identität. Man ist sich seiner Rolle bewusst geworden. Durch Rollenübernahme des anderen erklärt
Mead aber auch das Erwachsenwerden von Kindern. [...]
Inhaltsverzeichnis
- A) Der symbolische Interaktionismus
- B) Kurzer Überblick über das Leben und die Werke Erving Goffmans
- Deutsche Übersetzungen
- C) Interaktion bei Goffman
- D) Wir alle spielen Theater - Das „dramaturgische“ Modell
- E) Das Menschenbild Goffmans & Kritik am Modell
- F) Quellen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Der Text befasst sich mit der soziologischen Theorie des symbolischen Interaktionismus und insbesondere mit den Werken von Erving Goffman. Er beleuchtet Goffmans Beitrag zur Soziologie, insbesondere seine Konzepte der „interaction order“ und des „dramaturgischen Modells“ der Selbstdarstellung.
- Der symbolische Interaktionismus und seine Entstehungsgeschichte
- Goffmans Leben und Werk im Überblick
- Goffmans Konzepte der Interaktion, insbesondere die „interaction order“
- Die Rolle der Selbstdarstellung im sozialen Kontext
- Goffmans Menschenbild und Kritik an seinem Modell
Zusammenfassung der Kapitel
A) Der symbolische Interaktionismus
Dieses Kapitel führt in den symbolischen Interaktionismus ein, eine soziologische Theorie, die sich mit der Bedeutung von Symbolen und Interaktion im menschlichen Handeln beschäftigt. Es werden die zentralen Merkmale des symbolischen Interaktionismus erläutert und seine Entstehung im Kontext der damaligen Zeit in den USA beleuchtet.
B) Kurzer Überblick über das Leben und die Werke Erving Goffmans
Dieses Kapitel bietet eine kurze Biografie von Erving Goffman und skizziert seine wichtigsten Werke und Beiträge zur Soziologie. Es beleuchtet seine Schwerpunkte in der Forschung und seinen Einfluss auf das soziologische Denken.
C) Interaktion bei Goffman
Dieses Kapitel befasst sich mit Goffmans Konzepten der Interaktion und der „interaction order“. Es werden die verschiedenen Formen der Interaktion und ihre Strukturierung im sozialen Kontext erläutert.
Schlüsselwörter
Die zentralen Schlüsselwörter des Textes sind: symbolischer Interaktionismus, Erving Goffman, interaction order, dramaturgisches Modell, Selbstdarstellung, Interaktion, Kommunikation, soziale Situationen, Zusammenkünfte, zentrierte und nichtzentrierte Interaktion, Eindrucksmanagement.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der symbolische Interaktionismus?
Eine soziologische Theorie, die menschliches Handeln durch die Bedeutung erklärt, die Dinge und Symbole in der sozialen Interaktion erhalten.
Was bedeutet Goffmans „dramaturgisches Modell“?
Erving Goffman vergleicht soziales Leben mit einem Theaterstück, in dem Individuen Rollen spielen und „Eindrucksmanagement“ betreiben, um ein bestimmtes Bild von sich zu vermitteln.
Was versteht man unter „interaction order“?
Es beschreibt die Struktur und die ungeschriebenen Regeln, die das Verhalten von Menschen in unmittelbarer physischer Gegenwart zueinander ordnen.
Wie unterscheiden sich verbale und non-verbale Symbole?
Verbale Symbole sind Sprache; non-verbale Symbole sind Gesten, Kleidung oder Mimik, die in einer Gesellschaft eine geteilte Bedeutung haben.
Welche Kritik gibt es an Goffmans Modell?
Kritiker bemängeln oft ein zu zynisches Menschenbild, in dem das Individuum nur noch aus Masken und Fassaden bestehe, ohne einen „echten“ Kern.
- Quote paper
- Marian Berginz (Author), 2002, Wir alle spielen Theater, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/16905