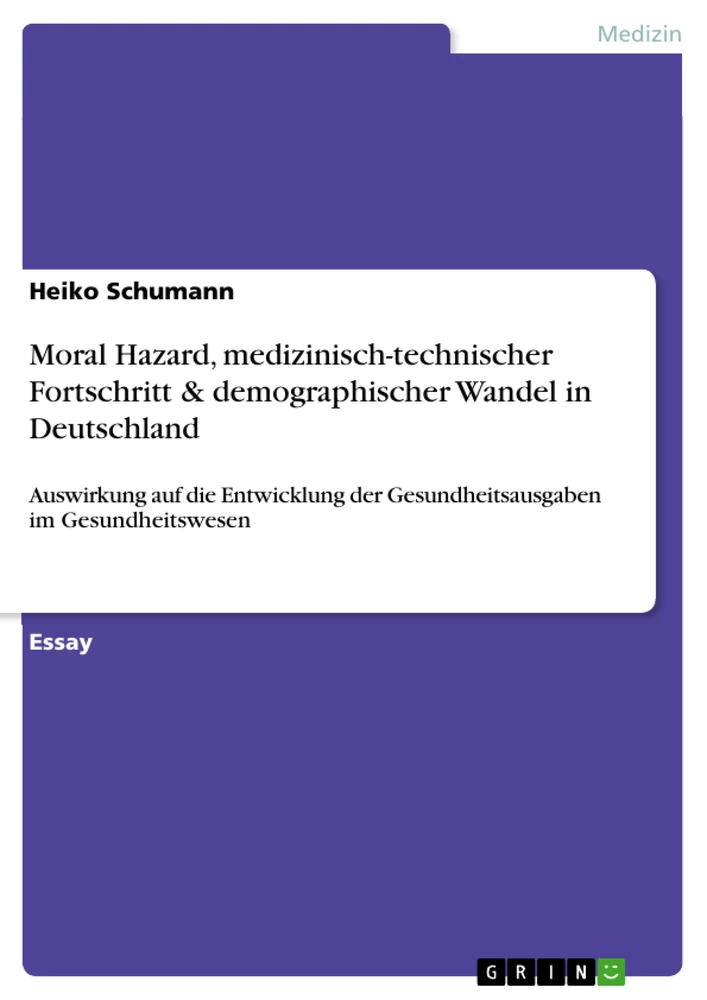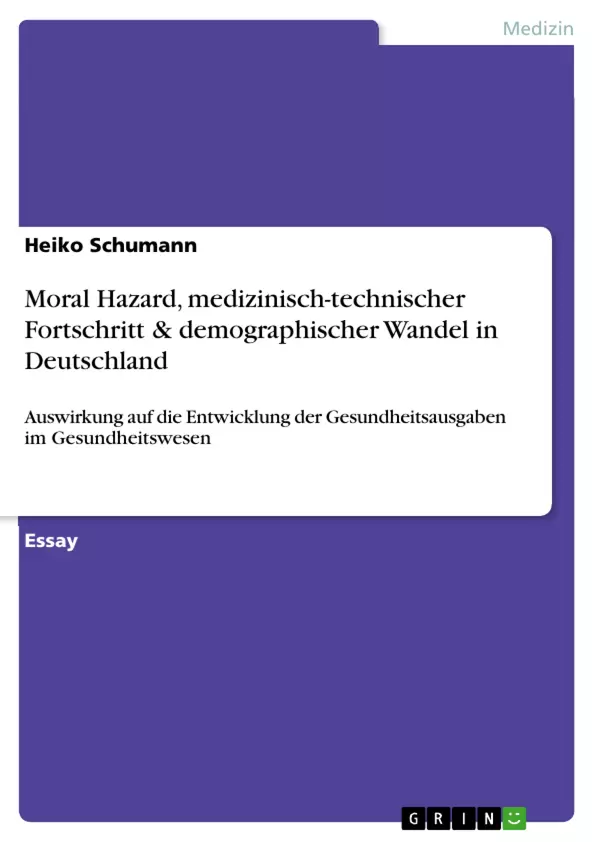Moral Hazard im Versicherungssystem verändert das Inanspruchnahmeverhalten des Versicherten und dessen Agenten und führt zum Marktversagen, zu steigenden Ausgaben und somit zur Fehlallokationen. Grundsätzlich lässt sich festhalten, dass die im Text beschriebenen Probleme durch Moral Hazard ebenso den Missbrauch bei der Allokation von Gesundheitsgütern aufzeigen (Friedrich 2007).
Die Herausforderung der Gesundheitspolitik liegt in der Neugestaltung des Marktwettbewerbes.
Auszuführen ist, dass medizinisch-technischer Fortschritt und demographische Entwicklung nur in Abhängigkeit voneinander als Einflussgrößen der Ausgabenentwicklung im Gesundheitswesen zu betrachten sind.
Der medizinisch-technische Fortschritt kann sich nicht durch seine eigenen Effizienzsteigerungen finanzieren. Dies kann jedoch nur als theoretischer Grund für einen Nachteil des medizinisch-technischen Fortschritts gegenüber dem allgemeinen technischen Fortschritt angesehen werden.
Unter dem Begriff „demographischer Wandel“ wird eine langfristige Veränderung der Bevölkerungsstruktur der Gesellschaft verstanden (Niehaus 2006). In den vergangenen 125 Jahren ist die Lebenserwartung in Deutschland gravierend angestiegen (Kolip 2002). Nach Angaben Bertelsmann Stiftung wird durch demographischen Wandel die Zahl der heute über Achtzigjährigen von 3,7 Mio. auf fast 6 Mio. 2020 ansteigen (Bertelsmann Stiftung 2008).
Die Ergebnisse sind dagegen nicht einfach auf die monetäre Seite übertragbar. Die Kompression der Lebensqualität bedingt nicht automatisch eine finanzielle Entlastung des Gesundheitssystems. Die an sich erfreuliche Verlängerung der Lebenszeit, die sogenannte demographische Alterung könnte sogar, so Felder (2008), nur einen schwachen Einfluss auf die Gesundheitsausgaben einer Bevölkerung haben. Ein abweichender inhaltlicher Schwerpunkt der Hypothese zu den Konzepten Medikalisierung und Kompression sei die entscheidende Betrachtung der Nähe zum Tod.
Zusammenfassend eingeschätzt wird deutlich, dass der demographische Wandel in seinen Auswirkungen auf das Gesundheitssystem konstruktiv im Sinne einer Entdramatisierung sowie empirisch unterlegt in Wissenschaft, Politik und Gesellschaft diskutiert werden muss.
Inhaltsverzeichnis (Table of Contents)
- Moral Hazard im Gesundheitswesen
- Moral Hazard Verhalten
- Moral Hazard am Beispiel der Krankenversicherung
- Paradigmenwechsel des Gesundheitssektors und deren Auswirkung auf die Behandlungskosten
- Zusammenfassung Moral Hazard
- Technischer Fortschritt
- Medizinisch technischer Fortschritt in Abhängigkeit der Gesundheitsausgaben
- Zusammenfassung Med.-techn. Fortschritt
- Demographischer Wandel als Herausforderung für das Gesundheitssystem
- Diskussion der Konzepte: Medikalisierungsthese vs. Kompressionsthese
- Medikalisierungsthese
- Kompressionsthese
- Ergebnisse der demographischen Entwicklung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte (Objectives and Key Themes)
Die Arbeit untersucht die Auswirkungen von Moral Hazard, medizinisch-technischem Fortschritt und demographischem Wandel auf die Entwicklung der Gesundheitsausgaben in Deutschland. Sie analysiert, wie diese Faktoren die Nachfrage nach Gesundheitsleistungen beeinflussen und zu einem Anstieg der Kosten führen können.
- Moral Hazard im Gesundheitswesen
- Medizinisch-technischer Fortschritt und seine Auswirkungen
- Demographischer Wandel und die Herausforderungen für das Gesundheitssystem
- Medikalisierungsthese vs. Kompressionsthese
- Entwicklung der Gesundheitsausgaben
Zusammenfassung der Kapitel (Chapter Summaries)
- Kapitel 1: Moral Hazard im Gesundheitswesen: Dieses Kapitel behandelt das Konzept des Moral Hazard und seine Auswirkungen auf das Gesundheitswesen. Es analysiert die verschiedenen Arten von Moral Hazard und stellt am Beispiel der Krankenversicherung die Folgen für die Kostenentwicklung dar.
- Kapitel 2: Paradigmenwechsel des Gesundheitssektors und deren Auswirkung auf die Behandlungskosten: Dieses Kapitel befasst sich mit dem Paradigmenwechsel im deutschen Gesundheitswesen, der durch Faktoren wie den demographischen Wandel und das Inanspruchnahmeverhalten der Versicherten ausgelöst wurde. Es analysiert die Folgen für die Behandlungskosten und den Wettbewerb im Gesundheitsmarkt.
- Kapitel 3: Zusammenfassung Moral Hazard: Dieses Kapitel fasst die zentralen Erkenntnisse aus dem Kapitel über Moral Hazard zusammen und beleuchtet die Herausforderungen für die Gesundheitspolitik.
- Kapitel 4: Technischer Fortschritt: Dieses Kapitel untersucht den technischen Fortschritt im Gesundheitswesen und seine Auswirkungen auf die Gesundheitskosten. Es analysiert die Beziehung zwischen dem technischen Fortschritt und der Nachfrage nach Gesundheitsleistungen.
- Kapitel 5: Medizinisch technischer Fortschritt in Abhängigkeit der Gesundheitsausgaben: Dieses Kapitel setzt sich mit dem Einfluss des medizinisch-technischen Fortschritts auf die Entwicklung der Gesundheitsausgaben auseinander.
- Kapitel 6: Zusammenfassung Med.-techn. Fortschritt: Dieses Kapitel fasst die zentralen Erkenntnisse aus den Kapiteln über den technischen Fortschritt und seinen Auswirkungen auf die Gesundheitskosten zusammen.
- Kapitel 7: Demographischer Wandel als Herausforderung für das Gesundheitssystem: Dieses Kapitel analysiert den demographischen Wandel in Deutschland und seine Folgen für das Gesundheitssystem. Es beleuchtet die Herausforderungen für die Finanzierung des Gesundheitswesens und die Auswirkungen auf die Nachfrage nach Gesundheitsleistungen.
- Kapitel 8: Diskussion der Konzepte: Medikalisierungsthese vs. Kompressionsthese: Dieses Kapitel diskutiert zwei gegensätzliche Thesen zur Entwicklung des Gesundheitssystems: die Medikalisierungsthese und die Kompressionsthese. Es analysiert die Argumente für und gegen beide Thesen.
- Kapitel 9: Ergebnisse der demographischen Entwicklung: Dieses Kapitel präsentiert die Ergebnisse der demographischen Entwicklung und ihre Auswirkungen auf das deutsche Gesundheitssystem.
Schlüsselwörter (Keywords)
Moral Hazard, Gesundheitswesen, Krankenversicherung, medizinisch-technischer Fortschritt, demographischer Wandel, Medikalisierungsthese, Kompressionsthese, Gesundheitsausgaben, Behandlungskosten, Inanspruchnahmeverhalten, Gesundheitspolitik.
Häufig gestellte Fragen zu Moral Hazard und demographischem Wandel
Was bedeutet Moral Hazard im Gesundheitswesen?
Moral Hazard bezeichnet das veränderte Inanspruchnahmeverhalten von Versicherten, die Leistungen stärker nutzen, weil sie nicht die vollen Kosten tragen müssen, was zu steigenden Gesamtausgaben führt.
Wie wirkt sich der medizinisch-technische Fortschritt auf die Kosten aus?
Fortschritt führt oft zu teureren Behandlungsmethoden. Er kann sich meist nicht durch eigene Effizienzsteigerungen finanzieren und treibt so die Gesundheitsausgaben in die Höhe.
Was ist der Unterschied zwischen Medikalisierungs- und Kompressionsthese?
Die Medikalisierungsthese erwartet steigende Kosten durch längere Krankheitsphasen im Alter. Die Kompressionsthese hofft, dass schwere Krankheiten auf einen kurzen Zeitraum vor dem Tod begrenzt werden können.
Erhöht die steigende Lebenserwartung zwangsläufig die Kosten?
Nicht zwingend. Studien deuten darauf hin, dass eher die Nähe zum Tod als das kalendarische Alter die Gesundheitsausgaben bestimmt (Sterbekosten-Hypothese).
Welche Herausforderungen bringt der demographische Wandel für die Politik?
Die Politik muss den Marktwettbewerb neugestalten und Finanzierungsmodelle finden, die der alternden Gesellschaft und der steigenden Zahl von über Achtzigjährigen gerecht werden.
- Arbeit zitieren
- Heiko Schumann (Autor:in), 2010, Moral Hazard, medizinisch-technischer Fortschritt & demographischer Wandel in Deutschland, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/169148