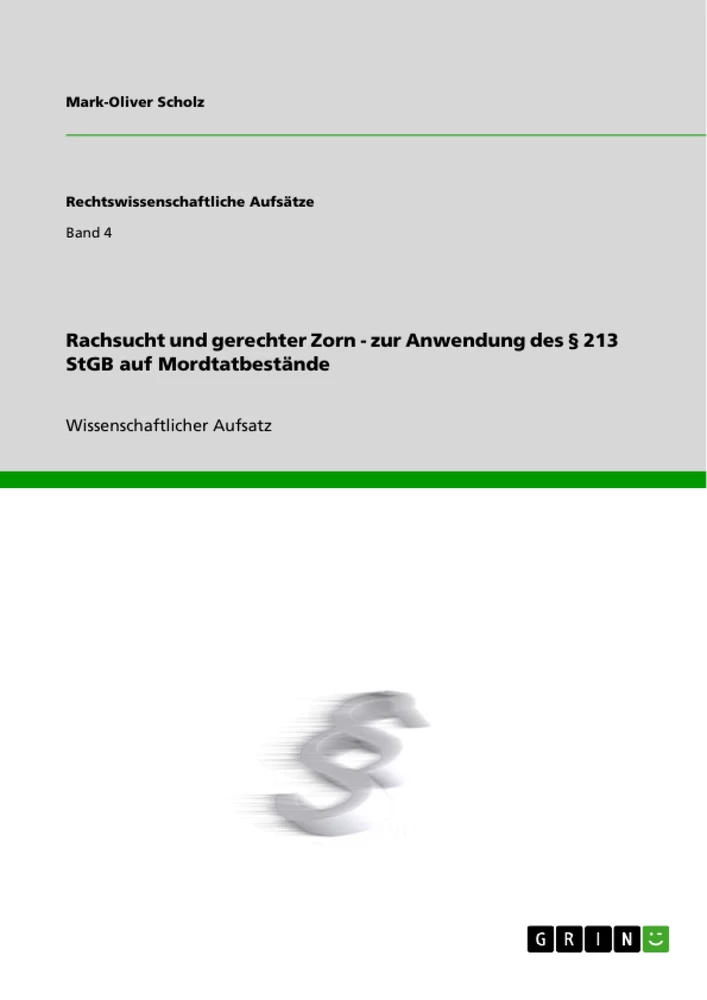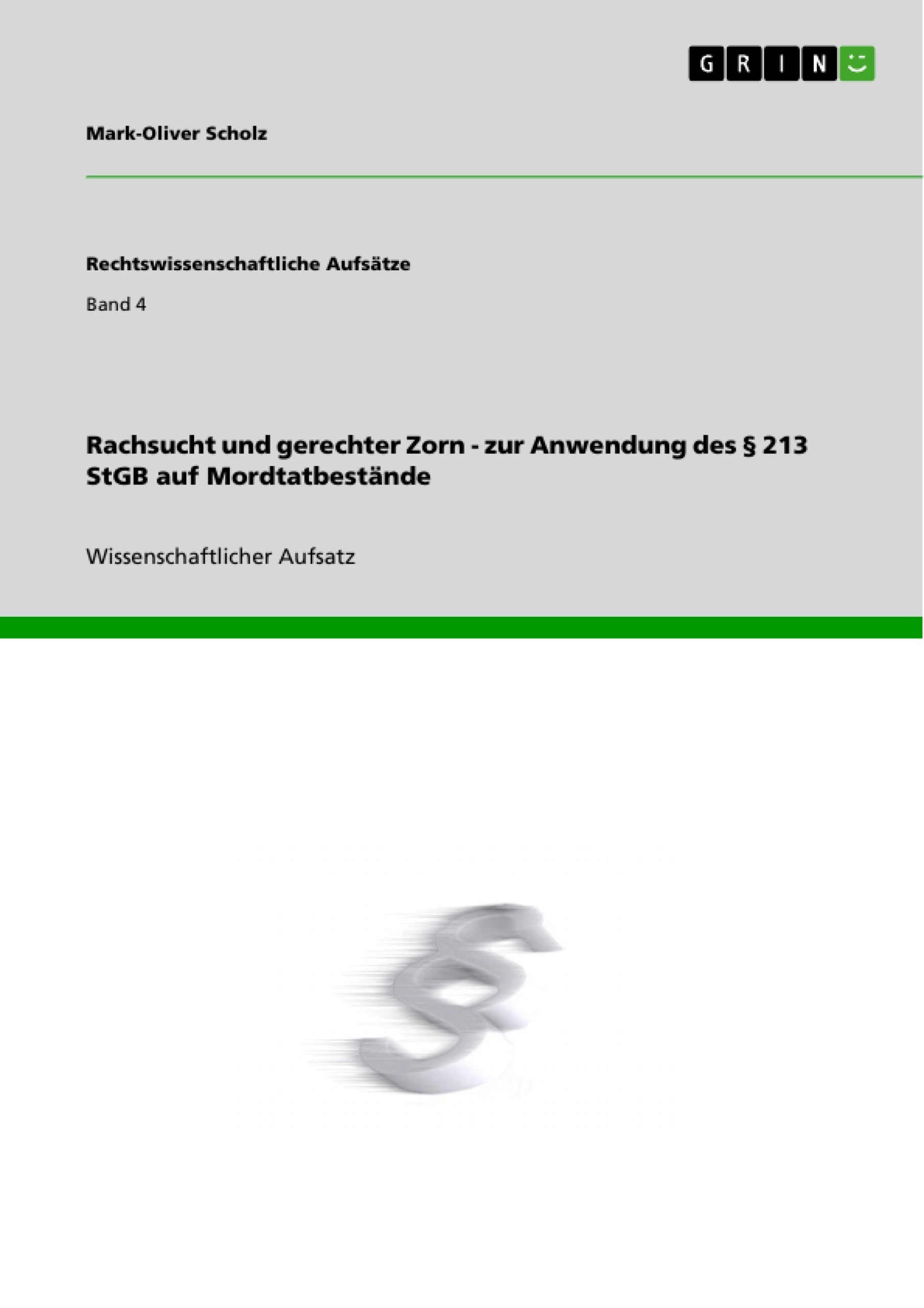Nach allgemeiner Auffassung findet die Strafzumessungsregel des § 213 StGB auf Verwirklichungen eines Mordtatbestandes keine direkte Anwendung.
Hierbei drängt sich unter anderem sofort die Frage auf, worin sich gerechter Zorn von einer Rachsucht, welche als niedriger Beweggrund und somit als Mordmerkmal definiert wird, unterscheidet.
Der Aufsatz "Rachsucht und gerechter Zorn - zur Anwendung des § 213 StGB auf Mordtatbestände" beschäftigt sich abrissartig mit den Ursachen der Wertungsunterschiede des Gesetzgebers und den Auswirkungen auf das Strafmaß.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- 1. Sozialethisch besondere Verwerflichkeit
- 2. Begründungserwägungen
- 3. Ursachen der Wertungswidersprüche
- 4. Ergebnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht die Anwendung des § 213 StGB (mildernde Umstände bei Taten in einem Zustand der erheblichen Affektbetroffenheit) auf Mordtatbestände. Der Fokus liegt auf der Abgrenzung zwischen Rachsucht (als niedrigem Beweggrund) und gerechtem Zorn, und den daraus resultierenden Problemen der Strafzumessung. Es werden verschiedene Lösungsansätze und Rechtsprechungsmeinungen diskutiert, um die bestehenden Wertungswidersprüche zu lösen.
- Abgrenzung von Rachsucht und gerechtem Zorn
- Anwendung des § 213 StGB bei Mord
- Lösungsansätze für Wertungswidersprüche im Strafrecht
- Analyse der Rechtsprechung des BGH
- Bewertung der Strafmilderung im Kontext von Affekt und Motivbündeln
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in die Problematik der Anwendung des § 213 StGB auf Mordtatbestände ein. Sie stellt die zentrale Frage nach der Abgrenzung zwischen Rachsucht als niedrigem Beweggrund und gerechtem Zorn als milderndem Umstand dar. Die Einleitung hebt die Schwierigkeit der Abgrenzung aufgrund des wandelnden sittlichen Empfindens hervor und kündigt die im Folgenden zu behandelnden Lösungsansätze an. Sie verweist auf die bestehenden Diskrepanzen in der Rechtsprechung und unterstreicht die Notwendigkeit einer Klärung dieser Problematik, um unerwünschte Missstände zu beseitigen.
1. Sozialethisch besondere Verwerflichkeit: Dieses Kapitel untersucht die vorgeschlagene Korrektur des § 211 StGB (Mord) mittels eines ungeschriebenen Mordmerkmals der "besonderen Verwerflichkeit". Es argumentiert, dass die Diskrepanz zwischen § 211 StGB (ausdrücklich besonders verwerfliche Gesinnung) und § 213 StGB (geminderte kriminelle Energie) zu einem Ausschluss der gleichzeitigen Anwendung führt. Die Argumentation basiert auf der Annahme, dass eine Tat nicht gleichzeitig Ausdruck einer unerträglichen und einer verständlichen Einstellung sein kann. Jedoch wird die Problematik aufgezeigt, dass eine Tötung aus Zorn auch durch ein weiteres Mordmerkmal (z.B. Heimtücke) erweitert sein kann, was die Anwendung des § 213 StGB weiterhin problematisch erscheinen lässt.
2. Begründungserwägungen: Dieses Kapitel analysiert verschiedene Lösungsansätze für die Kollisionsfälle zwischen § 211 und § 213 StGB. Es diskutiert die Auffassung des BGH, wonach eine Anwendung des § 213 StGB auch bei Vorliegen eines Motivbündels nicht ausgeschlossen ist, da menschliches Handeln oft auf mehrere Beweggründe zurückzuführen ist. Die Argumentation wird kritisch hinterfragt: Es wird in Frage gestellt, warum gerade § 213 StGB für Fälle multipler Motive Anwendung finden soll, insbesondere wenn besonders verwerfliche Motive vorliegen. Ein Vergleich mit § 21 StGB (verminderte Schuldfähigkeit) wird gezogen, um die Bedeutung des Affekts im Kontext der Strafmilderung zu beleuchten. Es wird argumentiert, dass der Affekt im Sinne des § 213 StGB nicht nur ein auslösendes Motiv sein darf, sondern von solcher Durchschlagkraft sein muss, dass er alle anderen Motive verdrängt. Letztlich wird ein Lösungsansatz vorgestellt, der eine Konkurrenz der Delikte unter bestimmten Voraussetzungen ausschließt, jedoch die Problematik des Bedeutungswissens in Bezug auf die Arglosigkeit des Opfers berührt.
Schlüsselwörter
§ 211 StGB, § 213 StGB, Mord, Rachsucht, gerechter Zorn, niedriger Beweggrund, Strafzumessung, Motivbündel, Affekt, Rechtsprechung, BGH, Strafmilderung, Wertungswidersprüche.
Häufig gestellte Fragen zur Analyse der Anwendung von § 213 StGB bei Mord
Was ist das Thema der Arbeit?
Die Arbeit analysiert die Anwendung des § 213 StGB (mildernde Umstände bei Taten in einem Zustand der erheblichen Affektbetroffenheit) auf Mordtatbestände (§ 211 StGB). Der Schwerpunkt liegt auf der schwierigen Abgrenzung zwischen Rachsucht (als niedrigem Beweggrund) und gerechtem Zorn, und den daraus resultierenden Problemen bei der Strafzumessung.
Welche zentralen Fragen werden behandelt?
Die Arbeit befasst sich mit der Frage, wie Rachsucht und gerechter Zorn im Kontext von Mord und § 213 StGB abgegrenzt werden können. Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Klärung von Wertungswidersprüchen, die sich aus der Anwendung des § 213 StGB bei Vorliegen von Mordmerkmalen ergeben. Die Arbeit untersucht verschiedene Lösungsansätze und Rechtsprechungsmeinungen, um diese Widersprüche zu lösen.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, gefolgt von Kapiteln zu "Sozialethisch besondere Verwerflichkeit", "Begründungserwägungen" und einem abschließenden Ergebniskapitel. Die Einleitung führt in die Problematik ein und stellt die Forschungsfrage dar. Die Kapitel behandeln verschiedene Lösungsansätze und kritische Analysen der Rechtsprechung.
Wie wird die Abgrenzung zwischen Rachsucht und gerechtem Zorn behandelt?
Die Abgrenzung zwischen Rachsucht und gerechtem Zorn bildet den Kern der Arbeit. Es wird untersucht, wie diese Unterscheidung in der Praxis vorgenommen wird und welche Schwierigkeiten sich dabei ergeben. Die Arbeit beleuchtet die Problematik des wandelnden sittlichen Empfindens und die daraus resultierenden unterschiedlichen Bewertungen in der Rechtsprechung.
Welche Rolle spielt der BGH in der Arbeit?
Die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs (BGH) spielt eine wichtige Rolle. Die Arbeit analysiert die Auffassungen des BGH zur Anwendung des § 213 StGB bei Mord und bei Vorliegen von Motivbündeln. Die Argumentationen des BGH werden kritisch hinterfragt und diskutiert.
Wie werden Wertungswidersprüche im Strafrecht angesprochen?
Die Arbeit analysiert die Wertungswidersprüche, die sich aus der Anwendung des § 213 StGB auf Mordtatbestände ergeben. Es werden verschiedene Lösungsansätze diskutiert, um diese Widersprüche zu beseitigen und eine gerechtere Strafzumessung zu gewährleisten.
Welche Lösungsansätze werden vorgeschlagen?
Die Arbeit präsentiert und diskutiert verschiedene Lösungsansätze zur Bewältigung der Wertungswidersprüche. Dies beinhaltet unter anderem die kritische Auseinandersetzung mit dem Konzept der "besonderen Verwerflichkeit" und die Analyse der Bedeutung des Affekts im Kontext der Strafmilderung nach § 213 StGB. Es wird auch ein eigener Lösungsansatz vorgestellt, der die Konkurrenz der Delikte unter bestimmten Voraussetzungen ausschließt.
Welche Schlüsselbegriffe sind relevant?
Wichtige Schlüsselbegriffe sind § 211 StGB, § 213 StGB, Mord, Rachsucht, gerechter Zorn, niedriger Beweggrund, Strafzumessung, Motivbündel, Affekt, Rechtsprechung, BGH, Strafmilderung und Wertungswidersprüche.
- Quote paper
- Mark-Oliver Scholz (Author), 2010, Rachsucht und gerechter Zorn - zur Anwendung des § 213 StGB auf Mordtatbestände, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/169176