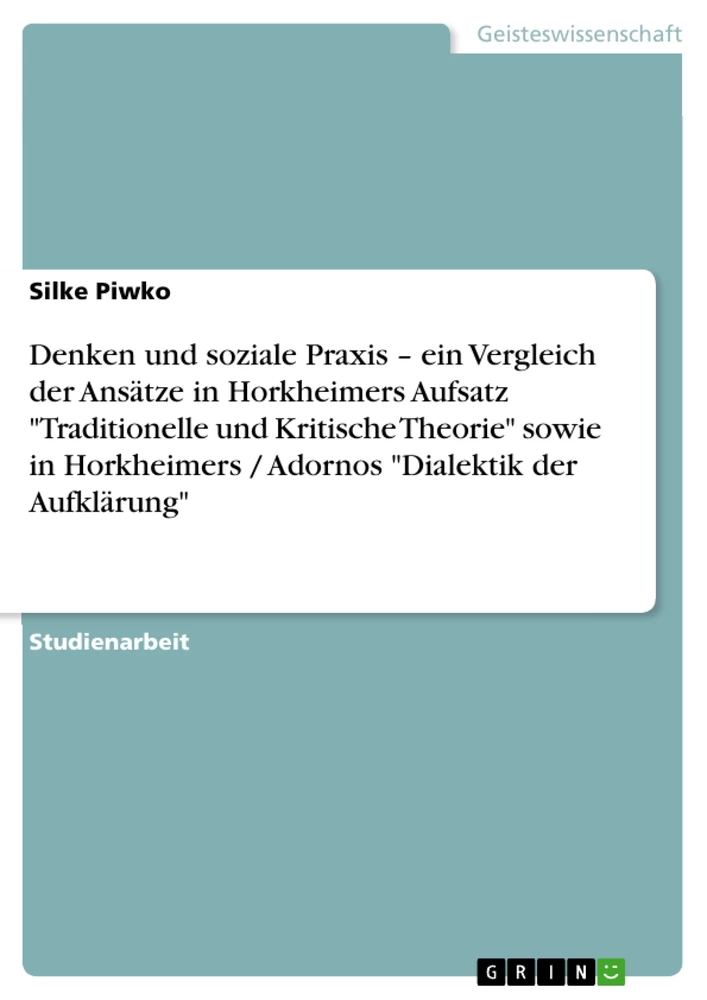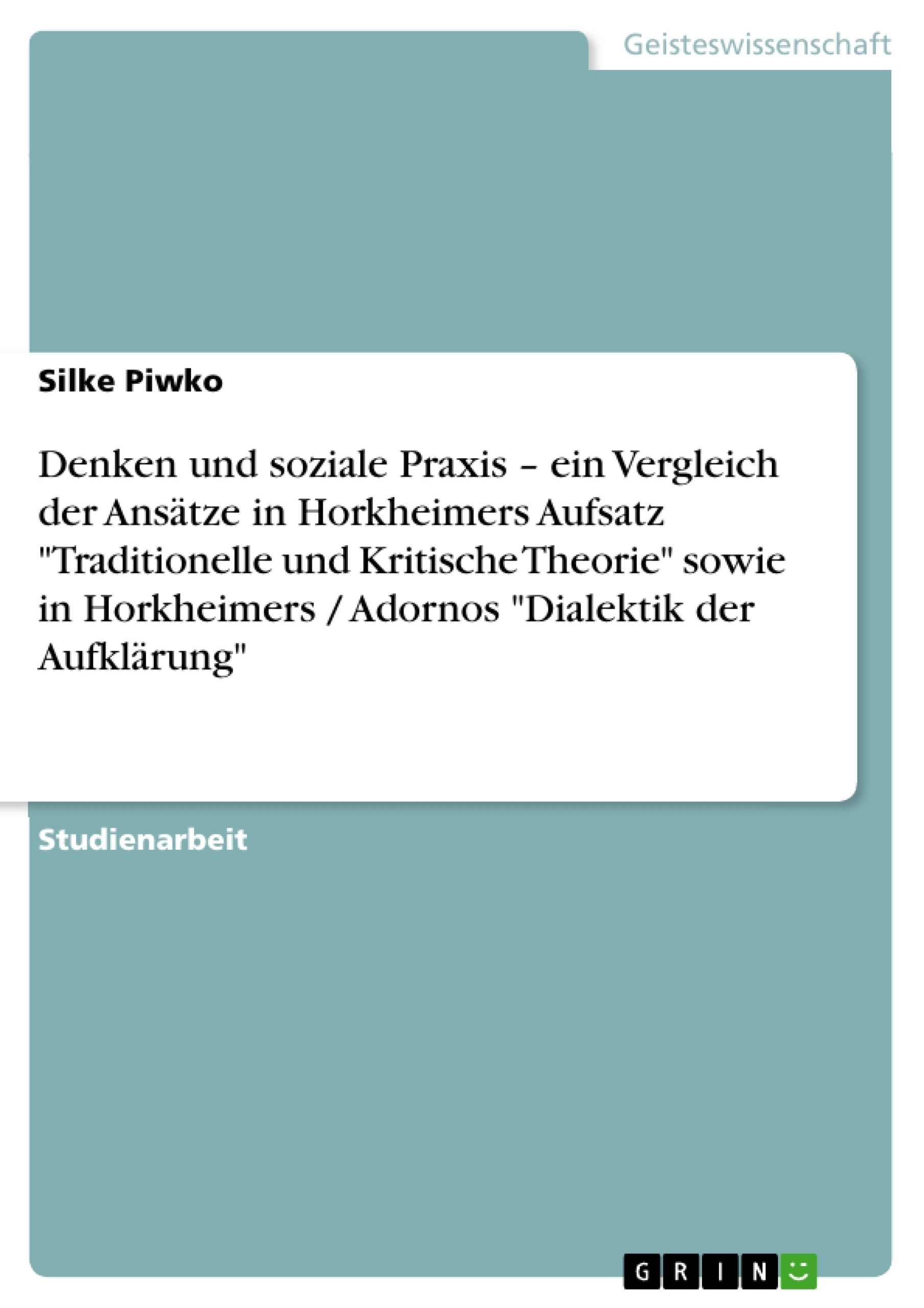Mit der Arbeit sollen die Rolle und Bedeutung des „kritischen Denkens“ und die damit versuchte Erfassung sozialer Praxis im Institutsprogramm des frühen Horkheimer dargestellt werden. Zugleich soll anhand der „Dialektik der Aufklärung“, die gemeinsam mit Adorno unter dem Eindruck der Entwick-lung des Faschismus geschrieben wurde, der eingesetzte Paradigmenwechsel im Verständnis des Problemzusammenhangs zwischen Denken und sozialer Praxis in der früher kT beschrieben werden.
Die Entwicklung der Menschheitsgeschichte wird alleinig auf den Entfaltungsprozess der Umarbeitung und Beherrschung der Natur zurückgeführt. Die kT weiß allerdings im Gegensatz zur tT um die Logik der gesellschaftlichen Entwicklung. Dieses „kritische Verhalten“ des Subjekts steht dabei in bewusster Opposition zur Gesellschaft mit ihrer gemeinschaftlichen Organisation der Produktivkräfte, aber auch der daraus resultierenden und darauf aufbauenden Kultur. Träger dieses Verhaltens ist dabei nicht die gesellschaftliche Klasse des Proletariats an sich, sondern der „oppositionelle Intellektuelle und Theoretiker“. In der gemeinsam mit Adorno 1947 veröffentlichten „Dialektik der Aufklärung“ (DA) wurde die kritischen Theorie als Kritik an der Moderne und vor dem Hintergrund der Schrecken des Faschismus und des Krieges weiterentwickelt. Dabei stehen das „Projekt der Aufklärung“, ihre bewirkte Zerstörung des Mythos und die „Pathologien der modernen Gesellschaften … [als Ergebnis] der Verfallsgeschichte der abendländischen Rationalität“ (Hetzel 2001: 150) im Mittelpunkt der Betrachtungen. Dabei entzaubert die Aufklärung die Welt durch Dekonstruktion religiöser Vorstellungen und Institutionen. Soziale Praxis wird hierbei durch Horkheimer/Adorno vor dem Hintergrund der damaligen geschichtlichen Erfahrungen negativ in Bezug auf die Vernunft, die eine instrumentelle Vernunft darstellt, interpretiert und daraus dementsprechend die Fähigkeit zur Entwicklung normativer Kriterien für die gesellschaftliche Entwicklung sowie positive Inhalte der Aufklärung abgesprochen. Sah Horkheimer in „Traditionelle und kritische Theorie“ noch das positive gesellschaftsverändernde Potenzial eines „kritischen Denkens“ und „kritischen Verhaltens“, so ist dies in der „Dialektik der Aufklärung“ einem völlig negativistischen Verständnis sozialer Praxis gewichen.
Inhaltsverzeichnis (Table of Contents)
- Einleitung
- Kritisches Denken und kritisches Verhalten in Horkheimers frühem Institutsprogramm
- Traditionelle Theorie und Horkheimers Entwurf einer kritischen Theorie
- Kritisches Denken und kritisches Verhalten
- Der Intellektuelle und das Proletariat
- Das soziale Defizit des frühen Institutsprogramms
- Denken und Naturbeherrschung in der „,Dialektik der Aufklärung”
- Mythos und Aufklärung
- Vernunft und Denken
- Die soziale Praxis in der „Dialektik der Aufklärung”
- Kritische Würdigung und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte (Objectives and Key Themes)
Die vorliegende Hausarbeit befasst sich mit der Entwicklung des Zusammenhangs zwischen Denken und sozialer Praxis in der kritischen Theorie (KT), wobei sie sich auf den Aufsatz „Traditionelle und kritische Theorie“ sowie die „Dialektik der Aufklärung“ konzentriert. Die Arbeit zielt darauf ab, die Rolle und Bedeutung des „kritischen Denkens“ und dessen Verbindung zur sozialen Praxis im frühen Institutsprogramm von Horkheimer zu beleuchten. Darüber hinaus soll die Veränderung des Denkens über den Zusammenhang zwischen Denken und sozialer Praxis innerhalb der KT anhand der „Dialektik der Aufklärung“ dargestellt werden, welche vor dem Hintergrund der Entwicklung des Faschismus entstanden ist.
- Die Entwicklung des Denkens über den Zusammenhang zwischen Denken und sozialer Praxis in der kritischen Theorie
- Die Rolle und Bedeutung des „kritischen Denkens“ im frühen Institutsprogramm von Horkheimer
- Die Verbindung zwischen „kritischem Denken“ und sozialer Praxis
- Der Wandel im Verständnis des Problemzusammenhangs zwischen Denken und sozialer Praxis in der KT
- Die Bedeutung der „Dialektik der Aufklärung“ im Kontext des Faschismus und der Modernisierung
Zusammenfassung der Kapitel (Chapter Summaries)
- Einleitung: Diese Einleitung führt in die Thematik der Hausarbeit ein, indem sie den Zusammenhang zwischen Denken und sozialer Praxis in der kritischen Theorie beleuchtet und die beiden zentralen Werke, „Traditionelle und kritische Theorie“ und „Dialektik der Aufklärung“, als Gegenstand der Analyse vorstellt.
- Kritisches Denken und kritisches Verhalten in Horkheimers frühem Institutsprogramm: Dieser Abschnitt beschäftigt sich mit Horkheimers Konzept des „kritischen Denkens“ und dessen Anwendung in der Praxis. Er setzt sich mit der Unterscheidung zwischen traditioneller und kritischer Theorie auseinander und beleuchtet die Rolle des „kritischen Verhaltens“ in Horkheimers Institutsprogramm.
- Denken und Naturbeherrschung in der „,Dialektik der Aufklärung”: Dieser Abschnitt untersucht die „Dialektik der Aufklärung“ und deren Kritik an der Aufklärung und der modernen Gesellschaft. Er beleuchtet die Rolle der Vernunft und der Naturbeherrschung im Kontext von Mythos und Aufklärung und untersucht, wie Horkheimer und Adorno den Zusammenhang zwischen Denken und sozialer Praxis unter den Bedingungen der modernen Gesellschaft sehen.
Schlüsselwörter (Keywords)
Die zentralen Themen der Hausarbeit sind die kritische Theorie, die Traditionelle Theorie, das kritische Denken, das kritische Verhalten, der Intellektuelle, das Proletariat, die Dialektik der Aufklärung, Mythos, Vernunft, Naturbeherrschung und soziale Praxis. Die Arbeit untersucht die Entwicklung des Zusammenhangs zwischen Denken und sozialer Praxis im Kontext der kritischen Theorie und ihrer Auseinandersetzung mit der Moderne.
Häufig gestellte Fragen
Was unterscheidet die Traditionelle von der Kritischen Theorie?
Die Traditionelle Theorie sieht sich als wertfrei und beobachtend, während die Kritische Theorie eine bewusste Opposition zur bestehenden Gesellschaft einnimmt und deren Veränderung anstrebt.
Was ist die Hauptthese der „Dialektik der Aufklärung“?
Horkheimer und Adorno argumentieren, dass Aufklärung in Mythos zurückschlägt und die Vernunft zur reinen instrumentellen Naturbeherrschung verkommt.
Wer ist der Träger des „kritischen Verhaltens“?
Im frühen Institutsprogramm ist dies nicht primär das Proletariat, sondern der oppositionelle Intellektuelle und Theoretiker.
Wie veränderte der Faschismus die Kritische Theorie?
Die Erfahrung des Faschismus führte zu einem Paradigmenwechsel: Das positive Potenzial des Denkens wich einem pessimistischen Verständnis der sozialen Praxis.
Was bedeutet „instrumentelle Vernunft“?
Eine Form der Vernunft, die nur noch auf die Effizienz von Mitteln zur Erreichung beliebiger Zwecke ausgerichtet ist, statt normative Ziele zu hinterfragen.
- Quote paper
- Silke Piwko (Author), 2010, Denken und soziale Praxis – ein Vergleich der Ansätze in Horkheimers Aufsatz "Traditionelle und Kritische Theorie" sowie in Horkheimers / Adornos "Dialektik der Aufklärung" , Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/169178