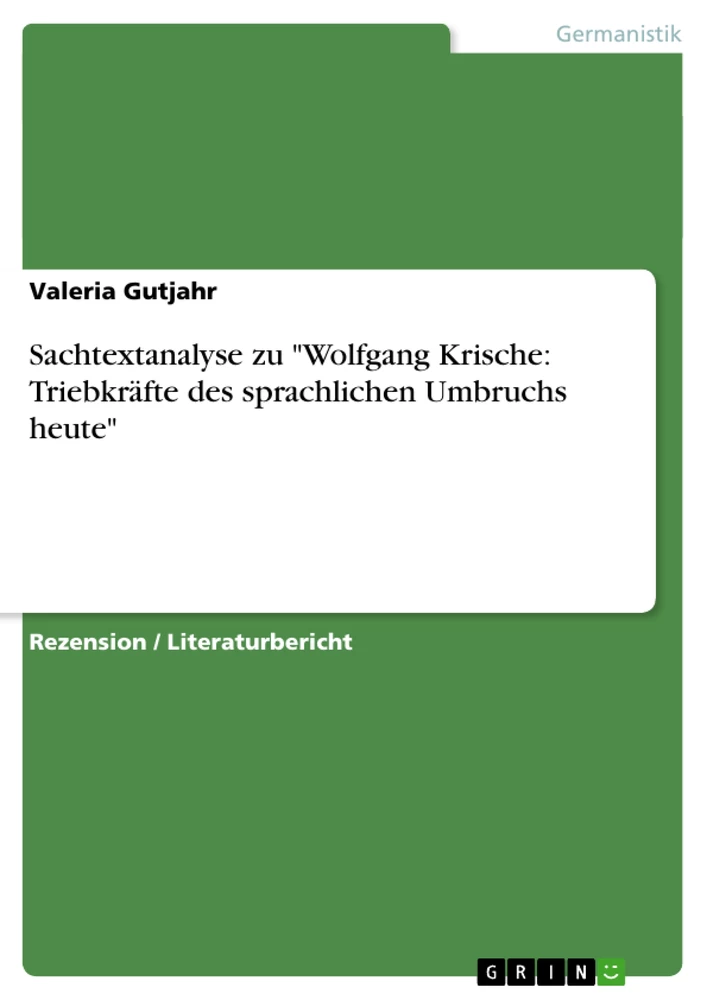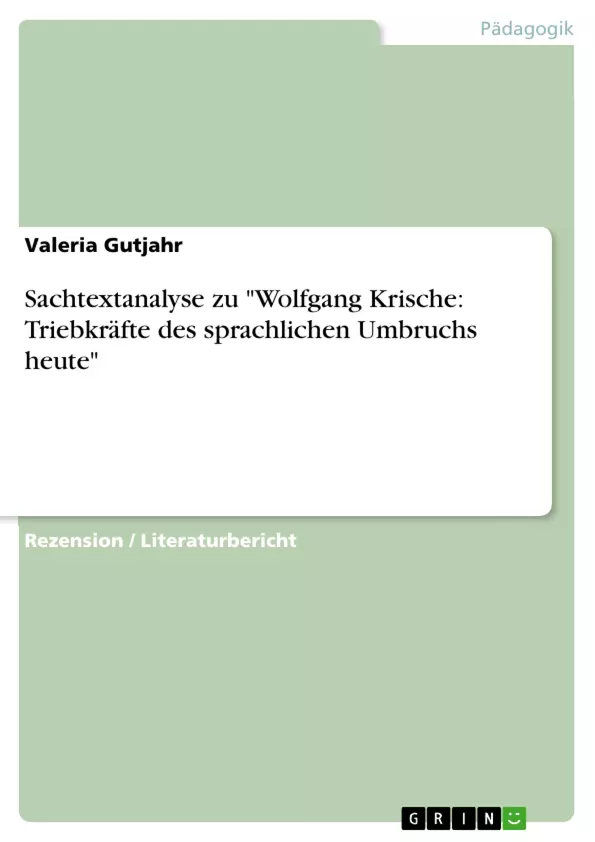Der Text „Triebkräfte des sprachlichen Umbruchs heute” von Wolfgang Krischke, veröffentlicht in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung Nr.197 vom 26.09.2009 befasst sich mit der Verfälschung der deutschen Hochsprache, ihren Ursachen und Auswirkungen.
Sein Leitgedanke stellt die zunehmende Migrationsrate und die damit verbundene Vermischung mit anderen Sprachen und die Simplifizierung unserer eigenen dar. Zudem befasst er sich kritisch mit der Einstellung Verantwortlicher gegenüber diesem Problem.
Krischke wendet sich dabei hauptsächlich an ein sprachinteressiertes Publikum, wie zum Beispiel Linguisten.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung: Der Exotismus Grammatischer Fehler
- Das Knirschen im Unterbau der Deutschen Sprache
- Sprachwandel und seine Ursachen
- Gehst du Schule?: Migration und Sprachumbruch
- Die Auswirkungen der "Kanak Sprak"
- Öffentliches Interesse am Sprachwandel
- Linguisten und Sprachkritik
- Hab ich krassen Sprachtrend!: Bewertung des Sprachwandels
- Die Kritik an Hinrichs und Berthele
- Vorschlag zur Sprachförderung
- Die Wurzeln der Deutschen Hochsprache
- Fazit: Hochsprache als Bildungsanstrengung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Der Text analysiert den sprachlichen Umbruch im Deutschen, seine Ursachen und Auswirkungen. Krischke hinterfragt kritisch die gesellschaftliche und wissenschaftliche Haltung gegenüber diesem Wandel.
- Verfälschung der deutschen Hochsprache
- Einfluss von Migration und Sprachmischung
- Rollen von Linguisten und Sprachkritikern
- Gesellschaftliche Akzeptanz von Sprachwandel
- Vorschläge zur Sprachförderung
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Der Exotismus Grammatischer Fehler: Der einleitende Abschnitt führt den Leser in die Problematik des sprachlichen Umbruchs ein. Krischke charakterisiert ihn als "Exotismus grammatischer Fehler" und kritisiert die gesellschaftliche Tendenz, die Forderung nach korrekter Ausdrucksweise als Diskriminierung von Unterschichten und Migranten zu interpretieren. Dies legt bereits seine kritische Haltung gegenüber der gängigen Meinung dar und bildet die Grundlage für die folgenden Analysen.
Das Knirschen im Unterbau der Deutschen Sprache: Mit der Metapher des "knirschenden Unterbaus" beschreibt Krischke die Instabilität der deutschen Grammatik. Er illustriert dies mit konkreten Beispielen von grammatikalischen Fehlern, die zunehmend akzeptiert werden. Der Abschnitt verdeutlicht die Erosion des grammatischen Systems und die damit verbundene Verfälschung der Hochsprache. Die Verwendung von Metaphern macht die komplexe Thematik für den Leser nachvollziehbar.
Sprachwandel und seine Ursachen: Krischke beleuchtet die Kontroverse um den Sprachwandel, wobei er journalistische Sprachkritiker und Sprachwissenschaftler gegenüberstellt. Er argumentiert, dass der Wandel sich beschleunigt und nennt als Ursachen den Einfluss des Englischen, neue Technologien und eine gesellschaftliche Akzeptanz von sprachlicher Lockerheit, die er kritisch betrachtet und als "Geschwätz der Talk- und Casting-Shows" bezeichnet. Der Abschnitt unterstreicht die vielschichtigen Gründe für den Sprachumbruch.
Gehst du Schule?: Migration und Sprachumbruch: Dieser Abschnitt fokussiert auf die Rolle der Migration im Sprachwandel. Krischke beruft sich auf den Sprachwissenschaftler Uwe Hinrichs, der die Sprachmischung immigrierter Bürger als Haupttreiber des Umbruchs identifiziert. Krischke beschreibt die Herausforderungen, die durch den bruchstückhaften Spracherwerb und die Mischung mit Muttersprachen entstehen. Er prognostiziert, dass diese Entwicklung weit über Migrantenmilieus hinausreichen wird.
Die Auswirkungen der "Kanak Sprak": Mit ironischer Verwendung des Begriffs "Kanak Sprak" warnt Krischke vor einer radikalen Vereinfachung des grammatischen Systems. Er untermauert seine Warnung mit Hinrichs Beobachtungen ähnlicher Entwicklungen in anderen Sprachen. Der Abschnitt hebt die potenziell weitreichenden Konsequenzen des Sprachwandels hervor und kritisiert die vermeintliche Ignoranz seiner "germanistischen Kollegen".
Öffentliches Interesse am Sprachwandel: Krischke lenkt den Fokus auf das öffentliche Interesse am Sprachwandel und die Frage nach den Auswirkungen auf die Hochsprache. Er betont das berechtigte Interesse der Öffentlichkeit an den Ursachen und Veränderungen der Sprache und regt damit den Leser zum Nachdenken an.
Linguisten und Sprachkritik: Dieser Abschnitt vergleicht die Positionen von Linguisten und publizistischen Sprachkritikern wie Bastian Sick. Krischke kritisiert die vermeintliche Bewertungsablehnung der Linguisten und positioniert sich implizit auf der Seite von Sick, indem er die Linguisten sarkastisch als "Linguistenzunft" bezeichnet.
Hab ich krassen Sprachtrend!: Bewertung des Sprachwandels: In diesem Abschnitt kritisiert Krischke die angebliche "Bewertungsablehnung" von Linguisten als Bewertung unter "vertauschten Maßstäben". Er prangert den Widerspruch an, dass neue Sprachtrends begrüßt, die Hochsprache aber gleichzeitig gemieden wird. Er kritisiert die Ansicht, die Hochsprache sei ein Instrument der Diskriminierung, während sie selbst von Linguisten verwendet wird.
Die Kritik an Hinrichs und Berthele: Hier wird die Kritik an Hinrichs und Berthele deutlich. Beide bevorzugen den restringierten Sprachgebrauch und sehen das Erlernen der Hochsprache als Unzumutbarkeit für Immigranten an. Krischke kontert diese Argumentation, indem er die praktischen Konsequenzen dieser Position und die vermeintliche Arroganz der Wissenschaftler herausstellt.
Vorschlag zur Sprachförderung: Krischke schlägt vor, die Hochsprache als Schwerpunkt der Sprachförderung zu etablieren und die verschiedenen Kommunikationswelten (Disko, SMS, Internet) in den Hintergrund zu rücken. Er betont die Wichtigkeit der Hochsprache als Kulturgut und die Rolle der Schule bei ihrem Erhalt.
Die Wurzeln der Deutschen Hochsprache: Krischke regt an, in der Schule die Geschichte der deutschen Hochsprache und deren Begründer aus der Aufklärung als positive Vorbilder zu thematisieren, um den Sprachwandel zu verlangsamen und sinnvoll zu kanalisieren. Er betont die Bedeutung der Fähigkeit, sich über anspruchsvolle Themen zu unterhalten und zu denken, nicht nur für Gebildete, sondern auch für bildungsferne Schichten.
Schlüsselwörter
Hochsprache, Sprachwandel, Migration, Sprachmischung, Linguistik, Sprachkritik, Sprachförderung, Hinrichs, Berthele, grammatischer Umbruch, Sprachstandardisierung, Kommunikationswelten.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu "Der Exotismus Grammatischer Fehler"
Was ist das zentrale Thema des Textes "Der Exotismus Grammatischer Fehler"?
Der Text analysiert den Sprachwandel im Deutschen, insbesondere den Einfluss von Migration und Sprachmischung auf die Hochsprache. Er kritisiert die gesellschaftliche und wissenschaftliche Akzeptanz von grammatikalischen Fehlern und plädiert für eine Stärkung der Hochsprache im Bildungssystem.
Welche Aspekte des Sprachwandels werden im Text behandelt?
Der Text beleuchtet verschiedene Aspekte des Sprachwandels, darunter die Ursachen (Einfluss des Englischen, neue Technologien, Migration), die Auswirkungen auf die deutsche Grammatik ("knirschender Unterbau"), die Rolle von Linguisten und Sprachkritikern, sowie die gesellschaftliche Akzeptanz des Wandels. Besondere Aufmerksamkeit wird der "Kanak Sprak" und deren potenziellen Konsequenzen gewidmet.
Welche Position vertritt der Autor gegenüber dem Sprachwandel?
Der Autor vertritt eine kritische Position gegenüber dem ungebremsten Sprachwandel und plädiert für den Erhalt und die Förderung der deutschen Hochsprache. Er kritisiert die vermeintliche Relativierung grammatikalischer Korrektheit und sieht darin eine Gefahr für die sprachliche Bildung.
Wer wird im Text kritisiert und warum?
Der Autor kritisiert insbesondere die Positionen von Linguisten wie Hinrichs und Berthele, die den Sprachwandel eher tolerieren und das Erlernen der Hochsprache als Unzumutbarkeit für Migranten ansehen. Er kritisiert auch die vermeintliche Bewertungsablehnung von Linguisten und den Widerspruch zwischen der Begrüßung neuer Sprachtrends und der gleichzeitigen Vermeidung der Hochsprache.
Welche konkreten Beispiele für Sprachwandel werden genannt?
Der Text nennt diverse Beispiele für grammatikalische Fehler, die zunehmend akzeptiert werden. Er bezieht sich auf Beobachtungen von Sprachwissenschaftlern und illustriert den Sprachwandel mit Beispielen aus verschiedenen Kommunikationsbereichen (Talk- und Casting-Shows, SMS, Internet).
Welche Vorschläge zur Sprachförderung macht der Autor?
Der Autor schlägt vor, die Hochsprache als Schwerpunkt der Sprachförderung zu etablieren und die Bedeutung der Hochsprache als Kulturgut zu betonen. Er empfiehlt, die Geschichte der deutschen Hochsprache im Unterricht zu thematisieren und die verschiedenen Kommunikationswelten (Disko, SMS, Internet) in den Hintergrund zu rücken.
Welche Rolle spielen Migration und Sprachmischung im Text?
Migration und Sprachmischung werden als wichtige Faktoren im Sprachwandel dargestellt. Der Autor analysiert den Einfluss von immigrierten Sprachen auf das Deutsche und diskutiert die Herausforderungen, die durch den bruchstückhaften Spracherwerb und die Sprachmischung entstehen. Er warnt vor einer radikalen Vereinfachung der Grammatik.
Wie werden Linguisten und Sprachkritiker im Text dargestellt?
Der Text stellt Linguisten und Sprachkritiker (wie Bastian Sick) einander gegenüber. Der Autor kritisiert die vermeintliche Bewertungsablehnung der Linguisten und positioniert sich implizit auf der Seite der Sprachkritiker, indem er die Linguisten sarkastisch als "Linguistenzunft" bezeichnet.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren den Text?
Schlüsselwörter sind: Hochsprache, Sprachwandel, Migration, Sprachmischung, Linguistik, Sprachkritik, Sprachförderung, Hinrichs, Berthele, grammatischer Umbruch, Sprachstandardisierung, Kommunikationswelten.
- Citation du texte
- Valeria Gutjahr (Auteur), 2011, Sachtextanalyse zu "Wolfgang Krische: Triebkräfte des sprachlichen Umbruchs heute", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/169271