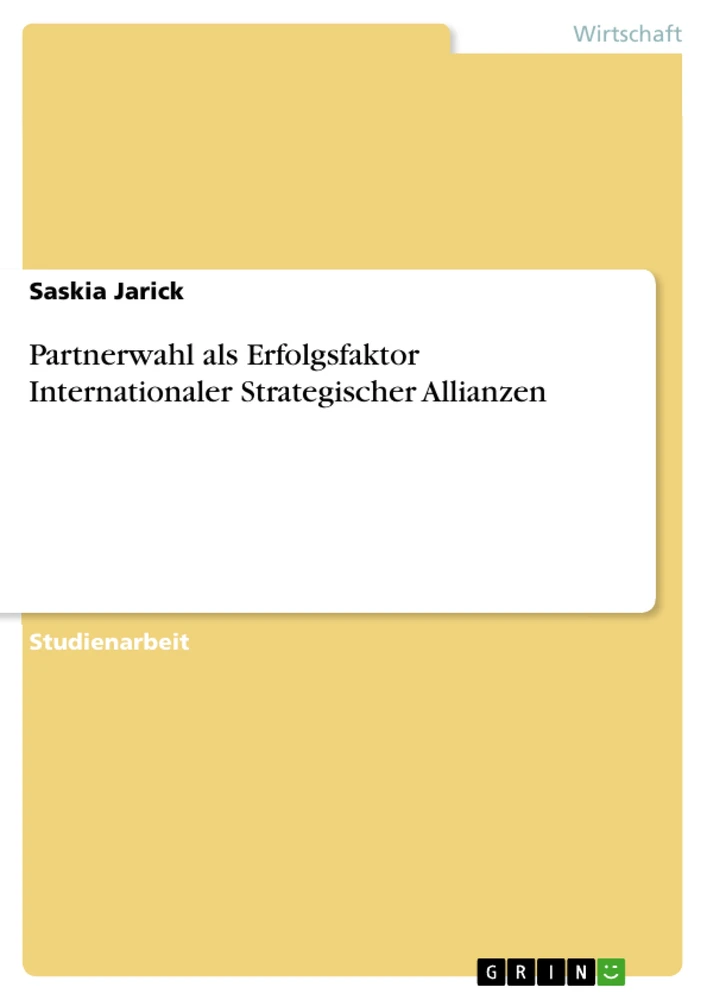Durch die Globalisierung und den technischen Fortschritt hat die internationale strategische Allianz, die in der Literatur erstmalig 1985 auftritt, immer mehr an Bedeutung gewonnen (Vgl. Fontanari 1995, 118). In einer Studie der Boston Consulting Group wird geschätzt, dass rund 30 % der globalen Unternehmensumsätze in 2005 direkt auf internationale strategische Allianzen zurückführbar waren. Im Jahre 1980 waren es lediglich 2 % (BCG 2006, 1).
Eine funktionierende strategische Allianz bietet den beteiligten Unternehmen die Möglichkeit, Ziele zu erreichen, die ohne diese Kooperation nur sehr schwer oder mit einem erheblich höheren Einsatz von Ressourcen erreichbar sind (Vgl. Wolf 2002, 12).
Studien zeigen jedoch, dass die Misserfolgs-Quote strategischer Allianzen sehr hoch ist. So sind nach einer Studie von McKinsey aus dem Jahr 1992 33 % aller strategischen Allianzen für beide Partner ein Misserfolg, einer Studie von Hirn/Krogh zufolge scheitert sogar jede zweite Allianz vorzeitig (Vgl. Fontanari 1995, 119).
Entschließt sich ein Unternehmen dazu, eine internationale strategische Allianz einzugehen, muss es sich mit den Faktoren beschäftigen, die für den Erfolg oder das Scheitern einer solchen Allianz verantwortlich sein können. Wesentlichen Einfluss auf den Ausgang einer solchen Kooperation hat die Partnerwahl, welche Hauptgegenstand dieser Arbeit ist. Gerade durch eine wohlüberlegte Wahl des Partners kann das Gelingen einer strategischen Allianz entscheidend beeinflusst werden (Raffée/Eisele 1994, 20 f.).
Doch auf welche Eigenschaften potenzieller Partner sollte besonderes Augenmerk gelegt werden? Diese Frage soll im Rahmen der vorliegenden Arbeit beantwortet werden.
Hierbei sollen auch die weichen Faktoren Vertrauen und Commitment berücksichtigt werden, da diese eng mit der Partnerwahl verknüpft sind. Ziel ist es herauszuarbeiten, welchen Einfluss diese Aspekte auf eine erfolgreiche internationale strategische Allianz haben.
Inhaltsverzeichnis
1 Einleitung
2 Begriffliche Grundlagen
2.1 Internationale Strategische Allianz
2.2 Motive für strategische Allianzen
2.3 Erfolg
2.4 Erfolgsfaktoren von strategischen Allianzen
2.5 Bedeutung der Partnerwahl als Erfolgsfaktor
3 Erfolgsfaktoren der Partnerwahl
3.1 Ähnlichkeit der Unternehmen
3.2 Kultur
3.2.1 Nationale Kultur
3.2.2 Unternehmenskultur
3.3 Kompatibilität und Komplementarität
3.4 Weitere Kriterien
4 Weiche Erfolgsfaktoren
4.1 Vertrauen
4.1.1 Rationales Vertrauen
4.1.2 Emotionales Vertrauen
4.1.3 Bedeutung von Vertrauen
4.2 Commitment
4.2.1 Rationales Commitment
4.2.2 Emotionales Commitment
4.2.3 Bedeutung von Commitment
5 Problembereiche der Erfolgsfaktorenforschung
6 Fazit
Literaturverzeichnis
Eidesstattliche Erklärung
Häufig gestellte Fragen
Was ist eine internationale strategische Allianz?
Es handelt sich um eine langfristige Zusammenarbeit zwischen Unternehmen aus verschiedenen Ländern, um gemeinsame Ziele zu erreichen, die allein schwer realisierbar wären, während die Partner rechtlich selbstständig bleiben.
Warum scheitern so viele strategische Allianzen?
Studien zeigen Misserfolgsquoten von 33 % bis 50 %. Häufige Gründe sind kulturelle Unterschiede, mangelndes Vertrauen, unklare Zielsetzungen oder eine falsche Partnerwahl.
Welche Rolle spielen Vertrauen und Commitment für den Erfolg?
Diese „weichen Faktoren“ sind essenziell. Vertrauen reduziert Kontrollkosten, während Commitment (Verpflichtung) sicherstellt, dass beide Partner auch in schwierigen Phasen an der Allianz festhalten.
Worauf sollte man bei der Partnerwahl besonders achten?
Wichtige Kriterien sind die Ähnlichkeit der Unternehmensgrößen, die Komplementarität der Ressourcen (Partner ergänzen sich) und die kulturelle Kompatibilität (nationale und Unternehmenskultur).
Was sind typische Motive für strategische Allianzen?
Motive sind der Zugang zu neuen Märkten, das Teilen von Forschungs- und Entwicklungskosten, Skaleneffekte sowie der Transfer von Know-how und Technologien.
- Arbeit zitieren
- Saskia Jarick (Autor:in), 2010, Partnerwahl als Erfolgsfaktor Internationaler Strategischer Allianzen, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/169305