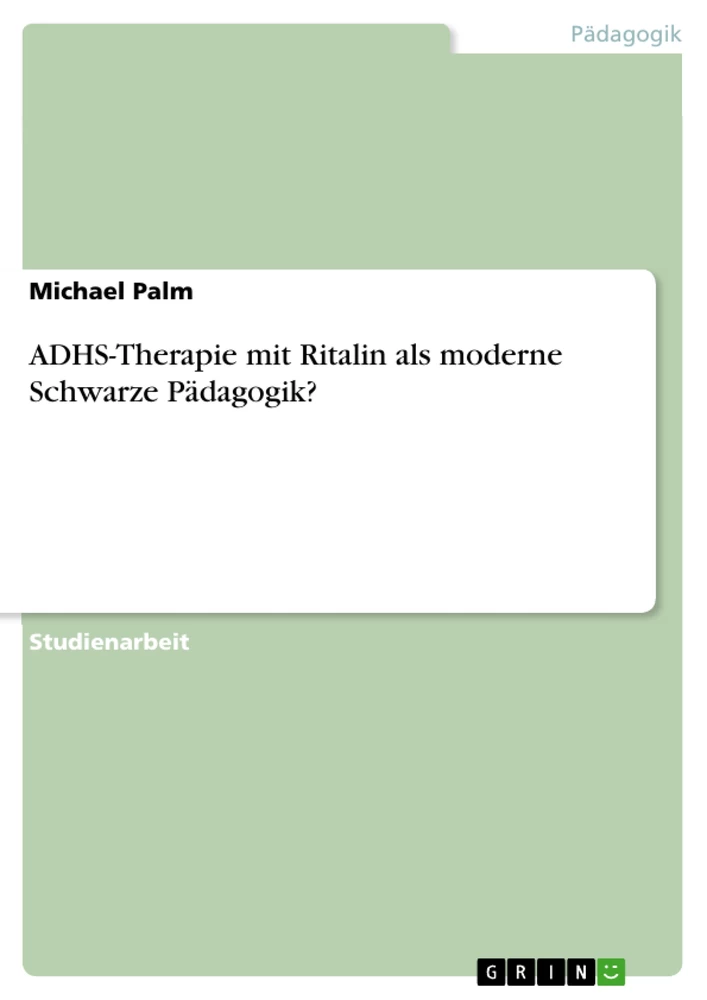In dieser Arbeit wird untersucht, inwiefern die Therapie des ADHS mit dem Medikament »Ritalin®« als moderne Schwarze Pädagogik verstanden werden kann.
Hierbei wird in einem ersten Schritt der Begriff der »Schwarzen Pädagogik« erläutert und versucht, seine Hauptmerkmale herausarbeiten. Anschließend wird der Begriff »ADHS« kurz vorgestellt, um dann näher darauf eingehen zu können, welche Wirkung »Ritalin®« auf Kinder hat und unter welchen Umständen es erhältlich ist. Im Kapitel »Interpretation« wird schließlich die Therapie des ADHS mittels Ritalin® und die Schwarze Pädagogik verglichen, um dann in einem »Fazit« das Ergebnis dieses Vergleichs zu präsentieren und ggf. auf weitere offene Fragen hinzuweisen. Bei alldem beschränkt sich diese Arbeit auf den aktuellen Stand in Deutschland (März 2011).
Inhaltsverzeichnis (Table of Contents)
- 1. Einleitung
- 2. Schwarze Pädagogik
- 3. ADHS
- 4. Ritalin
- 5. Interpretation
- 6. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte (Objectives and Key Themes)
Die Arbeit befasst sich mit der Frage, ob die Therapie des ADHS mit dem Medikament Ritalin® als moderne Schwarze Pädagogik verstanden werden kann. Der Autor untersucht dazu den Begriff der Schwarzen Pädagogik, stellt das ADHS kurz vor und geht auf die Wirkung von Ritalin® auf Kinder ein. Im Mittelpunkt steht ein Vergleich der Therapierung des ADHS mittels Ritalin® und der Schwarzen Pädagogik. Die Arbeit konzentriert sich auf die Situation in Deutschland.
- Definition und Merkmale der Schwarzen Pädagogik
- Charakterisierung des ADHS und der Wirkung von Ritalin®
- Vergleich der Therapierung des ADHS mittels Ritalin® mit der Schwarzen Pädagogik
- Ethik und Moral in der Anwendung von Medikamenten zur Verhaltensbeeinflussung
- Die Rolle der Selbstdisziplin und der Autonomieentwicklung im Kontext der Pädagogik
Zusammenfassung der Kapitel (Chapter Summaries)
- Einleitung: Die Arbeit stellt die Forschungsfrage und skizziert die Vorgehensweise. Der Autor kündigt an, den Begriff der Schwarzen Pädagogik zu erläutern, das ADHS vorzustellen, die Wirkung von Ritalin® zu beleuchten und schließlich einen Vergleich zwischen der Therapierung des ADHS mittels Ritalin® und der Schwarzen Pädagogik durchzuführen.
- Schwarze Pädagogik: Dieser Abschnitt definiert den Begriff der Schwarzen Pädagogik und beleuchtet die wichtigsten Merkmale. Er greift die Interpretationen von Katharina Rutschky, Alice Miller und Werner Sesink auf, die verschiedene Facetten der Schwarzen Pädagogik herausarbeiten, wie z.B. die Unterdrückung des kindlichen Willens, die Unterordnung unter die Autorität des Erziehers und die Anwendung von Gewalt und Manipulation.
Schlüsselwörter (Keywords)
Die Arbeit befasst sich mit den Themen Schwarze Pädagogik, ADHS, Ritalin®, Medikamententherapie, Verhaltensbeeinflussung, Autonomie, Selbstdisziplin, Ethik, Moral und Pädagogik. Sie analysiert, inwiefern die Verwendung von Ritalin® zur Behandlung von ADHS mit den Prinzipien der Schwarzen Pädagogik in Verbindung gebracht werden kann. Die Arbeit untersucht die Auswirkungen der Medikamenteneinnahme auf Kinder und hinterfragt die ethischen und moralischen Aspekte der Verhaltensbeeinflussung durch Medikamente.
Häufig gestellte Fragen
Was ist "Schwarze Pädagogik"?
Schwarze Pädagogik bezeichnet Erziehungsmethoden, die auf Unterdrückung des kindlichen Willens, Autorität, Manipulation und oft auch Gewalt basieren.
Ist die Ritalin-Therapie eine Form von Schwarzer Pädagogik?
Die Arbeit untersucht kritisch, ob die medikamentöse Ruhigstellung von Kindern mit ADHS Parallelen zur Willensunterdrückung der Schwarzen Pädagogik aufweist.
Wie wirkt Ritalin bei ADHS?
Ritalin beeinflusst den Botenstoffwechsel im Gehirn, um Konzentration zu steigern und Hyperaktivität zu mindern, was jedoch ethisch umstritten ist.
Welche ethischen Fragen wirft die Medikation auf?
Es wird hinterfragt, inwieweit Medikamente zur Verhaltensanpassung die Autonomieentwicklung und Selbstdisziplin des Kindes beeinträchtigen.
Welche Autoren prägten den Begriff der Schwarzen Pädagogik?
Wichtige Interpretationen stammen von Katharina Rutschky und Alice Miller, die die zerstörerischen Aspekte dieser Erziehung analysierten.
- Quote paper
- Michael Palm (Author), 2011, ADHS-Therapie mit Ritalin als moderne Schwarze Pädagogik?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/169354