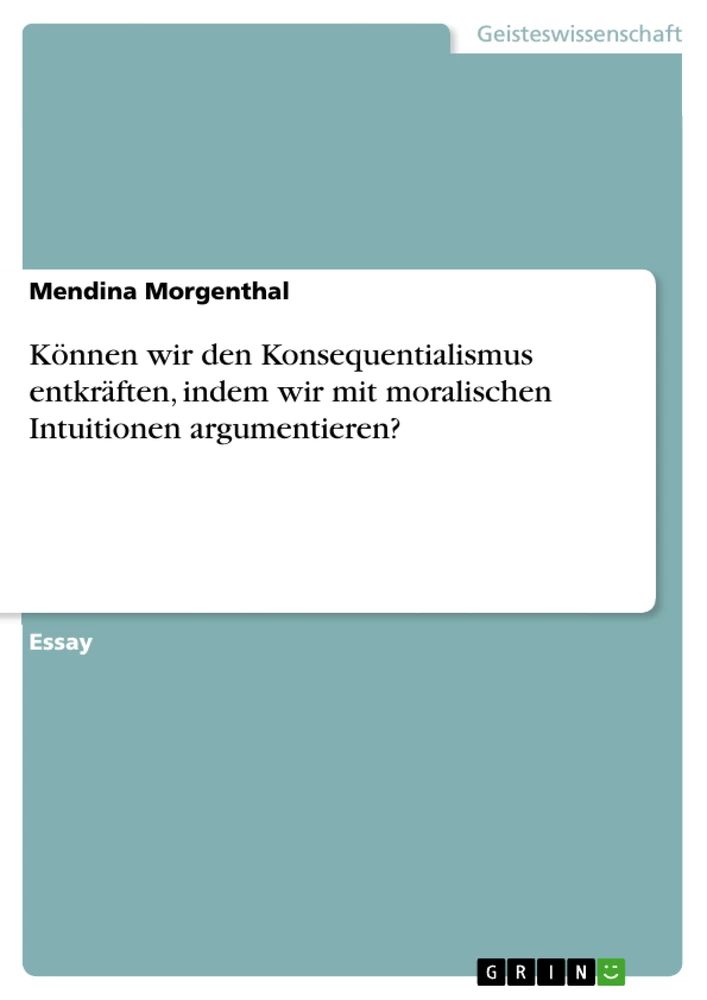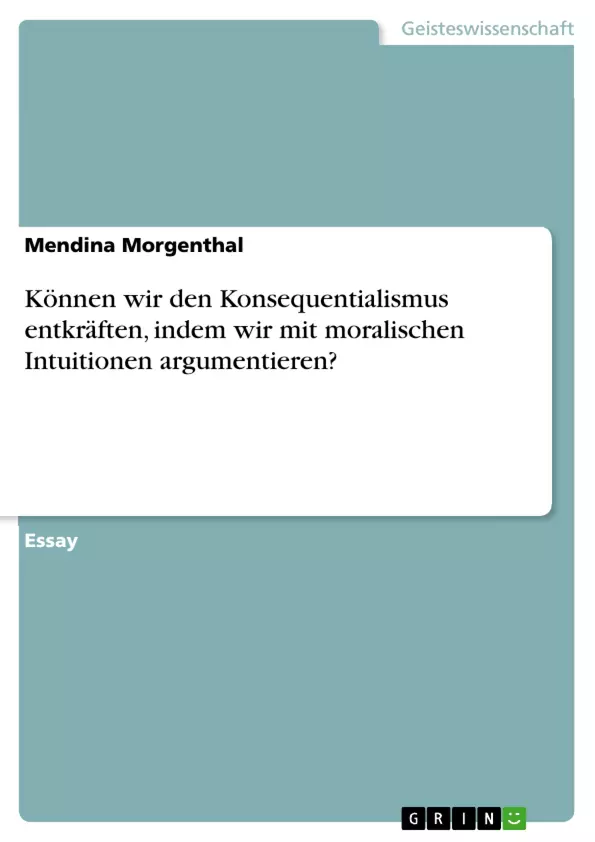Die Frage nach dem richtigen Handeln beschäftigt bis heute verschiedene moralphilosophische Lager. Sollen Handlungen moralischen Geboten folgen? Wenn ja, wer legt diese fest, was wären die richtigen moralischen Gebote? Oder sollten unsere Handlungen danach beurteilt werden, welche Folgen sie nach sich ziehen? Welche Folgen sind gut, welche schlecht? Hier handelt es sich um einige Beispiele aus dem Fragenkatalog moralphilosophischer Fragestellungen. An dieser Stelle möchte ich eben diese Fragen kurz aus der Perspektive eines Konsequentialistischen Moralkonzeptes betrachten.
Ob nun eine Handlung richtig oder falsch ist, hängt ausschließlich von ihren Konsequenzen ab. Wenn wir vor der Entscheidung stehen, welche Handlung wir in einer bestimmten Situation ausführen sollten, werden wir mit verschiedenen Handlungsalternativen konfrontiert. Wir müssen diese Handlungsalternativen also miteinander vergleichen. Als Vergleichsaspekt dient uns die jeweils berechnete Konsequenz jeder Handlung. Allgemein können wir hier vorerst festlegen, dass diejenige Handlung, die gute Konsequenzen nach sich zieht, derjenigen, die schlechte Konsequenzen nach sich zieht, vorzuziehen ist.
Inhaltsverzeichnis
- Sklaverei als Standbein einer glücklichen Gesellschaft
- Können wir den Konsequentialismus entkräften, indem wir mit moralischen Intuitionen argumentieren?
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Frage, ob Handlungen moralischen Geboten folgen sollten oder ob ihre Folgen ausschlaggebend für ihre Beurteilung sind. Dabei werden die Prinzipien des Konsequentialismus und seine Anwendung auf ein fiktives Beispiel der Sklaverei diskutiert.
- Konsequentialismus als moralphilosophisches Konzept
- Bewertung von Handlungsalternativen anhand ihrer Konsequenzen
- Kritik am Konsequentialismus anhand von moralischen Intuitionen
- Die Rolle des Gesamtnutzens und der individuellen Freiheit
- Das Problem der Willkürlichkeit in moralischen Intuitionen
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel erläutert die Grundprinzipien des Konsequentialismus und stellt die Frage nach der Bewertung von "guten" und "schlechten" Konsequenzen. Das zweite Kapitel analysiert ein fiktives Beispiel, in dem Sklaverei auf einer Insel den Gesamtnutzen maximiert, aber gleichzeitig die individuelle Freiheit der Sklaven einschränkt. Das dritte Kapitel setzt sich mit der Kritik am Konsequentialismus auseinander, die aus moralischen Intuitionen und der Verletzung der Menschenwürde resultiert. Abschließend wird die Frage aufgeworfen, ob die Willkürlichkeit unseres moralischen Alltagsverständnisses es uns erlaubt, den Konsequentialismus zu verurteilen.
Schlüsselwörter
Konsequentialismus, Moral, Ethik, Handlungsfolgen, Gesamtnutzen, Sklaverei, Menschenwürde, Freiheit, moralische Intuitionen, Willkürlichkeit.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Grundgedanke des Konsequentialismus?
Die moralische Richtigkeit einer Handlung hängt ausschließlich von ihren Folgen ab; die Handlung mit den besten Konsequenzen ist vorzuziehen.
Wie werden moralische Intuitionen gegen den Konsequentialismus genutzt?
Kritiker argumentieren, dass der Konsequentialismus Handlungen rechtfertigen könnte (z.B. Sklaverei), die unseren tiefsten moralischen Überzeugungen und der Menschenwürde widersprechen.
Was ist das Problem der Nutzenmaximierung?
Wenn nur der Gesamtnutzen zählt, könnten die Rechte oder die Freiheit einzelner Individuen für das Wohl der Mehrheit geopfert werden.
Sind moralische Intuitionen zuverlässig?
Die Arbeit hinterfragt, ob unser Alltagsverständnis von Moral nicht zu willkürlich ist, um als fundiertes Gegenargument zu einer rationalen Ethik wie dem Konsequentialismus zu dienen.
Was ist der Unterschied zwischen deontologischer Ethik und Konsequentialismus?
Deontologische Ethik bewertet Handlungen nach Regeln oder Geboten, während der Konsequentialismus nur auf das Ergebnis schaut.
- Quote paper
- Mendina Morgenthal (Author), 2009, Können wir den Konsequentialismus entkräften, indem wir mit moralischen Intuitionen argumentieren?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/169443