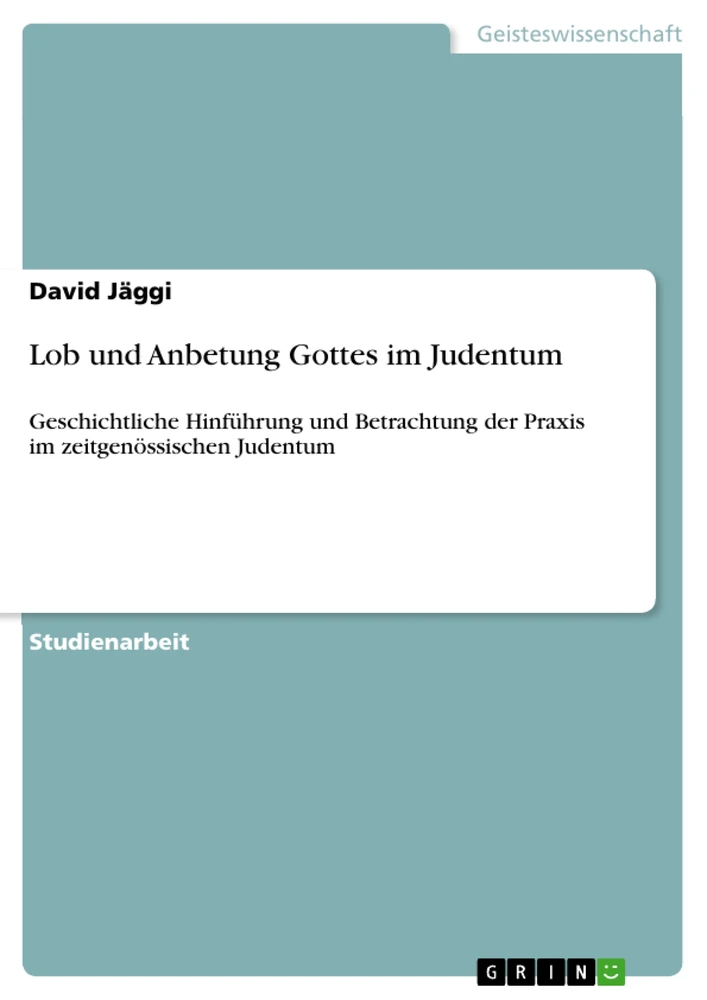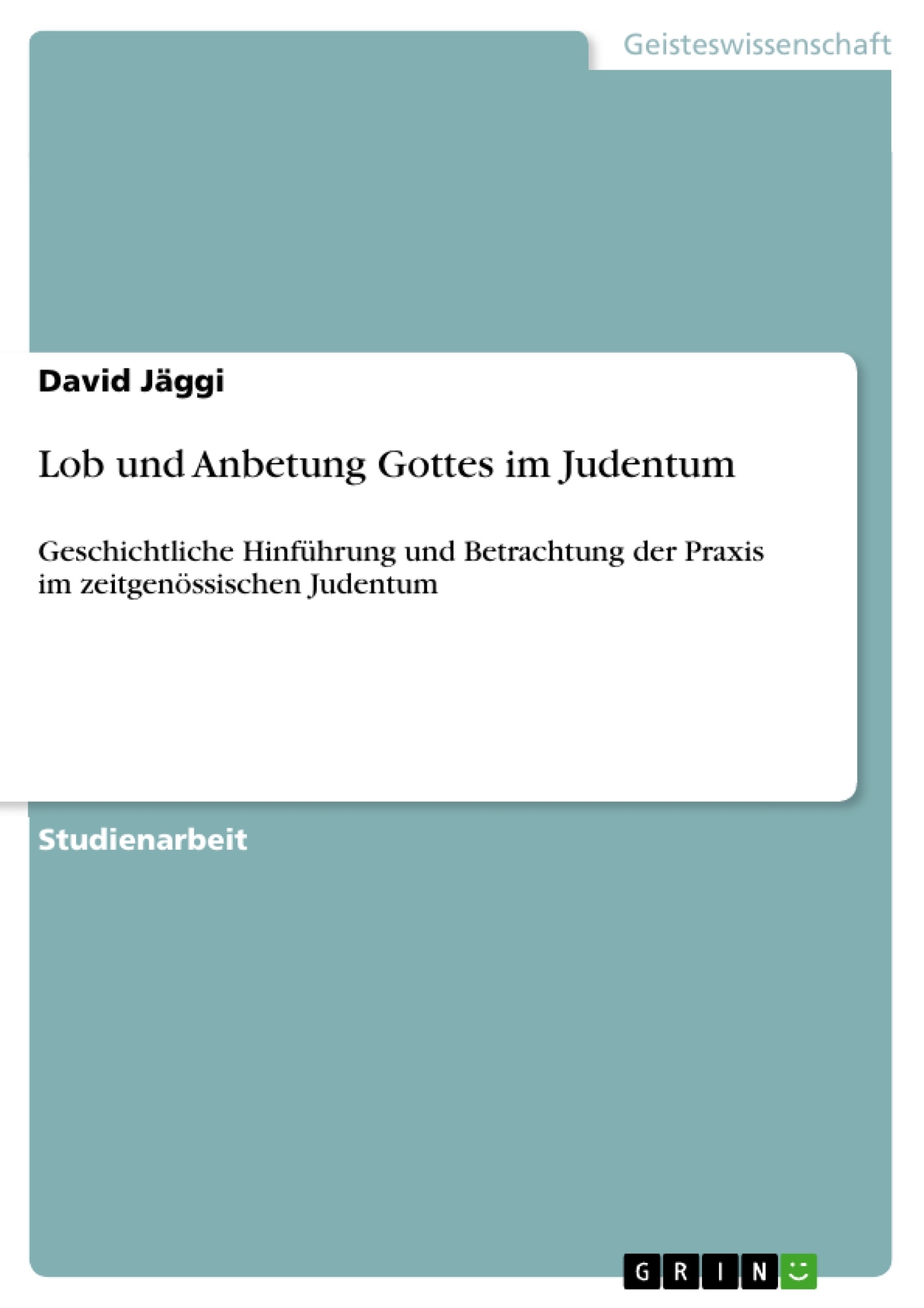Wird im Christentum über Menschen jüdischen Glaubens gesprochen, so folgt unweigerlich eine gewisse Assoziation mit Gesetzlichkeit und starrer Religiosität. Die Thora, auf welcher der jüdische Glaube gründet, wird als „… ein ‚tötendes Gesetz„ betrachtet, von dem der Christ durch Jesus befreit worden ist.“ Selten wird beachtet, dass für einen Juden das Gesetz im Dienst des Lebens steht und gerade im Judentum eine sehr hohe Gottesfurcht4 und auch eine grosse Gottesliebe vorhanden ist, welche seinesgleichen sucht. Das Loben von Gott als Schöpfer, Herr und Liebender seines Volkes Israel ist auch im modernen Judentum immer noch ein zentrales Thema. In freikirchlichen - christlichen Gemeinden wird dem Lob Gottes vor allem durch das Singen von Liedern Ausdruck verliehen. Dabei bedient man sich den Möglichkeiten und Ausdrucksformen der modernen Musik und drückt in den Liedtexten die Beziehung zwischen Gott und Geschöpf
aus. Diese Form des Lobpreises Gottes geht auf die Neuordnungen des levitischen Dienstes in der 1. Chronik durch König David zurück. Er hat sich geisterfüllte und fachlich gute Musiker ausgesucht, welche Tag und Nacht Gott im Tempel mit ihren Liedern angebetet und
besungen haben.
Nun haben wir im christlichen Glauben mit den Juden zusammen die gemeinsame Grundlage des Pentateuch, der Schriften und der Propheten. Während die Christen in der Bibel das Alte Testament und das Neue Testament haben, so gründet der Glaube der Juden auf dem Tenach.
Wie bereits Paulus in Römer 11 zum Ausdruck bringt, haben wir als Christen dieselben Wurzeln wie die Juden. Dazu Dwight Pryor: „Unser Leben wurzelt in der Bewegung des jüdischen Rabbi Jeschua auf der Grundlage jüdischer Schriften, einem jüdischen Boden.“ Die Christen sind aber aufgepfropfte Zweige und dürfen der Fettigkeit und der Wurzel des edlen Ölbaumes aus Gnade teilhaftig werden. In vorliegender Arbeit soll dargestellt werden, wie sich das Gotteslob im Judentum aus dieser gemeinsamen Grundlage heraus bis in die heutige Zeit entwickelte und welchen Stellenwert das Loben des Schöpfers für den gläubigen Juden von heute inne hat. Zum Ende der Arbeit schliesslich soll in Kürze dargestellt werden, wie der Christ seine Praxis vom Gotteslob durch die gewonnenen Erkenntnisse erweitern kann.
Inhaltsverzeichnis
- EINLEITUNG
- LOB UND ANBETUNG GOTTES IM TENACH
- Durch Opfer
- Durch Gebet
- Durch Gesang und Musik
- LOB UND ANBETUNG GOTTES NACH DER ZERSTÖRUNG DES ZWEITEN TEMPELS
- LOB UND ANBETUNG GOTTES IM HEUTIGEN JUDENTUM
- Studium der Thora und der Schriften als Lob Gottes
- Gebet als Lob Gottes
- FAZIT
- ANHANG: EXKURS „MESSIANISCHER LOBPREIS“
- Lobpreismusik von / für messianische(n) Juden
- Lobpreismusik mit „Messianismus“ als Inhalt
- Zusammenfassung
- BIBLIOGRAPHIE
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Entwicklung des Gotteslobs im Judentum vom biblischen Israel bis in die heutige Zeit. Sie untersucht, wie sich die Praxis der Anbetung und das Verständnis von Lob Gottes im Laufe der Geschichte und im Wandel der kulturellen Umstände gewandelt haben. Dabei wird besonders auf die Praxis des Gotteslobs im modernen Judentum eingegangen.
- Das Gotteslob im Judentum im Kontext des Tenach
- Die Veränderungen der Praxis des Gotteslobs nach der Zerstörung des Zweiten Tempels
- Das Gotteslob im heutigen Judentum, insbesondere die Bedeutung des Thora-Studiums und des Gebets
- Der Stellenwert des Gotteslobs im Leben des gläubigen Juden
- Ein Exkurs zum Begriff „Messianischer Lobpreis“
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt das Thema der Arbeit vor und erläutert den Stellenwert des Gotteslobs im Judentum, insbesondere in Verbindung mit dem Verständnis von Gesetz und Gottesfurcht.
Kapitel 2 beleuchtet die Praxis des Gotteslobs im Tenach und geht dabei auf die drei zentralen Aspekte „Opfer“, „Gebet“ und „Gesang und Musik“ ein. Die Bedeutung der Opfer als Ausdruck von Liebe und Dankbarkeit gegenüber Gott wird dargestellt, sowie die Entwicklung des Opferkults von individuellen Darbringungen zur institutionalisierten Praxis im Tempel.
Kapitel 3 behandelt die Veränderungen der Gotteslobpraxis nach der Zerstörung des Zweiten Tempels. Es wird untersucht, wie das Gotteslob im Judentum nach dem Verlust des zentralen Kultortes neu definiert wurde und welche neuen Formen der Anbetung entstanden.
Kapitel 4 befasst sich mit dem Gotteslob im heutigen Judentum. Es werden die zentrale Rolle des Thora-Studiums als Ausdruck des Lobegeistes und die Bedeutung des Gebets in der jüdischen Gottesverehrung erörtert.
Schlüsselwörter
Gotteslob, Judentum, Tenach, Thora, Gebet, Gesang und Musik, Opferkult, Tempel, Messianischer Lobpreis, Tradition, Moderne.
- Quote paper
- David Jäggi (Author), 2010, Lob und Anbetung Gottes im Judentum, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/169447