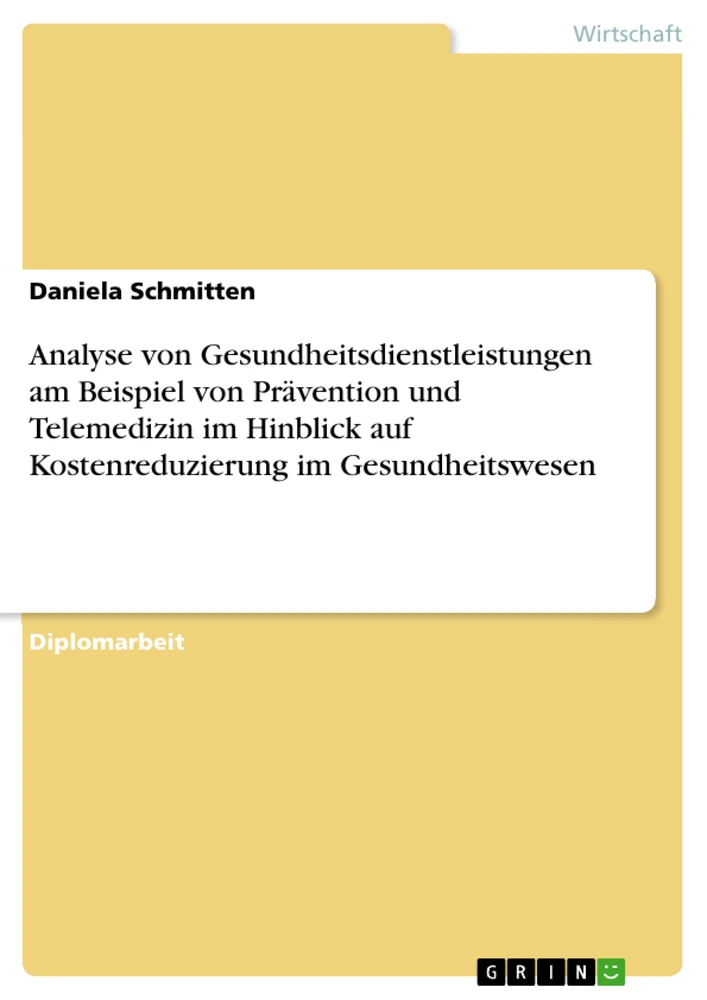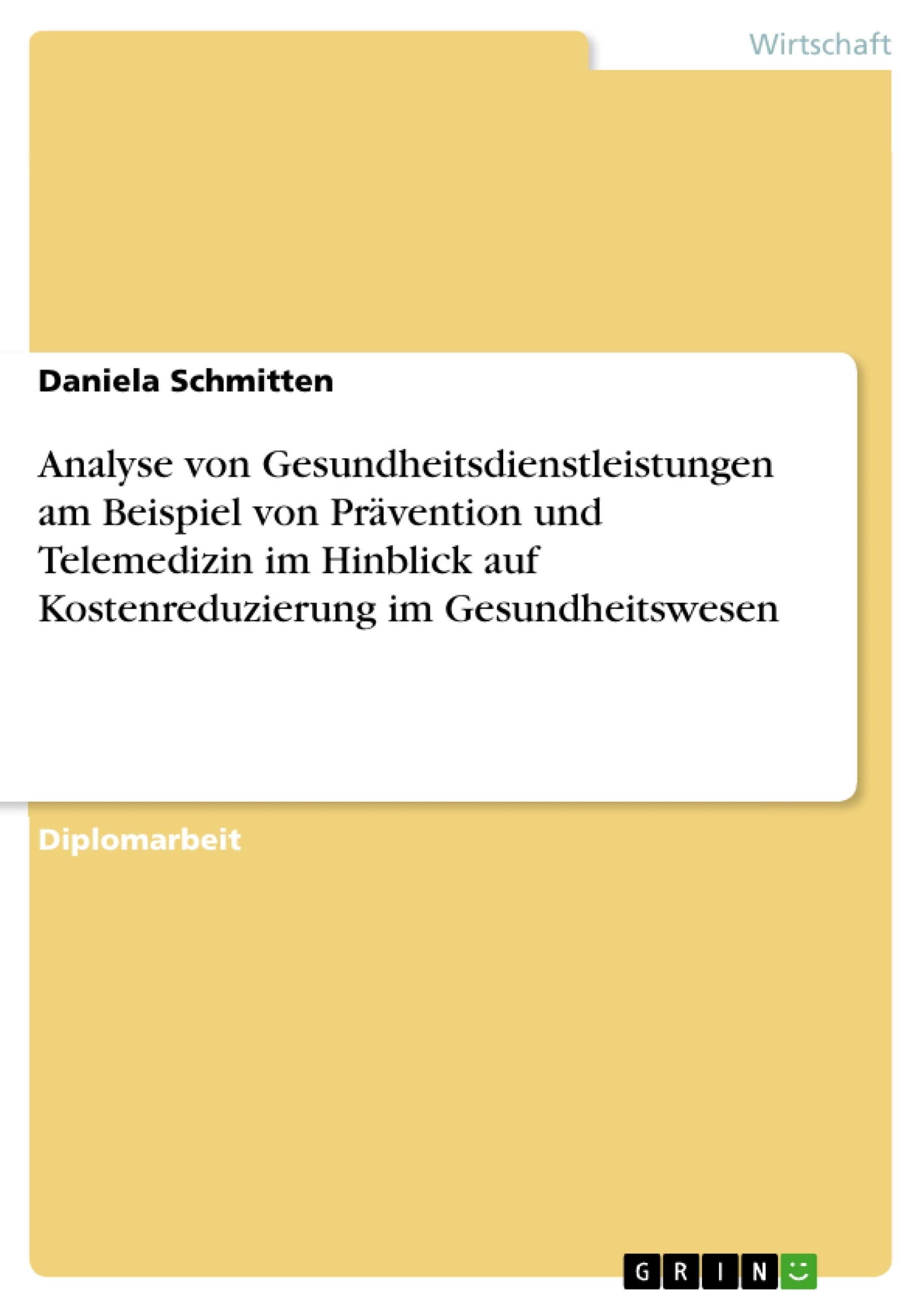Das Gesundheitssystem ist einer der größten Wirtschaftsbereiche in Deutschland. Immer wieder rücken Fragen des Gesundheitswesens in den Focus wirtschaftspolitischer Auseinandersetzungen. Der Lebensverlängerungsprozess ist ein Grundmechanismus des demografischen Wandels und fordert unsere volle Aufmerksamkeit. Auf der einen Seite bereichern immer älter werdende Menschen unsere Gesellschaft mit Erfahrung und ihrem Engagement. Andererseits verursachen sie höhere Gesundheitsausgaben durch Vermehrung von chronischen Leiden, psychischen Erkrankungen und vermehrter Pflegebedürftigkeit. Dies wirft einige Fragen auf: Ab welchem Lebensalter beginnen die kostenintensiven Krankheiten? Ist eine Eingrenzung möglich? Oder sind es überhaupt nicht die „Alten“, sondern beginnt der Erkrankungsprozess schon viel früher und betrifft auch jüngere Menschen in unserer Gesellschaft?
Neben der medizinischen Versorgung sollen vorrangig Präventions- und Rehabilitationsmaßnahmen helfen, die Lebensqualität zu verbessern und die Kosten des Gesundheitssystems langfristig zu senken. Hier kristallisiert sich ein wichtiges Problem heraus: die effiziente Verteilung der Ressourcen für Gesundheitsdienstleistungen. Die Kosten zur Erhaltung und Wiederherstellung von Gesundheit sollen möglichst gering gehalten werden. Anhand von Analysen werden nur Schätzwerte erreicht, da nicht erforderliche Folgekosten für die medizinische Versorgung entfallen.
Die vorliegende Arbeit ist zweiteilig gegliedert. Im theoretischen Teil wird die Prävention vom Verfasser eingehend betrachtet. Der zweite Teil widmet sich der praktischen Umsetzung der noch weitgehend unbekannten Telemedizin. Die wichtigsten Begriffsdefinitionen werden hierbei in den jeweiligen Gliederungsteilen aufgeführt. Das Ziel ist es, unter dem Gesundheitsaspekt insbesondere die Prävention als auch die Telemedizin eingehend zu analysieren, um deren Wichtigkeit im Hinblick auf die Kostenreduzierung hervorzuheben.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 1.1 Ausgangssituation
- 1.2 Problemstellung
- 1.3 Aufbau und Zielsetzung
- 2 Begriffsbestimmung
- 2.1 Gesundheit
- 2.2 Gesundheitsdienstleistungen
- 2.2.1 Begriffsbestimmung
- 2.2.2 Arten der Gesundheitsdienstleistungen
- 2.3 Gesundheitsziele
- 2.3.1 Begriffsbestimmung
- 2.3.2 Erreichbarkeit von Gesundheitszielen
- 3 Prävention
- 3.1 Begriffsbestimmung
- 3.1.1 Zielbedingte Arten der Prävention
- 3.1.2 Weitere Arten der Prävention
- 3.2 Effizienz im Gesundheitswesen
- 3.3 Möglichkeiten der Kostenentlastungen
- 3.4 Kosten der GKV für Maßnahmen zur Verhaltensprävention
- 3.5 Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit (IQWIG)
- 3.1 Begriffsbestimmung
- 4 Telemedizin
- 4.1 Begriffsbestimmung
- 4.2 Arten der Telemedizin
- 4.3 Telematik im Gesundheitswesen
- 4.4 Ziele der Telemedizin
- 4.5 Elektronische Gesundheitskarte
- 4.5.1 Anwendungsmöglichkeiten für Versicherte
- 4.5.2 Sicherheit
- 5 Telemedizinische Projekte in der Anwendung
- 6 Zusammenfassung und Ausblick
- 6.1 Zusammenfassung der Telemedizin
- 6.2 Zusammenfassung der Prävention
- 6.3 Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert Gesundheitsdienstleistungen, insbesondere Prävention und Telemedizin, im Hinblick auf die Kostenreduzierung im Gesundheitswesen. Ziel ist es, die Potentiale beider Bereiche zur Kostenoptimierung aufzuzeigen und kritisch zu beleuchten.
- Kostenreduktion im Gesundheitswesen
- Präventionsmaßnahmen und deren Effektivität
- Telemedizinische Anwendungen und deren Nutzen
- Analyse der Wirtschaftlichkeit von Gesundheitsdienstleistungen
- Potenziale und Herausforderungen von Prävention und Telemedizin
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Dieses Kapitel führt in die Thematik der Kostenreduzierung im Gesundheitswesen ein und beschreibt die Ausgangssituation sowie die Problemstellung. Es wird die Relevanz der Analyse von Prävention und Telemedizin im Kontext von Kostenoptimierung hervorgehoben und der Aufbau der Arbeit skizziert.
2 Begriffsbestimmung: Der zweite Abschnitt legt die grundlegenden Begriffe fest, die für das Verständnis der Arbeit essentiell sind. Hier werden "Gesundheit", "Gesundheitsdienstleistungen" und "Gesundheitsziele" definiert und eingegrenzt. Diese Definitionen bilden die Basis für die spätere Analyse von Prävention und Telemedizin.
3 Prävention: Dieses Kapitel widmet sich ausführlich dem Thema Prävention. Es werden verschiedene Arten der Prävention definiert und deren Effizienz im Gesundheitswesen beleuchtet. Ein Schwerpunkt liegt auf Möglichkeiten der Kostenentlastung durch präventive Maßnahmen. Die Rolle des Instituts für Qualität und Wirtschaftlichkeit (IQWIG) wird ebenfalls betrachtet.
4 Telemedizin: Das Kapitel über Telemedizin beschreibt zunächst den Begriff und die verschiedenen Arten der Telemedizin. Die Rolle der Telematik im Gesundheitswesen wird erläutert, und die Ziele der Telemedizin werden definiert. Ein besonderer Fokus liegt auf der elektronischen Gesundheitskarte und deren Anwendungsmöglichkeiten sowie Sicherheitsaspekten.
5 Telemedizinische Projekte in der Anwendung: Dieses Kapitel bietet einen Überblick über konkrete Beispiele für telemedizinische Projekte und deren Implementierung in der Praxis. Es wird die Anwendung und der Nutzen dieser Projekte im Gesundheitswesen beleuchtet.
Schlüsselwörter
Kostenreduzierung, Gesundheitswesen, Prävention, Telemedizin, Gesundheitsdienstleistungen, Effizienz, Wirtschaftlichkeit, Gesundheitsziele, Elektronische Gesundheitskarte, Telematik, Kostenentlastung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Analyse von Prävention und Telemedizin zur Kostenreduzierung im Gesundheitswesen
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert Gesundheitsdienstleistungen, insbesondere Prävention und Telemedizin, im Hinblick auf die Kostenreduzierung im Gesundheitswesen. Ziel ist es, die Potentiale beider Bereiche zur Kostenoptimierung aufzuzeigen und kritisch zu beleuchten.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themenschwerpunkte: Kostenreduktion im Gesundheitswesen, Präventionsmaßnahmen und deren Effektivität, telemedizinische Anwendungen und deren Nutzen, Analyse der Wirtschaftlichkeit von Gesundheitsdienstleistungen sowie Potenziale und Herausforderungen von Prävention und Telemedizin.
Wie ist die Arbeit aufgebaut?
Die Arbeit gliedert sich in sechs Kapitel: Einleitung (Ausgangssituation, Problemstellung, Zielsetzung), Begriffsbestimmung (Gesundheit, Gesundheitsdienstleistungen, Gesundheitsziele), Prävention (verschiedene Arten, Effizienz, Kostenentlastung, IQWIG), Telemedizin (Begriff, Arten, Telematik, Ziele, elektronische Gesundheitskarte), Telemedizinische Projekte in der Anwendung und Zusammenfassung und Ausblick (Zusammenfassung der Telemedizin und Prävention, Ausblick).
Was wird unter Prävention verstanden?
Das Kapitel Prävention definiert verschiedene Arten von Präventionsmaßnahmen, beleuchtet deren Effizienz im Gesundheitswesen und untersucht Möglichkeiten der Kostenentlastung durch präventive Maßnahmen. Die Rolle des Instituts für Qualität und Wirtschaftlichkeit (IQWIG) wird ebenfalls betrachtet.
Was wird unter Telemedizin verstanden?
Das Kapitel Telemedizin beschreibt den Begriff und verschiedene Arten der Telemedizin. Es erläutert die Rolle der Telematik im Gesundheitswesen, definiert die Ziele der Telemedizin und legt einen besonderen Fokus auf die elektronische Gesundheitskarte, deren Anwendungsmöglichkeiten und Sicherheitsaspekte.
Welche konkreten Beispiele für Telemedizin werden genannt?
Kapitel 5 bietet einen Überblick über konkrete Beispiele für telemedizinische Projekte und deren Implementierung in der Praxis. Es wird die Anwendung und der Nutzen dieser Projekte im Gesundheitswesen beleuchtet. Leider werden in diesem FAQ-Auszug keine konkreten Projektbeispiele genannt, da der bereitgestellte Text keine Details hierzu enthält.
Welche Schlüsselbegriffe sind relevant?
Wichtige Schlüsselbegriffe sind: Kostenreduzierung, Gesundheitswesen, Prävention, Telemedizin, Gesundheitsdienstleistungen, Effizienz, Wirtschaftlichkeit, Gesundheitsziele, Elektronische Gesundheitskarte, Telematik und Kostenentlastung.
Welche Ziele werden mit der Arbeit verfolgt?
Die Arbeit zielt darauf ab, das Potential von Prävention und Telemedizin zur Kostenoptimierung im Gesundheitswesen aufzuzeigen und kritisch zu bewerten. Es soll ein umfassendes Verständnis der beiden Bereiche und deren wirtschaftlichen Aspekte vermittelt werden.
- Arbeit zitieren
- Daniela Schmitten (Autor:in), 2008, Analyse von Gesundheitsdienstleistungen am Beispiel von Prävention und Telemedizin im Hinblick auf Kostenreduzierung im Gesundheitswesen, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/169457