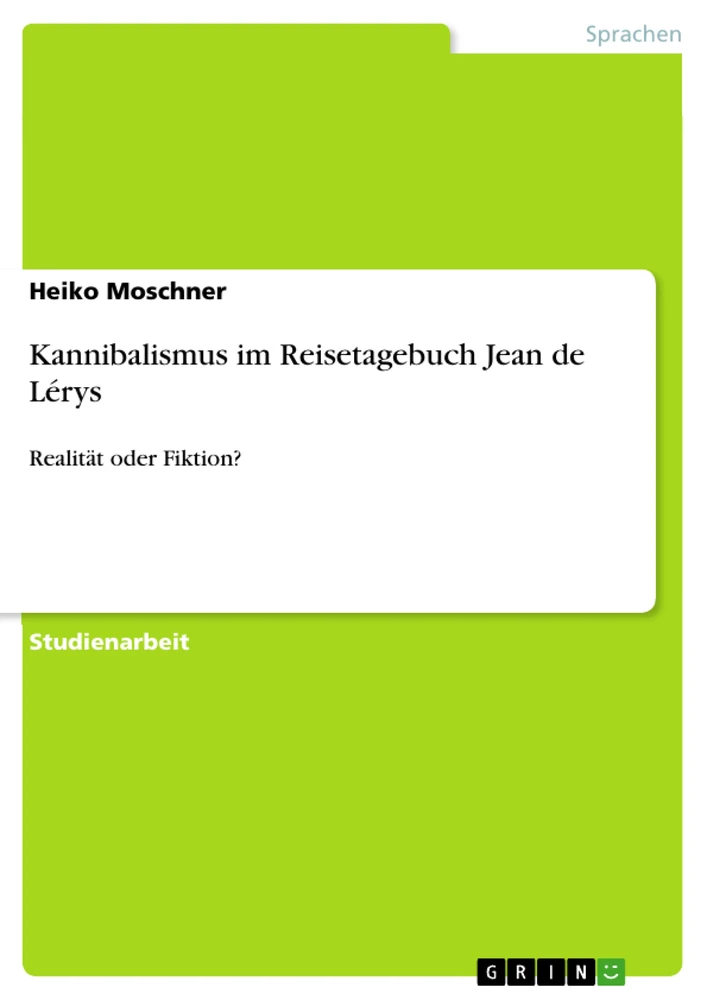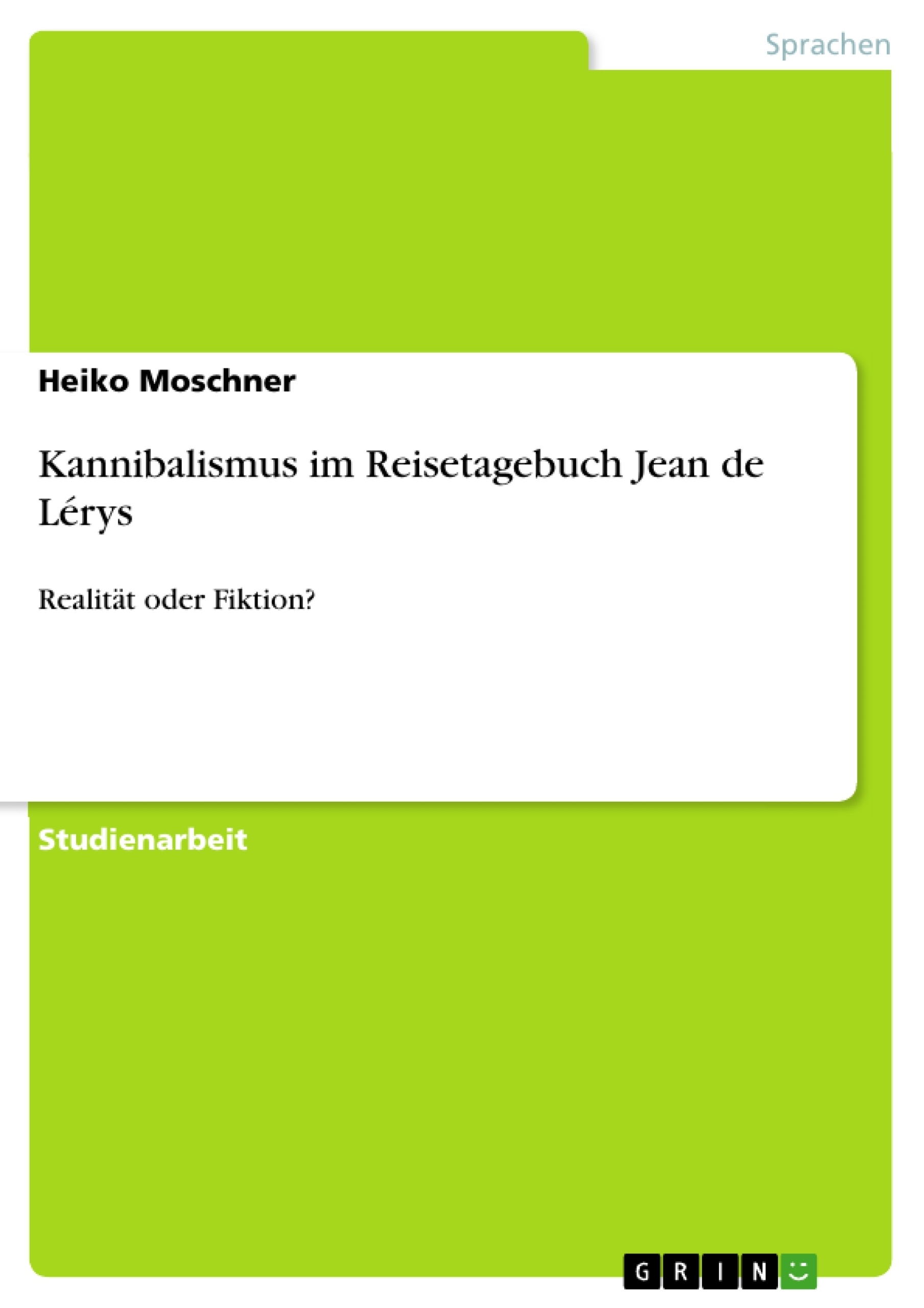Wenn einer eine Reise tut, dann kann er viel erzählen, heißt es im Volksmund. Dieses Motto galt für viele Amerikareisende im 15. und 16. Jahrhundert. So auch für den Kalvinisten Jean de Léry, der am 10. September 1556 in Genf zu seiner Brasilienreise aufbrach. Am 19. November des gleichen Jahres stach er zusammen mit einer Gruppe Kalvinisten von Honfleur in Frankreich in See, um der an Calvin gerichteten Bitte von Nicolas Durand de Villegagnon nachzukommen, bei ihm im Fort Coligny, das er 1555 nach seiner Ankunft in der neuen Welt errichtet hatte, missionarische Tätigkeiten aufzunehmen. Die Reise endete am 26. Mai 1558 mit seiner Rückkehr nach Frankreich.
Nach seiner Rückkehr hatte Léry viel zu berichten über die Gefahren und Erlebnisse der Anreise, über Stürme, Flauten und Hungersnöte während der Rückreise, über Tiere und Pflanzen im Meer sowie in Brasilien selbst, über Landstriche und Inseln, über die gottgleiche Herrschaft Villegagnon’s und die Lebensgefahr, die für die Kalvinisten von ihm ausging. Er weiß auch von einem Volk in Brasilien zu berichten, den Tupinamba , die zwar Kannibalen aber dennoch verbündete der Franzosen waren und die scheinbar nicht so Furcht erregend waren, wie man als unbedarfter Leser vielleicht vermuten könnte.
Doch waren die Tupinamba wirklich Kannibalen oder dieser Umstand eher eine Schöpfung des Autors? Gab es Gründe dafür, die ihn hätten veranlassen können, nicht nur das zu berichten, was er wirklich sah? Ist sein Tagebuch ein Bericht oder eine Erzählung? Um den Versuch diese Fragen zu beantworten soll es in dieser Arbeit gehen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Léry's Absicht bei der Veröffentlichung
- Der Schatten Europas auf Amerika
- Jean de Léry - zwischen Heimat und Fremde
- Der,gute Wilde' und die,Bestie'
- Die Eingeborenen bei Jean de Léry
- Der Vorwurf des Plagiats
- Jean de Léry - zwischen Heimat und Fremde
- Sprachliche Ausgestaltung
- Die Ich - Form
- Stil des Tagebuchs
- Kannibalismus bei Léry - Realität oder Fiktion?
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit dem Reisetagebuch von Jean de Léry, das im Jahr 1578 unter dem Titel "Unter Menschenfressern am Amazonas. Brasilianisches Tagebuch 1556-1558" veröffentlicht wurde. Sie untersucht die Hintergründe der Veröffentlichung des Tagebuches und analysiert die Frage, inwiefern Léry's Darstellung der Tupinamba, insbesondere die Behauptung des Kannibalismus, der Realität entspricht oder ob es sich um eine fiktive Konstruktion handelt.
- Léry's Motivation für die Veröffentlichung seines Tagebuches und seine Auseinandersetzung mit der Schrift von André Thevet
- Die Darstellung der Tupinamba durch Léry im Kontext der europäischen Wahrnehmung von "Wilden"
- Die Frage der Authentizität in ethnographischen Reiseberichten und die Bedeutung der "Innensicht" gegenüber der "Außensicht"
- Die sprachliche Gestaltung von Léry's Tagebuch und die Frage der Fiktionalität
- Die Darstellung des Kannibalismus bei Léry im Vergleich zu anderen Reiseberichten und die Frage der "Realität" versus "Fiktion"
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Diese Einleitung stellt den Kontext von Léry's Reise und die zentralen Fragestellungen der Arbeit vor.
Léry's Absicht bei der Veröffentlichung: Dieses Kapitel analysiert die Hintergründe für die Veröffentlichung von Léry's Reisetagebuch. Es beleuchtet insbesondere seine Auseinandersetzung mit der Schrift von André Thevet und die Motivation, eine "Gegendarstellung" zu liefern.
Der Schatten Europas auf Amerika: Dieses Kapitel untersucht den Einfluss der europäischen Wahrnehmung von "Wilden" auf Léry's Darstellung der Tupinamba. Es analysiert die Rolle von Missionierung und Abenteuerlust in Léry's Reise und betrachtet die Frage der Authentizität in ethnographischen Beschreibungen.
Sprachliche Ausgestaltung: Dieses Kapitel beleuchtet die sprachlichen Mittel, die Léry in seinem Tagebuch einsetzt. Dabei werden insbesondere die Verwendung der Ich-Form und der Stil des Tagebuchs analysiert, um Aufschluss über die Frage der Fiktionalität zu gewinnen.
Kannibalismus bei Léry - Realität oder Fiktion?: Dieses Kapitel untersucht die Darstellung des Kannibalismus bei Léry im Vergleich zu anderen Reiseberichten und diskutiert die Frage, inwiefern Léry's Aussagen der Realität entsprechen oder ob es sich um eine fiktive Konstruktion handelt.
Schlüsselwörter
Reisebericht, Jean de Léry, Tupinamba, Kannibalismus, Authentizität, Ethnographie, Missionierung, Abenteuerlust, Fiktionalität, André Thevet, "La Cosmographia", "gute Wilde", "Bestie", Innensicht, Außensicht, Sprachliche Gestaltung.
Häufig gestellte Fragen
Wer war Jean de Léry?
Jean de Léry war ein französischer Kalvinist, der im 16. Jahrhundert nach Brasilien reiste und seine Erlebnisse in einem berühmten Tagebuch festhielt.
Gab es bei den Tupinamba wirklich Kannibalismus?
Die Arbeit untersucht, ob Lérys Schilderungen des Kannibalismus auf realen Beobachtungen basierten oder eine fiktive Konstruktion zur Abgrenzung vom "Wilden" waren.
Warum veröffentlichte Léry sein Tagebuch erst Jahre später?
Léry wollte eine Gegendarstellung zu den Schriften von André Thevet liefern und seine eigenen Erfahrungen als authentischere "Innensicht" präsentieren.
Was ist der Unterschied zwischen der "Innensicht" und "Außensicht" in Reiseberichten?
Die Innensicht basiert auf langem Zusammenleben mit dem Volk (wie bei Léry), während die Außensicht oft nur oberflächliche Beobachtungen oder Vorurteile wiedergibt.
Wie wird der „gute Wilde“ bei Léry dargestellt?
Trotz des Kannibalismus stellt Léry die Tupinamba oft moralisch über die Europäer seiner Zeit, was als frühe Form der Kulturkritik verstanden werden kann.
- Quote paper
- Heiko Moschner (Author), 2006, Kannibalismus im Reisetagebuch Jean de Lérys, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/169479