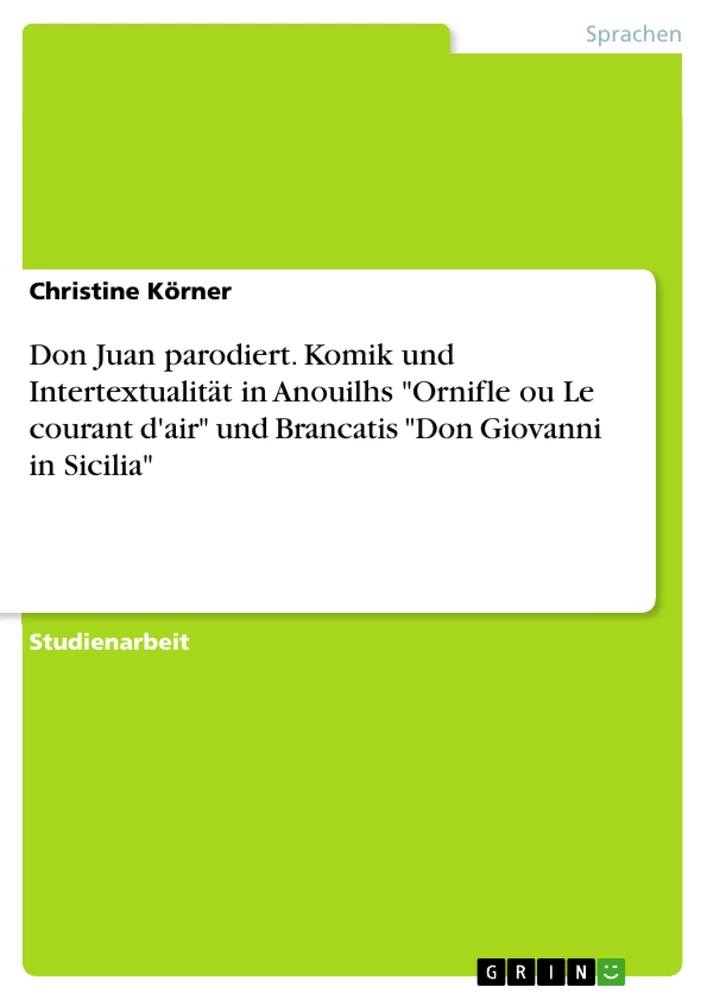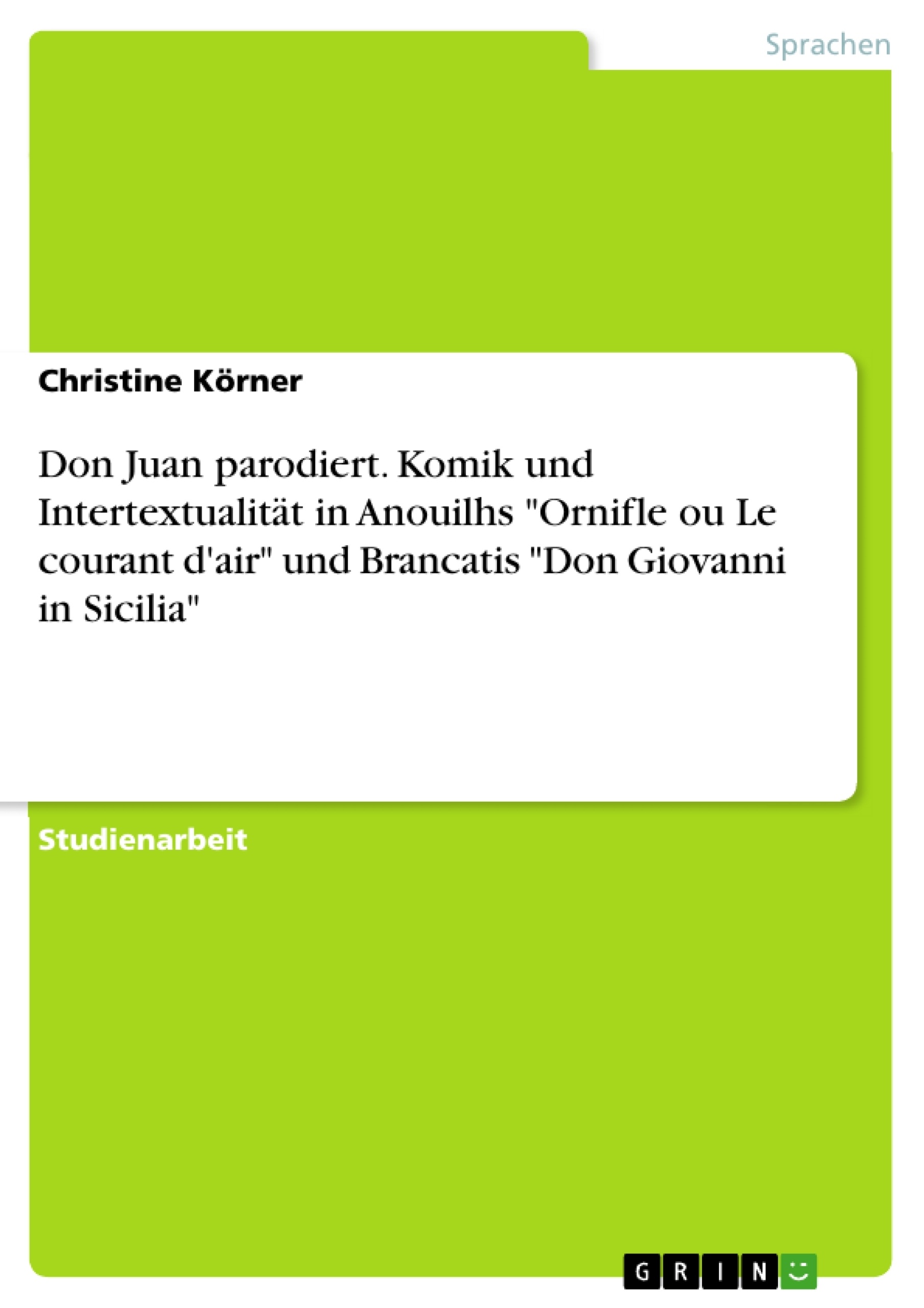Der Don-Juan-Stoff existiert seit weit über 300 Jahren und doch scheint er noch immer das Interesse des Publikums und der zeitgenössischen Schriftsteller zu halten. Allein im zwanzigsten Jahrhundert erschienen mehr als 350 Titel weltweit, die zumindest einen Bezug zum Don-Juan-Thema aufweisen. Bei dieser gewaltigen Zahl stellt sich unweigerlich die Frage nach der Erschöpfbarkeit des Stoffes.
Warum gibt Don Juan noch immer Anlass, über ihn nachzudenken, zu schreiben und ihn zu verändern? Was macht den einst Strumpfhosen tragenden Held De Molinas, Molières und Da Pontes so zeitlos attraktiv, dass man ihn in neuem Gewand auch im zwanzigsten Jahrhundert auf der Bühne, in Büchern und in Filmen findet?
In dieser Arbeit soll anhand der Beispiele „Ornifle ou Le courant d'air“ von Jean Anouilh und Vitaliano Brancatis „Don Giovanni in Sicilia“ insbesondere das Phänomen der parodistischen Herangehensweise an den Don-Juan-Stoff beleuchtet werden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Moderne und Postmoderne
- Parodie und Komik
- Definition Parodie
- Definition Komik
- Funktionen der Komik
- Mittel der Komik
- Analysefragestellung / Leitthese
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die parodistische Herangehensweise an den Don-Juan-Stoff in den Werken „Ornifle ou Le courant d'air“ von Jean Anouilh und „Don Giovanni in Sicilia“ von Vitaliano Brancati. Im Fokus steht dabei der Zusammenhang zwischen dem Don-Juan-Thema, der parodistischen Schreibweise und den literarischen Epochen des zwanzigsten Jahrhunderts. Besondere Aufmerksamkeit wird der Komik gewidmet, die in beiden Werken eine bedeutende Rolle spielt.
- Die parodistische Bearbeitung des Don-Juan-Stoffes im 20. Jahrhundert
- Die Rolle der Komik in der Intertextualität des Don-Juan-Themas
- Die literarische Moderne und Postmoderne im Kontext der Don-Juan-Parodie
- Die Motivation der Autoren für eine parodistische Gestaltung des Don-Juan-Stoffes
- Die Mittel der intertextuellen und textimmanenten Komik in den untersuchten Werken
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt den Don-Juan-Stoff als ein zeitloses Thema vor, das auch im 20. Jahrhundert nach wie vor relevant ist. Die Arbeit konzentriert sich auf die parodistische Bearbeitung des Stoffes in den Werken von Anouilh und Brancati und untersucht die Rolle der Komik in diesem Kontext.
Das zweite Kapitel behandelt die literarische Moderne und Postmoderne und diskutiert die Bedeutung des „radikal Neuen“ in diesen Epochen. Es wird die Frage aufgeworfen, wie der Don-Juan-Stoff in diese literarischen Strömungen passt, die nach Innovation und Neuheit streben.
Im dritten Kapitel werden die Begriffe „Parodie“ und „Komik“ definiert und verschiedene Theorien zu diesen Themen vorgestellt.
Schlüsselwörter
Don-Juan-Stoff, Parodie, Komik, Intertextualität, Moderne, Postmoderne, „Ornifle ou Le courant d'air“, „Don Giovanni in Sicilia“, literarische Epochen, Beate Müller, „Komische Intertextualität – die literarische Parodie“
Häufig gestellte Fragen
Warum ist der Don-Juan-Stoff auch heute noch aktuell?
Der Stoff ist zeitlos attraktiv, da er grundlegende menschliche Themen behandelt. Im 20. Jahrhundert erschienen weltweit über 350 Titel, die diesen Mythos neu interpretieren.
Was ist das Hauptthema dieser Arbeit?
Die Arbeit untersucht die parodistische Herangehensweise an den Don-Juan-Stoff in Werken von Jean Anouilh und Vitaliano Brancati unter dem Aspekt der Komik und Intertextualität.
Wie wird Parodie in diesem Kontext definiert?
Parodie wird als eine Form der intertextuellen Komik verstanden, die bekannte Stoffe verzerrt oder in neue, oft widersprüchliche Kontexte stellt.
Welche Rolle spielt die Postmoderne bei der Don-Juan-Parodie?
In der Moderne und Postmoderne dient die Parodie dazu, den Drang nach Innovation mit der Wiederverwendung traditioneller Mythen zu verknüpfen.
Welche Werke werden konkret analysiert?
Analysiert werden Jean Anouilhs „Ornifle ou Le courant d'air“ und Vitaliano Brancatis „Don Giovanni in Sicilia“.
- Quote paper
- Christine Körner (Author), 2010, Don Juan parodiert. Komik und Intertextualität in Anouilhs "Ornifle ou Le courant d'air" und Brancatis "Don Giovanni in Sicilia", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/169526