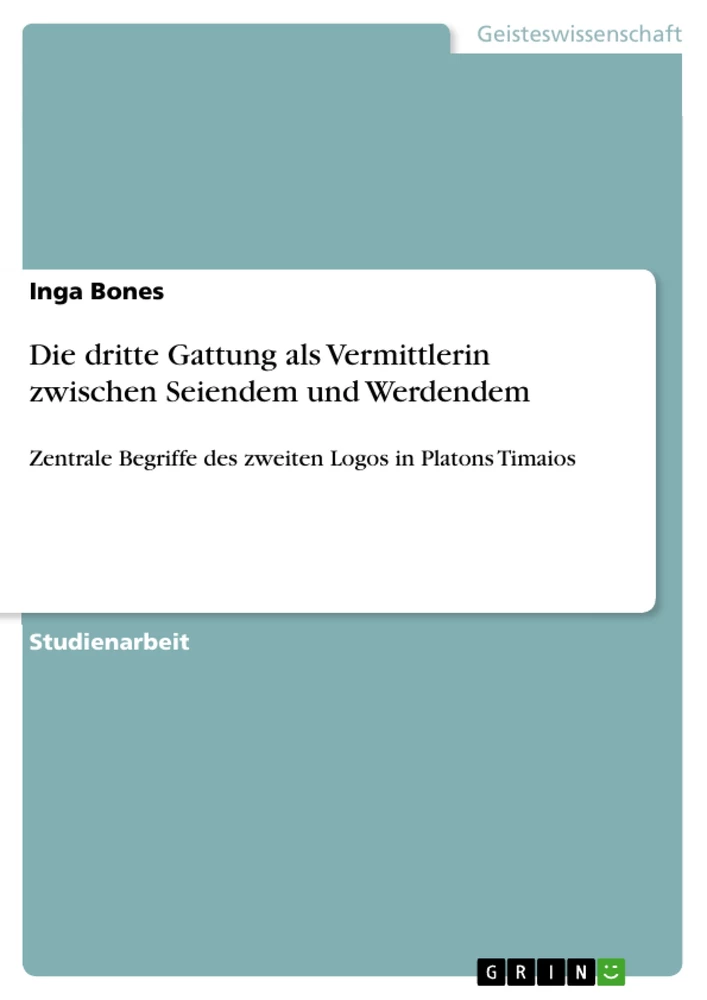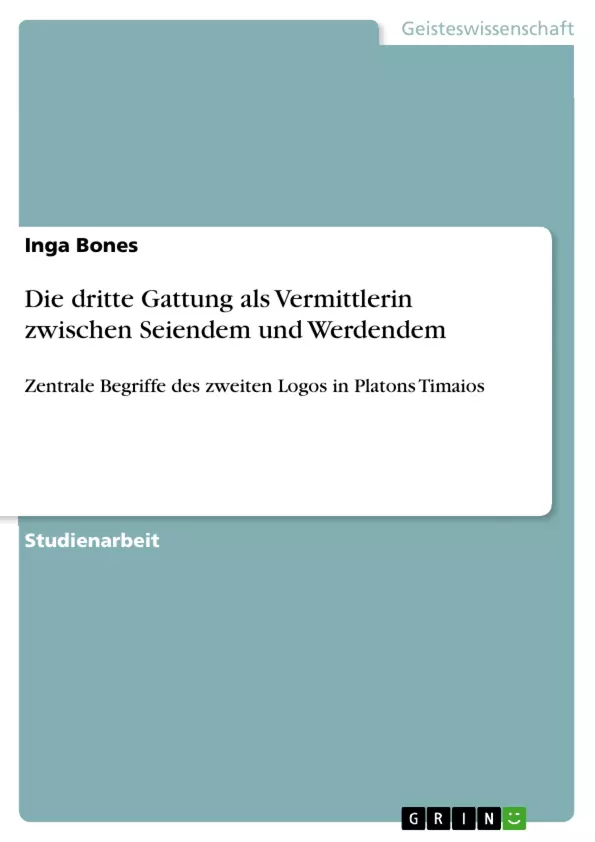Der Timaios, die Schöpfungsgeschichte Platons, nimmt in mehrerlei Hinsicht eine Sonderstellung in seinem philosophischen Gesamtwerk ein: Sokrates, der im Gros der platonischen Dialoge die Rolle des „Geburtshelfers“ im philosophischen Zwiegespräch übernimmt, tritt im
Timaios zugunsten eines längeren Monologs des namensgebenden Protagonisten zurück; seine sporadischen Einwürfe bilden nur mehr den erzählerischen Rahmen für den kosmologischen Entwurf des Timaios.
Neben der eigentümlichen Struktur des Textes – dem Monolog des Timaios geht ein Exkurs über den Atlantis-Mythos voraus, dessen erzählerische oder kompositionelle Funktion prima facie diffus erscheint – ist vor allem die diskontinuierliche Rezeptionsgeschichte des Timaios erwähnenswert: Über Jahrhunderte galt er als jenes Werk, welches die platonische Philosophie in Vollendung zum Ausdruck bringe. Die Vorrangstellung des Timaios vor den anderen Dialogen offenbart sich in der erstaunlichen Tatsache, dass er als einziger Text Platons im Mittelalter in lateinischer Übersetzung vorlag. Mitte des 20. Jahrhunderts war das
Interesse an der Kosmologie Platons vor allem im angelsächsischen Raum nahezu vollständig erloschen, was nicht zuletzt dem Einfluss des logischen Positivismus mit seiner dezidiert antimetaphysischen Haltung geschuldet ist. Die „Rehabilitation“ der Metaphysik Ende des 20. Jahrhunderts, unter anderem vorangetrieben von in der analytischen Tradition stehenden Philosophen wie Peter Strawson, förderte das wiederaufkeimende Forschungsinteresse. Auch
wenn Alfred N. Whiteheads Charakterisierung der europäischen Philosophie als „eine Reihe von Fußnoten zu Platon“ sicherlich zu pessimistisch ist, bleiben die platonischen Ideen mehr
als nur philosophiehistorisch relevant. Das Wiederentdecken alter Wahrheiten, „die Mühe [ihres] Neu-Denkens […] in eigenen, zeitgebundenen Begriffen“ lohnt sich.
Der Fokus dieser Arbeit liegt auf den Passagen 48a bis 53c des zweiten Logos. Im Gegensatz zum ersten Logos, der die Entstehung des lebendigen Kosmos im Wesentlichen teleologisch erklärt, widmet sich der zweite
Teil von Timaios’ Rede der grundlegenden Physik der Welt. Im Zentrum des zweiten Logos steht die Frage nach der arché, dem Urgrund und Prinzip allen Seienden. Im Versuch, das Wesen der „Grundbausteine“ des Kosmos zu ergründen, wird die traditionelle platonische
Dichotomie von Seiendem und Werdendem aufgehoben; die Notwendigkeit einer dritten, „schwierige[n] und dunkle[n] Gattung“, der chóra, postuliert.
Inhaltsverzeichnis
- 0. Einleitung
- 1. Der Prolog zum ersten λóyos - Metaphysische und epistemologische Präliminarien
- 1.1 Der Status der Welt
- 1.2 Der Status des kosmologischen Entwurfs
- 2. Der zweite λóyos
- 2.1 Die Natur von Feuer, Wasser, Erde und Luft
- 2.2 Die dritte Gattung - Urstoff oder Raum?
- 2.3 Vernunft und Notwendigkeit
- 3. Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit Platons Timaios, insbesondere mit dem zweiten λóyos (48a-53c), der die grundlegende Physik der Welt beleuchtet. Ziel ist es, die zentrale Rolle der „dritten Gattung“, der chóra, im platonischen Kosmos zu analysieren und ihre Bedeutung im Kontext der traditionellen Dichotomie von Seiendem und Werdendem zu verstehen. Weiterhin werden die elementaren Grundbausteine Feuer, Wasser, Luft und Erde sowie die Rolle der Notwendigkeit im Verhältnis zur Vernunft untersucht.
- Die Rolle der chóra als Vermittlerin zwischen Seiendem und Werdendem
- Die ontologische Natur der chóra
- Die Beziehung zwischen Vernunft und Notwendigkeit im platonischen Kosmos
- Die Interpretation der vier Elemente (Feuer, Wasser, Erde, Luft) im Kontext der chóra
- Die metaphysischen Grundlagen des platonischen Kosmos
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung bietet einen Überblick über die Rezeptionsgeschichte des Timaios und stellt die zentralen Themen und Probleme der Arbeit vor. Das erste Kapitel analysiert den Prolog zum ersten λóyos, der metaphysische und epistemologische Präliminarien für Platons kosmologischen Entwurf liefert. Dabei werden die Dichotomien von Seiendem und Werdendem, Wissen und Meinen sowie Vernunfterkenntnis und Sinneswahrnehmung diskutiert.
Das zweite Kapitel, dem sich der Hauptteil der Arbeit widmet, fokussiert auf den zweiten λóyos und seine zentrale Fragestellung nach der arché (άpxý), dem Urgrund und Prinzip allen Seienden. Die Analyse der „dritten Gattung“, der chóra, bildet den Kern des Kapitels und beleuchtet ihre Rolle als Vermittlerin zwischen den unveränderlichen Urbildern und den stets in Veränderung begriffenen Abbildern.
Der Fokus liegt dabei auf der Frage nach der Natur der chóra und ihrer Abgrenzung von den anderen Seinsgattungen. Darüber hinaus werden die elementaren Grundbausteine Feuer, Wasser, Luft und Erde sowie die Rolle der Notwendigkeit als Antagonistin der Vernunft in den Kontext der chóra gestellt.
Schlüsselwörter
Platon, Timaios, zweiter λóyos, chóra, Seiendem, Werdendem, Urstoff, Raum, Vernunft, Notwendigkeit, Feuer, Wasser, Erde, Luft, metaphysische Dichotomie, epistemologische Unterscheidung, kosmologische Entwurf, arché, Urgrund, Prinzip, Grundbausteine, metaphysischer Status, epistemologischer Status.
Häufig gestellte Fragen
Was ist die "chóra" in Platons Timaios?
Die chóra ist die "dritte Gattung", die als Raum oder Urstoff zwischen dem unveränderlichen Seienden (Ideen) und dem werdenden Abbild (Materie) vermittelt.
Welche Rolle spielt die Vernunft im Kosmos?
Die Vernunft (Logos) ordnet das Chaos, muss dabei aber mit der "Notwendigkeit" (Ananke) zusammenwirken, um die Welt zu gestalten.
Wie werden die vier Elemente bei Platon interpretiert?
Feuer, Wasser, Luft und Erde werden im zweiten Logos als grundlegende physikalische Bausteine des Kosmos innerhalb der chóra analysiert.
Warum ist der Timaios philosophiegeschichtlich so bedeutend?
Er war im Mittelalter das einzige in lateinischer Übersetzung vorliegende Werk Platons und gilt als Vollendung seiner Naturphilosophie.
Was ist der Unterschied zwischen dem ersten und zweiten Logos?
Der erste Logos erklärt die Schöpfung teleologisch (zielgerichtet), während der zweite Logos die zugrunde liegende Physik und den Urgrund (Arché) untersucht.
- Citation du texte
- Bachelor of Arts (B.A.) Inga Bones (Auteur), 2011, Die dritte Gattung als Vermittlerin zwischen Seiendem und Werdendem, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/169528