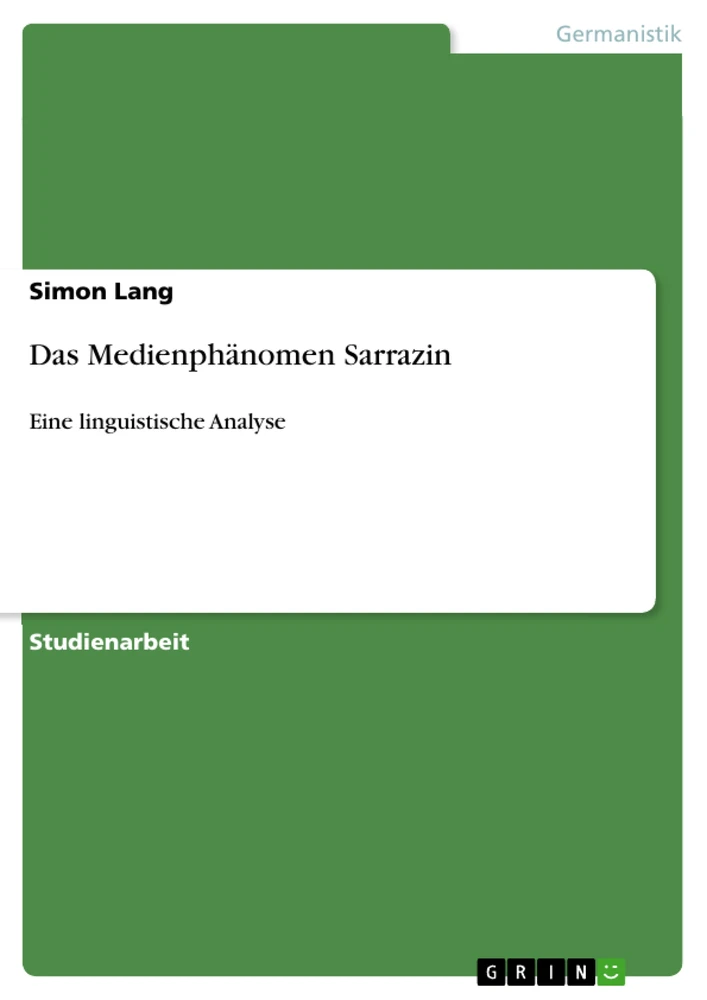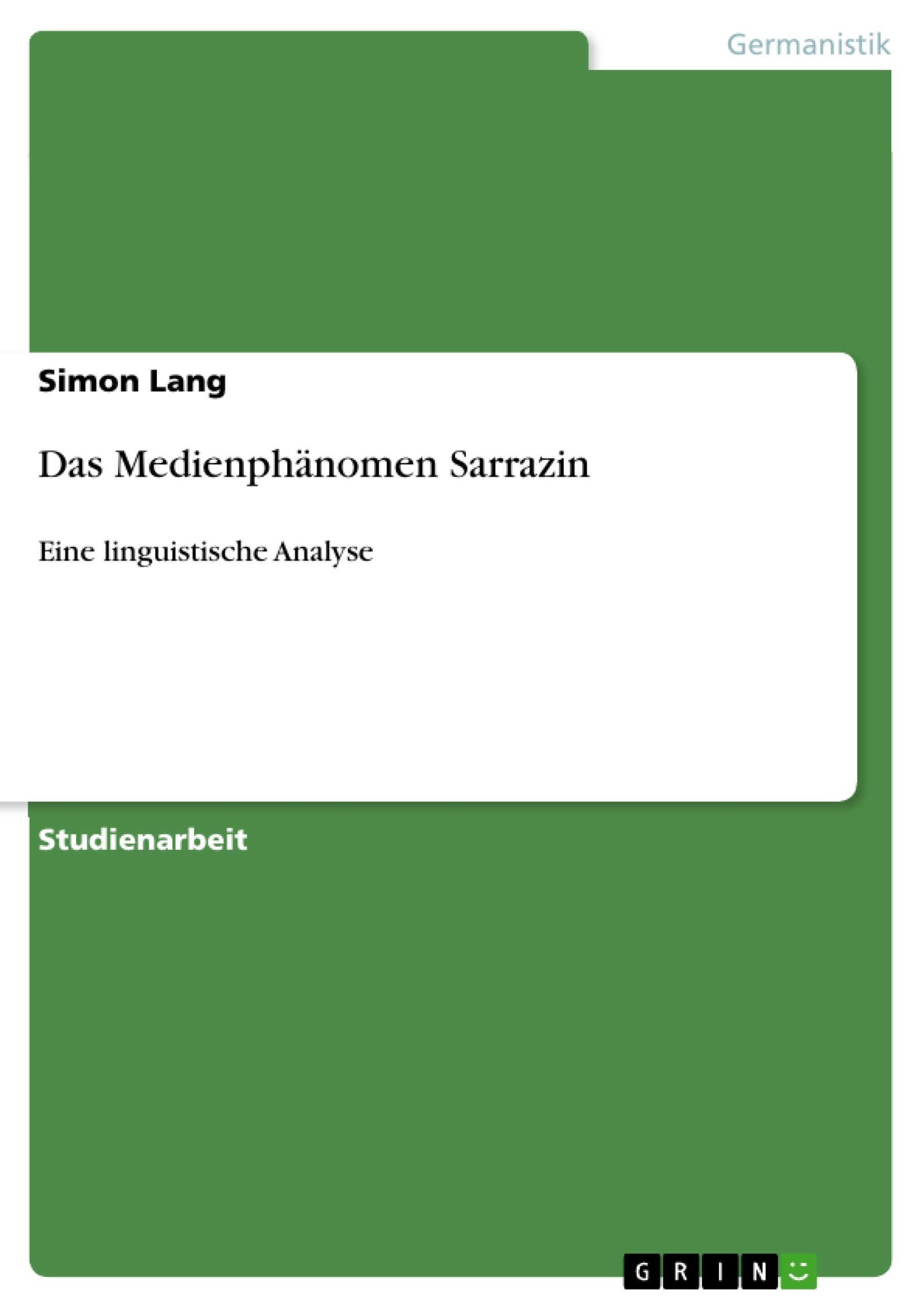Kaum eine andere Person spaltet die Öffentlichkeit Deutschlands wie das SPD-Mitglied und ehemaliger Bundesbank-Vorstand Thilo Sarrazin. Er gilt als Tabubrecher und Provokateur. Seit Jahren gelangt er immer wieder durch brisante und provokante Aussagen und Thesen über delikate Sachbereiche in die Medien, wodurch Skandale ausgelöst und starke Diskussionen entfacht wurden. Neben Hartz-IV-Empfängern und der deutschen Hauptstadt Berlin, für die er von 2002 bis 2009 als Finanzsenator zuständig war, äußerte sich Sarrazin vor allem über die Situation und Integrationsfähigkeit von Ausländern in der Bundesrepublik. Besonders der sogenannten 'Kopftuchmädchen-Skandal' im Oktober 2009, der durch ein Interview mit der Kulturzeitschrift 'Lettre International' ausgelöst wurde, erhitzte die Gemüter der Nation. Mit der Veröffentlichung seines Buches 'Deutschland schafft sich ab' im August 2010 und den darin enthaltenen kontroversen Thesen zur deutschen Migrationspolitik und dem Verhalten muslimischer Migranten erreichte die Debatte um Sarrazin ihren Höhepunkt, was letztendlich dazu führte, dass er dem Druck der Öffentlichkeit nachgab und am 9. September 2010 von seinem Posten als Vorstand der deutschen Bundesbank zurücktrat. Die Causa 'Sarrazin' war zur Staatssache geworden.
Im Folgenden liegt der Fokus auf drei ausgewählten Aussagen Thilo Sarrazins, die sprachwissenschaftlich untersucht werden. Die Migrationsdebatte soll dabei nicht im Mittelpunkt der Betrachtungen stehen. Dabei wird auf die Brisanz der Aussagen Sarrazins, sowie dessen Illokution und Perlokution eingegangen. Des Weiteren soll untersucht werden, wie die Skandalisierung durch die Medien aus sprachwissenschaftlicher Betrachtungsweise erfolgt. Diese Bereiche werden im ersten Teil der Arbeit theoretisch behandelt, bevor sie auf die verschiedenen Äußerungen Sarrazins angewendet werden.
Dabei wird ersichtlich werden, dass Medien die Aussagen Sarrazins durch Re-Kontextualisierug in ihrer Berichterstattung semantisch verändern und zuspitzen. Andererseits wird gezeigt, dass die Wortwahl Sarrazins oft sehr simpel ist und zur Veranschaulichung verschiedener Sachverhalte dient.
Inhaltsverzeichnis
- Das Medienphänomen Thilo Sarrazin
- Linguistische Theorie
- Skandalisierung der Massenmedien
- De‐Re‐Kontextualisierung
- Denotat und Konnotat
- Sprechakttheorie
- Der viergliedrige Sprechakt
- Illokution
- Illokutionsindikatoren
- Illokutionstypen nach Searle
- Die brisanten Äußerungen
- Der KZ‐Vergleich
- Brisanz der Aussage
- Illokution Sarrazins und Perlokution
- Skandalisierung durch die Medien
- Zur Situation Berlins vor den Landtagswahlen 2006
- Brisanz der Aussage
- Illokution Sarrazins und Perlokution
- Skandalisierung durch die Medien
- Das Judengen‐Zitat
- Brisanz der Aussage
- Illokution Sarrazins und Perlokution
- Skandalisierung durch die Medien
- Der KZ‐Vergleich
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Seminararbeit untersucht das Medienphänomen Thilo Sarrazin und analysiert seine brisanten Äußerungen aus sprachwissenschaftlicher Perspektive. Der Fokus liegt auf der sprachlichen Gestaltung der Aussagen, der Skandalisierung durch die Medien und der Anwendung von linguistischen Theorien zur Erklärung der medialen Reaktionen.
- Skandalisierung von Aussagen im Medienbereich
- Sprachliche Mittel der Re-Kontextualisierung und Zuspitzung
- Anwendung der Sprechakttheorie auf provokante Äußerungen
- Analyse der Bedeutung von Denotat und Konnotat
- Zusammenhang von Sprachgebrauch, Medienberichterstattung und öffentlicher Meinung
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit analysiert drei ausgewählte Aussagen Sarrazins. Der KZ‐Vergleich, der im Kontext einer Debatte um Kita‐Gebühren in Berlin entstand, zeigt die Brisanz von Reizwörtern und hyperbolischen Vergleichen. Der Vergleich der Lage Berlins vor den Landtagswahlen 2006 mit der Situation im Jahr 1947 verdeutlicht die Verwendung von historischen Vergleichen zur Veranschaulichung und die Rolle des Ko‐Textes bei der Interpretation von Aussagen. Das Judengen‐Zitat aus einem Interview mit der 'Welt am Sonntag' befasst sich mit dem Problem der Konnotation von Wörtern und der Auslösung von Emotionen. Die Analyse der Medienberichterstattung zu diesen Aussagen zeigt, wie Re‐Kontextualisierung und Zuspitzung zum Skandal führen und die öffentliche Meinung beeinflussen.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf die sprachwissenschaftliche Analyse des Medienphänomens Sarrazin. Die zentralen Themen sind die Skandalisierung durch Medien, Re‐Kontextualisierung, Denotat und Konnotat, Sprechakttheorie, Illokution und Perlokution. Die Arbeit untersucht die Verwendung von Reizwörtern, Vergleichen, historischen Referenzen und die Bedeutung des Ko‐Textes bei der Interpretation von Aussagen. Die Analyse fokussiert auf die Interaktion zwischen Sprachgebrauch, Medienberichterstattung und öffentlicher Meinung.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Hauptthema der sprachwissenschaftlichen Analyse zu Thilo Sarrazin?
Die Arbeit untersucht die sprachliche Gestaltung brisanter Äußerungen Sarrazins sowie deren Skandalisierung und semantische Zuspitzung durch die Massenmedien.
Welche linguistischen Theorien werden in der Arbeit angewendet?
Es kommen die Sprechakttheorie (Illokution/Perlokution), die Analyse von Denotat und Konnotat sowie das Konzept der De- und Re-Kontextualisierung zum Einsatz.
Welche drei konkreten Äußerungen Sarrazins werden analysiert?
Analysiert werden der sogenannte "KZ-Vergleich", Aussagen zur Situation Berlins vor den Wahlen 2006 und das "Judengen-Zitat".
Wie tragen Medien zur Skandalisierung bei?
Medien verändern Aussagen oft durch Re-Kontextualisierung, wodurch sie semantisch zugespitzt werden und eine stärkere öffentliche Reaktion hervorrufen.
Was bedeutet "Illokution" im Zusammenhang mit Sarrazins Aussagen?
Die Illokution beschreibt die Absicht, die Sarrazin mit seinen Äußerungen verfolgte, während die Perlokution die tatsächliche Wirkung auf die Zuhörer bzw. die Öffentlichkeit beschreibt.
Warum ist die Wortwahl Sarrazins linguistisch interessant?
Sarrazin nutzt oft eine sehr simple Wortwahl und Reizwörter zur Veranschaulichung, was die Interpretationsspielräume und die mediale Verwertbarkeit beeinflusst.
- Quote paper
- Simon Lang (Author), 2010, Das Medienphänomen Sarrazin, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/169531