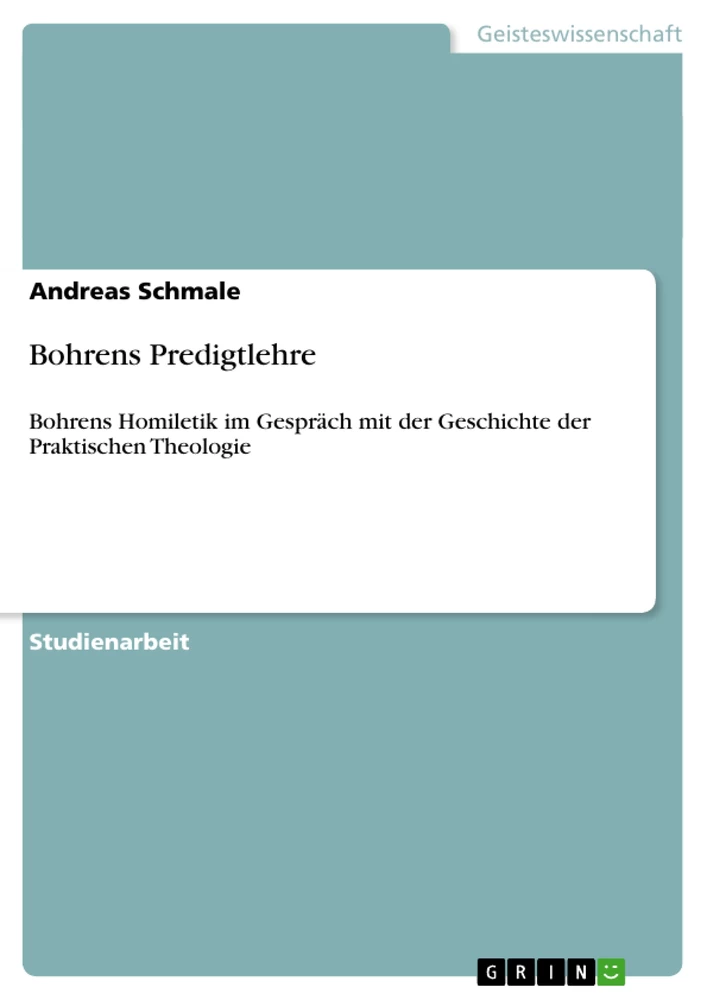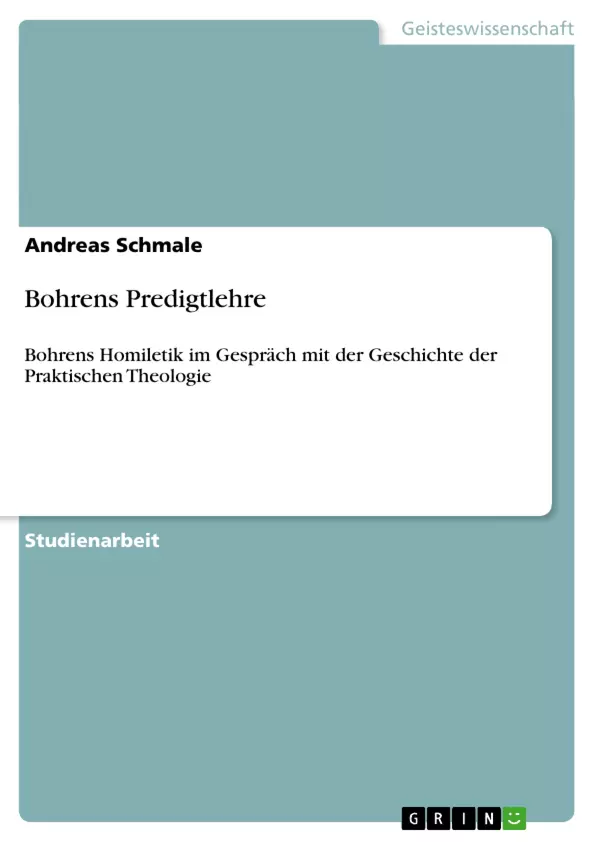Es handelt sich um eine dreiteilige Ausarbeitung mit allen von der Wissenschaft geforderten Fußnoten und Literaturverweisen. (Harvard-Prinzip)
Die Arbeit ist vom Sinn her wie folgt durchdacht worden:
1. inhaltliche Zusammenfassung der makanten Stellen innerhalb Bohrens PT
2. Diskussion der Predigtlehre mit Zeitgenossen Bohrens (Lange) und heutigen Theologen (Grötzinger, Möller, Grethlein, Josuttis,...) 3. Es folgt eine eigene kritische Würdigung der Predigtlehre.
Inhaltsverzeichnis
Portrait Rudolf Bohren iii
1. Charakteristiken der Predigtlehre Bohrens 1
1.1. Predigen aus Leidenschaft 1
1.2. Pneumatologische Theologie 3
1.3. Gott als erster Hörer 5
2. Diskussion mit der Geschichte der Praktischen Theologie 7
2.1. Hörerhörigkeit 7
2.1. Pneumatologische Vermengung 9
3. Würdigung 10
Portrait Rudolf Bohren 2004 iv
Bibliographie v
Inhaltsverzeichnis
- 1. Charakteristiken der Predigtlehre Bohrens
- 1.1. Predigen aus Leidenschaft
- 1.2. Pneumatologische Theologie
- 1.3. Gott als erster Hörer
- 2. Diskussion mit der Geschichte der Praktischen Theologie
- 2.1. Hörerhörigkeit
- 2.1. Pneumatologische Vermengung
- 3. Würdigung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert Rudolf Bohrens Predigtlehre, insbesondere seine Betonung des Hörers, des Wirkens des Heiligen Geistes und der Leidenschaft im Predigen. Sie setzt Bohrens Ansatz in den Kontext der Geschichte der Praktischen Theologie, insbesondere im Verhältnis zur dialektischen und empirischen Theologie. Die Würdigung schließt die Arbeit ab.
- Die Rolle des Heiligen Geistes in Bohrens Homiletik
- Die Spannung zwischen dem Machbaren und dem Wunder der Predigt
- Bohrens Auseinandersetzung mit der Hörerzentriertheit in der Praktischen Theologie
- Der Begriff der "Hörerhörigkeit" und seine Kritik an der empirischen Theologie
- Die Bedeutung der Leidenschaft im Predigen
Zusammenfassung der Kapitel
1. Charakteristiken der Predigtlehre Bohrens: Dieses Kapitel beschreibt zentrale Aspekte von Bohrens Predigtlehre. Es betont die Bedeutung des Hörers und des Wirkens des Heiligen Geistes, sowie die zentrale Rolle der Leidenschaft. Bohren versteht Predigen als einen Akt, der über die Grenzen des Machbaren hinausgeht, ein Wagnis, das auf das Eingreifen Gottes vertraut. Er verwendet das Bild des "Brandstifters", der nicht durch menschliche Techniken, sondern durch das Wirken Gottes etwas in Bewegung setzt. Die Kapitel betonen die Notwendigkeit, die Grenzen des eigenen Könnens zu erkennen, gleichzeitig aber auf das Wunder der göttlichen Einmischung zu vertrauen. Bohren wendet sich gegen eine rein historisch-kritische oder rein empirische Herangehensweise an die Predigt, und plädiert für einen pneumatologischen Ansatz, der das Wirken des Geistes in den Mittelpunkt stellt. Er kritisiert das Ersetzen des "fehlenden Wortes" durch bloßes Engagement.
2. Diskussion mit der Geschichte der Praktischen Theologie: Dieses Kapitel setzt Bohrens Predigtlehre in den Kontext der Auseinandersetzung zwischen dialektischer und empirischer Theologie. Es analysiert Bohrens Verhältnis zu Theologen wie Karl Barth und Eduard Thurneysen (dialektische Theologie) und Ernst Lange (empirische Theologie). Bohren kritisiert die Hörerhörigkeit der empirischen Theologie, die den Hörer zum bestimmenden Faktor der Predigt macht, ohne die Primat des Wortes Gottes ausreichend zu berücksichtigen. Gleichzeitig distanziert er sich von einer rein dialektischen Theologie, die das Menschliche in der Predigt zu wenig berücksichtigt. Bohren sucht einen Mittelweg, der sowohl die Bedeutung des Wortes Gottes als auch die Relevanz des Hörers und seiner Situation anerkennt. Der Begriff der "theonomen Reziprozität" wird eingeführt, um die wechselseitige Beziehung zwischen göttlichem Wirken und menschlichem Handeln in der Predigt zu beschreiben.
Schlüsselwörter
Rudolf Bohren, Predigtlehre, Homiletik, Pneumatologie, Dialektische Theologie, Empirische Theologie, Hörer, Heiliger Geist, Leidenschaft, Wunder, theonome Reziprozität, Karl Barth, Eduard Thurneysen, Ernst Lange, Wort Gottes.
Häufig gestellte Fragen zu Rudolf Bohrens Predigtlehre
Was ist der Inhalt dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert die Predigtlehre von Rudolf Bohren. Sie untersucht seine Betonung des Hörers, des Wirkens des Heiligen Geistes und der Leidenschaft im Predigen und setzt seinen Ansatz in den Kontext der Geschichte der Praktischen Theologie, insbesondere im Verhältnis zur dialektischen und empirischen Theologie. Die Arbeit beinhaltet ein Inhaltsverzeichnis, eine Zielsetzung mit Themenschwerpunkten, Zusammenfassungen der Kapitel und Schlüsselwörter.
Welche zentralen Aspekte von Bohrens Predigtlehre werden behandelt?
Die Arbeit beleuchtet die Bedeutung des Hörers und des Wirkens des Heiligen Geistes in Bohrens Homiletik. Ein Schwerpunkt liegt auf der Rolle der Leidenschaft im Predigen und der Spannung zwischen dem Machbaren und dem Wunder der Predigt. Bohrens Kritik an der Hörerzentriertheit in der empirischen Theologie und sein Konzept der "Hörerhörigkeit" werden ebenfalls ausführlich diskutiert.
Wie setzt sich Bohren mit der Geschichte der Praktischen Theologie auseinander?
Die Arbeit analysiert Bohrens Verhältnis zu Theologen wie Karl Barth und Eduard Thurneysen (dialektische Theologie) und Ernst Lange (empirische Theologie). Bohren kritisiert die Hörerhörigkeit der empirischen Theologie und sucht einen Mittelweg, der sowohl die Bedeutung des Wortes Gottes als auch die Relevanz des Hörers und seiner Situation anerkennt. Der Begriff der "theonomen Reziprozität" beschreibt die wechselseitige Beziehung zwischen göttlichem Wirken und menschlichem Handeln in der Predigt.
Welche Schlüsselbegriffe sind zentral für das Verständnis von Bohrens Predigtlehre?
Zentrale Schlüsselbegriffe sind: Rudolf Bohren, Predigtlehre, Homiletik, Pneumatologie, Dialektische Theologie, Empirische Theologie, Hörer, Heiliger Geist, Leidenschaft, Wunder, theonome Reziprozität, Karl Barth, Eduard Thurneysen, Ernst Lange, Wort Gottes.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit ist in drei Kapitel gegliedert: Kapitel 1 beschreibt die Charakteristiken von Bohrens Predigtlehre, Kapitel 2 diskutiert die Einordnung in die Geschichte der Praktischen Theologie und Kapitel 3 bietet eine abschließende Würdigung. Die Arbeit enthält außerdem ein detailliertes Inhaltsverzeichnis und Zusammenfassungen der einzelnen Kapitel.
Welche theologischen Positionen werden in der Arbeit diskutiert?
Die Arbeit setzt sich kritisch mit der dialektischen und empirischen Theologie auseinander. Bohren sucht einen Weg jenseits der rein dialektischen oder empirischen Ansätze und plädiert für einen pneumatologischen Ansatz, der das Wirken des Heiligen Geistes in den Mittelpunkt stellt.
Was ist die zentrale These der Arbeit?
Die zentrale These der Arbeit ist eine umfassende Analyse und Einordnung von Rudolf Bohrens Predigtlehre in den Kontext der Geschichte der Praktischen Theologie, mit besonderem Fokus auf die Bedeutung des Heiligen Geistes, des Hörers und der Leidenschaft im Predigtaut. Die Arbeit zeigt Bohrens Versuch, einen ausgewogenen Weg zwischen dialektischer und empirischer Theologie zu finden.
- Arbeit zitieren
- Andreas Schmale (Autor:in), 2011, Bohrens Predigtlehre, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/169796