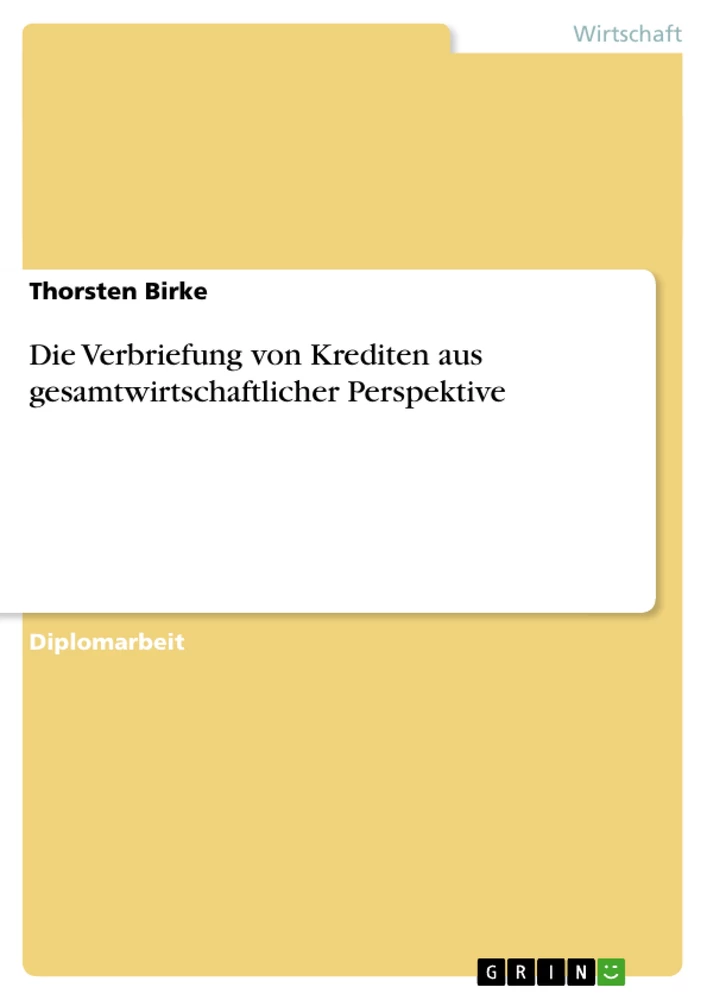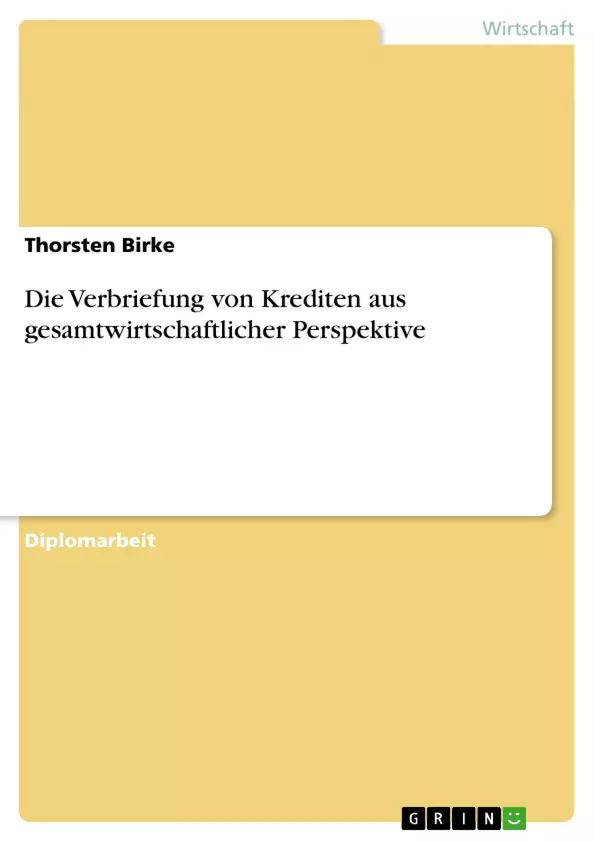Vor wenigen Jahren noch war es ein Markt, ein Finanzinstrument für „Eingeweihte“.
Forderungsunterlegte Wertpapiere, oder Asset Backed Securities (ABS) im englischen Pendant, das war keine Asset-Klasse, die der Anlageberater zur Depotbeimischung empfahl, das war – und ist noch – ein Finanzinstrument, das ausschließlich institutionelle Investoren adressiert. „A $2.5 Trillion Market You Hardly Know“ titelte die Business Week (Silverman / Sparks, 1998) vor annähernd fünf Jahren, und auch heute noch ist dies eine Zustandsbeschreibung, wie sie treffender nicht sein könnte.
Der Dynamik dieses Marktes tat dies, vor allem im Ursprungsland USA, jedoch keinen Abbruch. Seit dem Beginn der 1970er Jahre, als in den USA zum ersten Mal mit Hypotheken besicherte Wertpapiere zum Einsatz kamen, hat das Interesse an diesen Finanzinstrumenten rapide zugenommen. Finanzinstitute entdeckten die Kreditverbriefung oder auch (Credit) Securitization als neue, attraktive Finanzierungsform. Investoren sahen eine renditestarke Möglichkeit zur Erweiterung ihres Anlageuniversums. Da verwundert es kaum, dass aus den bescheidenen Anfängen der 1970er Jahre mittlerweile ein billionenschwerer, globaler Markt entstanden ist.
Doch trotz des gewaltigen Ausmaßes ist das Verständnis für diese Finanzierungsform noch immer gering. Bestes Beispiel dafür ist die Debatte um die jüngst verkündete „True Sale Initiative“ von Deutscher Bank, HypoVereinsbank, Dresdner Bank, DZ Bank und der Kreditanstalt für Wiederaufbau, eine gemeinsame Zweckgesellschaft zur Verbriefung und Veräußerung ihrer Kredite zu gründen. „Ein verkapptes Hilfskonstrukt für die angeschlagensten der deutschen Kreditinstitute“ (Clausen, 2003, S. 27) wird geargwöhnt, gar eine „Bad Bank“, eine staatliche Auffanggesellschaft für schlechte Kredite, befürchtet (Lebert et al., 2003, S. 1). Befürworter sehen dagegen die Vorteile, sprechen von einer Möglichkeit zur Entlastung des Eigenkapitals, zur Förderung der Kreditvergabe in schwierigen Zeiten. Die Debatte wird mit Sicherheit noch einige Zeit andauern, aber unabhängig von ihrem Ergebnis ist eines schon jetzt gewiss: das Interesse an der Kreditverbriefung wird weiter wachsen. Insbesondere daher ist es wichtig, das Phänomen „Kreditverbriefung“ in all seinen Facetten zu verstehen. Die akademische Forschung allerdings hat sich bisher auf das betriebswirtschaftliche wie juristische Pro & Contra dieser Finanzierungsform beschränkt, die gesamtwirtschaftliche Perspektive blieb meist außen vor. [...]
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Das Phänomen Securitization – ein Überblick
- 2.1 Begriffsabgrenzung
- 2.2 Entstehungsgründe und historische Entwicklung
- 2.2.1 Historie der Securitization in den USA
- 2.2.2 Historie der Securitization in Europa
- 2.2.3 Neuer Wachstumsmotor Kreditderivate
- 2.3 Darstellung des Verbriefungsprozesses
- 2.3.1 Funktionsweise
- 2.3.2 Charakteristika
- 2.3.3 Fallbeispiel ABSC, Series 1-Emission
- 2.4 Zusammenfassung
- 3. Auswirkungen der Securitization auf die Bank als Intermediär
- 3.1 Dogmenhistorie der Bank als Intermediär
- 3.2 Disintermediation und Verbriefung
- 3.3 Rationalität der Kreditverbriefung – das Signalling-Modell von Greenbaum / Thakor (1987)
- 3.3.1 Modellrahmen
- 3.3.2 Entscheidungsirrelevanz bei symmetrischer Information
- 3.3.3 Vorteil der Securitization bei ungleicher Informationsverteilung
- 3.3.4 Rationalität des Verkaufs guter und Bilanzierung schlechter Assets
- 3.3.5 Weitere Modellimplikationen
- 3.3.6 Fazit
- 3.4 Ausgewählte Probleme und mögliche Konsequenzen der Securitization für die Bank als Intermediär
- 3.4.1 Probleme der Glaubwürdigkeit und des Commitments
- 3.4.2 Das Liquiditätsproblem
- 3.4.2.1 Steigendes Illiquiditätsrisiko durch Kreditportfolioverschlechterung
- 3.4.2.2 Stabilisierungswirkung liquiderer Assets vs. endogene Liquidität
- 3.4.3 Das Problem des „Delegated Monitoring“
- 3.4.4 Das Problem des „Monitoring of the Monitor“
- 4. Folgen der Securitization für die Geldpolitik
- 4.1 Geldpolitische Ziele und Transmissionskanäle
- 4.2 Auswirkungen der Securitization auf die Transmission monetärer Impulse
- 4.2.1 Wirkungsänderung des Zinskanals
- 4.2.2 Wirkungsänderung des Balance Sheet Channel
- 4.2.3 Wirkungsänderung des Bank Lending Channel
- 4.3 Implikationen der Securitization für die Geldpolitik
- 4.3.1 Wirkungsänderung monetärer Impulse
- 4.3.2 Probleme verstärkter Kurzfristorientierung
- 4.3.3 Systemisches Risiko
- 4.3.3.1 Traditionelle Sichtweise
- 4.3.3.2 Reallokation systemischen Risikos durch Securitization
- 5. Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit dem Phänomen der Kreditverbriefung aus gesamtwirtschaftlicher Perspektive. Ziel ist es, die Auswirkungen der Securitization auf das Finanzsystem, insbesondere auf die Banken als Intermediäre und auf die Geldpolitik, zu analysieren.
- Entstehungsgründe und historische Entwicklung der Securitization
- Funktionsweise und Charakteristika des Verbriefungsprozesses
- Auswirkungen der Securitization auf die Bank als Intermediär
- Folgen der Securitization für die Geldpolitik
- Systemisches Risiko im Kontext der Securitization
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel führt in das Thema ein und erläutert die Relevanz der Securitization für das Finanzsystem. Kapitel 2 bietet einen umfassenden Überblick über die Entwicklung, Funktionsweise und die Charakteristika der Securitization. Es werden die wichtigsten Akteure und die verschiedenen Formen der Verbriefung vorgestellt.
Kapitel 3 analysiert die Auswirkungen der Securitization auf die Bank als Intermediär. Es wird untersucht, inwiefern die Verbriefung die Rolle der Banken verändert und welche Folgen sie für die Finanzstabilität hat.
Kapitel 4 befasst sich mit den Folgen der Securitization für die Geldpolitik. Die Arbeit beleuchtet die Auswirkungen der Securitization auf die Transmission monetärer Impulse und diskutiert mögliche Implikationen für die geldpolitische Steuerung.
Schlüsselwörter
Die Arbeit fokussiert auf die Schlüsselbegriffe Securitization, Kreditverbriefung, Finanzintermediation, Geldpolitik, Systemisches Risiko, Signalling-Modell, Disintermediation, Illiquiditätsrisiko, Delegated Monitoring, Transmission monetärer Impulse.
Häufig gestellte Fragen
Was versteht man unter Securitization?
Securitization oder Kreditverbriefung ist ein Finanzinstrument, bei dem Forderungen (wie Kredite) in handelbare Wertpapiere (Asset Backed Securities) umgewandelt werden.
Welche Rolle spielen Banken bei der Verbriefung?
Banken agieren als Intermediäre, die durch Verbriefung ihr Eigenkapital entlasten und Liquidität generieren können, was jedoch auch Risiken birgt.
Wie beeinflusst die Verbriefung die Geldpolitik?
Sie verändert die Transmissionskanäle monetärer Impulse, wie den Zinskanal oder den Bank Lending Channel.
Was ist das systemische Risiko der Securitization?
Es beschreibt die Gefahr, dass durch die Reallokation von Risiken im Finanzsystem neue, schwer kontrollierbare Instabilitäten entstehen.
Was erklärt das Signalling-Modell von Greenbaum/Thakor?
Es analysiert die Rationalität der Kreditverbriefung bei ungleicher Informationsverteilung zwischen Banken und Investoren.
- Citar trabajo
- Thorsten Birke (Autor), 2003, Die Verbriefung von Krediten aus gesamtwirtschaftlicher Perspektive, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/16980