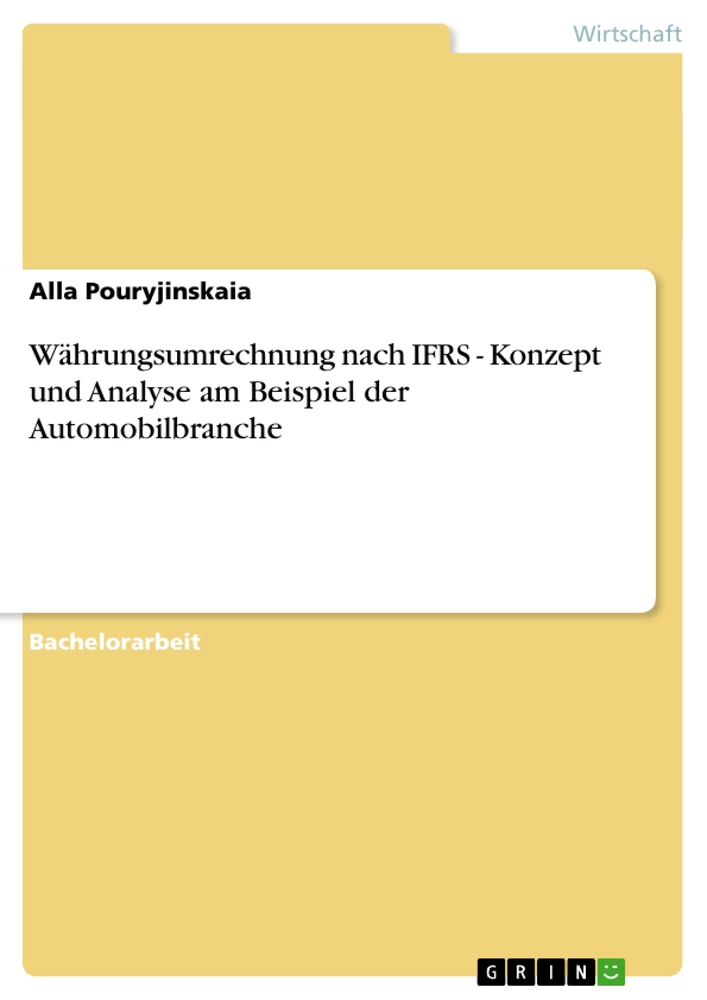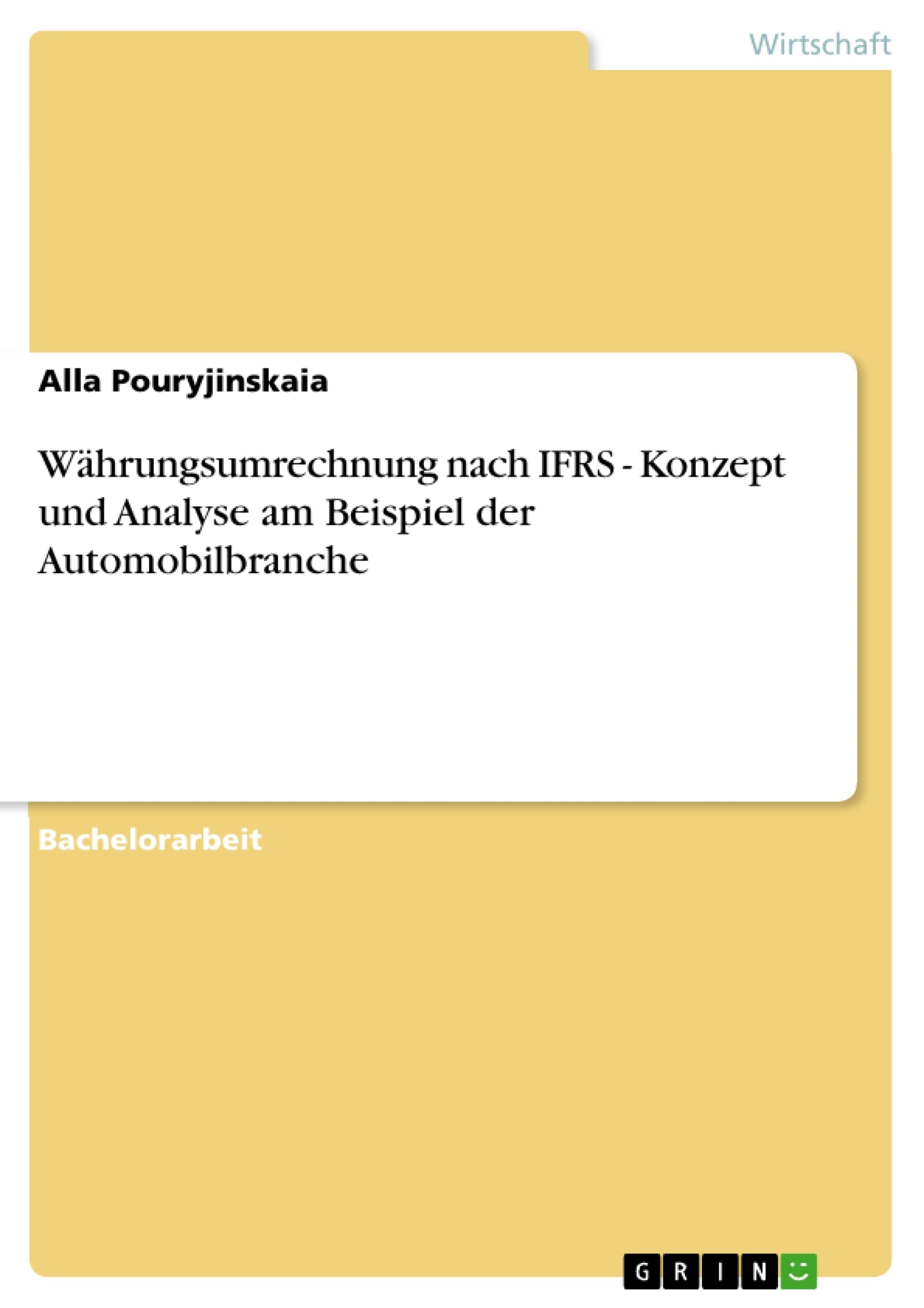1 Einleitung
1.1 Problemstellung
Anfang der 1990er Jahre begann die Kapitalverflechtung der deutschen Wirtschaft mit dem Ausland und steigt seit dem Zeitpunkt stetig an. Mit der zunehmenden Globalisierung der Finanzmärkte ist es selbstverständlich, dass der Währungsumrechnung eine immer bedeutendere Rolle zugesprochen wird, da die tatsächliche wirtschaftliche Lage eines Unternehmens, insbesondere eines Konzerns, korrekt dargestellt werden muss.
Die Unternehmen schließen vermehrt Geschäfte in fremder Währung ab, gründen oder erwerben Tochterunternehmen, deren Jahresabschlüsse in fremder Währung aufgestellt werden, unterhalten Niederlassungen oder Gemeinschaftsunternehmen im Ausland und betreiben Import und/oder Export....
...Als problematischer Aspekt der Währungsumrechnung gestaltet sich zum einen die Bestimmung des Zeitbezugs des einzusetzenden Umrechnungskurses. Andererseits müssen die Verantwortlichen auch die diffizile Entscheidung treffen, welche Position zu welchem Kurs umgerechnet werden soll. Viele Wissenschaftler postulieren die jährliche Aktualisierung des Kurses, diese Vorgaben werden jedoch in den Unternehmen nur vereinzelt umgesetzt.
1.2 Zielsetzung und Struktur der Arbeit
Die vorliegende Arbeit verfolgt das Ziel, die theoretischen Vorschriften und Grundsätze der Währungsumrechnung nach internationaler Rechnungslegung darzustellen und deren praktische Umsetzung anhand von zwei ausgewählten Automobilkonzernen zu analysieren. Als Beispiel dienen die Konzerne Daimler AG und BMW Group.
Zunächst soll im zweiten Kapitel das Grundkonzept der Rechnungslegung nach International Financial Reporting Standards erläutert werden. Dabei werden vor allem die Grundsätze hervorgehoben. Durch die Konzernrechnungslegung nach internationalen Standards wird das Kapitel zur Währungsumrechnung verbunden.
Das dritte Kapitel befasst sich mit den Grundlagen der Währungsumrechnung, inklusive des Umrechnungsproblems, Wechselkurse und den Theorien der Umrechnung wie den Umrechnungskursen und -methoden. Zudem greift dieser Abschnitt die funktionale Währung und die Entstehung und Behandlung von Währungsumrechnungsdifferenzen auf, die abschließend in diesem Kapitel thematisiert werden.
Inhaltsverzeichnis (Table of Contents)
- Inhaltsverzeichnis
- Abkürzungsverzeichnis
- Abbildungsverzeichnis
- Tabellenverzeichnis
- Einleitung
- 1 Problemstellung
- 1.1 Zielsetzung und Struktur der Arbeit
- 2 IFRS-Rechnungslegung
- 2.1 Zielsetzung von Abschlüssen
- 2.2 Rahmenkonzept (Framework)
- 2.3 Ausgewählte Grundsätze der IFRS
- 2.3.1 Grundlegende Annahmen
- 2.3.2 Qualitative Anforderungen
- 2.4 Konzernrechnungslegung nach IFRS
- 3 Grundlagen der Währungsumrechnung
- 3.1 Umrechnungsproblem
- 3.2 Wechselkurse
- 3.3 Theorien der Umrechnung
- 3.3.1 Umrechnungskurse
- 3.3.2 Umrechnungsmethoden
- 3.3.2.1 Stichtagsmethode
- 3.3.2.2 Zeitbezugsmethode
- 3.4 Das Konzept der funktionalen Währung
- 3.5 Ursachen von Währungsumrechnungsdifferenzen
- 3.6 Behandlung von Währungsumrechnungsdifferenzen
- 4 Analyse
- 4.1 Vorstellung des Daimler AG Konzerns
- 4.1.1 Methoden des Konzerns
- 4.1.2 Umrechnung
- 4.1.3 Erläuterungen
- 4.2 Vorstellung des BMW Group Konzerns
- 4.2.1 Methoden des Konzerns
- 4.2.2 Umrechnung
- 4.2.3 Erläuterungen
- 5 Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte (Objectives and Key Themes)
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Währungsumrechnung nach IFRS, insbesondere im Kontext der Automobilbranche. Ziel ist es, das Konzept der Währungsumrechnung zu erläutern, die relevanten internationalen Rechnungslegungsstandards zu analysieren und die praktische Anwendung in der Automobilbranche am Beispiel der Daimler AG und der BMW Group zu beleuchten.
- IFRS-Rechnungslegung und deren Zielsetzung
- Grundlagen der Währungsumrechnung, insbesondere die Wahl des Umrechnungskurses und die verschiedenen Umrechnungsmethoden
- Das Konzept der funktionalen Währung
- Analyse der Währungsumrechnungspraxis in der Automobilbranche am Beispiel der Daimler AG und der BMW Group
- Bedeutung und Behandlung von Währungsumrechnungsdifferenzen
Zusammenfassung der Kapitel (Chapter Summaries)
- Kapitel 1: Die Arbeit stellt die Problemstellung der Währungsumrechnung nach IFRS dar, insbesondere im Kontext der Automobilbranche. Sie erläutert die Relevanz des Themas und die Zielsetzung der Arbeit.
- Kapitel 2: Dieses Kapitel behandelt die IFRS-Rechnungslegung im Allgemeinen, einschließlich der Zielsetzung von Abschlüssen, des Rahmenkonzepts (Framework) und ausgewählter Grundsätze der IFRS, wie grundlegende Annahmen und qualitative Anforderungen. Des Weiteren wird die Konzernrechnungslegung nach IFRS behandelt.
- Kapitel 3: Dieses Kapitel geht auf die Grundlagen der Währungsumrechnung ein, einschließlich des Umrechnungsproblems, der verschiedenen Wechselkurse, der Theorien der Umrechnung und der unterschiedlichen Umrechnungsmethoden. Zudem wird das Konzept der funktionalen Währung erläutert und die Ursachen und Behandlung von Währungsumrechnungsdifferenzen beleuchtet.
- Kapitel 4: Dieses Kapitel analysiert die Währungsumrechnungspraxis in der Automobilbranche am Beispiel der Daimler AG und der BMW Group. Es stellt die jeweiligen Unternehmen, ihre Methoden und die konkrete Umrechnung anhand von Fallbeispielen vor.
Schlüsselwörter (Keywords)
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit dem Themenfeld der Währungsumrechnung nach IFRS, insbesondere im Kontext der Automobilbranche. Schlüsselbegriffe sind unter anderem: IFRS, Währungsumrechnung, Umrechnungskurs, Stichtagsmethode, Zeitbezugsmethode, funktionale Währung, Währungsumrechnungsdifferenzen, Konzernrechnungslegung, Daimler AG, BMW Group.
Häufig gestellte Fragen
Wie erfolgt die Währungsumrechnung nach IFRS?
Nach IFRS (insb. IAS 21) müssen Abschlüsse ausländischer Töchter unter Anwendung des Konzepts der funktionalen Währung in die Berichtswährung umgerechnet werden.
Was ist das Konzept der funktionalen Währung?
Die funktionale Währung ist die Währung des primären wirtschaftlichen Umfelds, in dem das Unternehmen tätig ist.
Was ist der Unterschied zwischen Stichtags- und Zeitbezugsmethode?
Die Stichtagsmethode rechnet alle Bilanzposten zum Kurs am Bilanzstichtag um, während die Zeitbezugsmethode historische Kurse für bestimmte Posten nutzt.
Wie gehen Daimler und BMW mit Währungsrisiken um?
Die Konzerne nutzen IFRS-konforme Methoden zur Umrechnung ihrer weltweiten Aktivitäten und erläutern Währungseffekte detailliert in ihren Geschäftsberichten.
Wo entstehen Währungsumrechnungsdifferenzen?
Differenzen entstehen durch Wechselkursschwankungen zwischen dem Zeitpunkt einer Transaktion und dem Bilanzstichtag oder durch die Umrechnung von Eigenkapital.
- Citar trabajo
- Alla Pouryjinskaia (Autor), 2011, Währungsumrechnung nach IFRS - Konzept und Analyse am Beispiel der Automobilbranche, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/169825