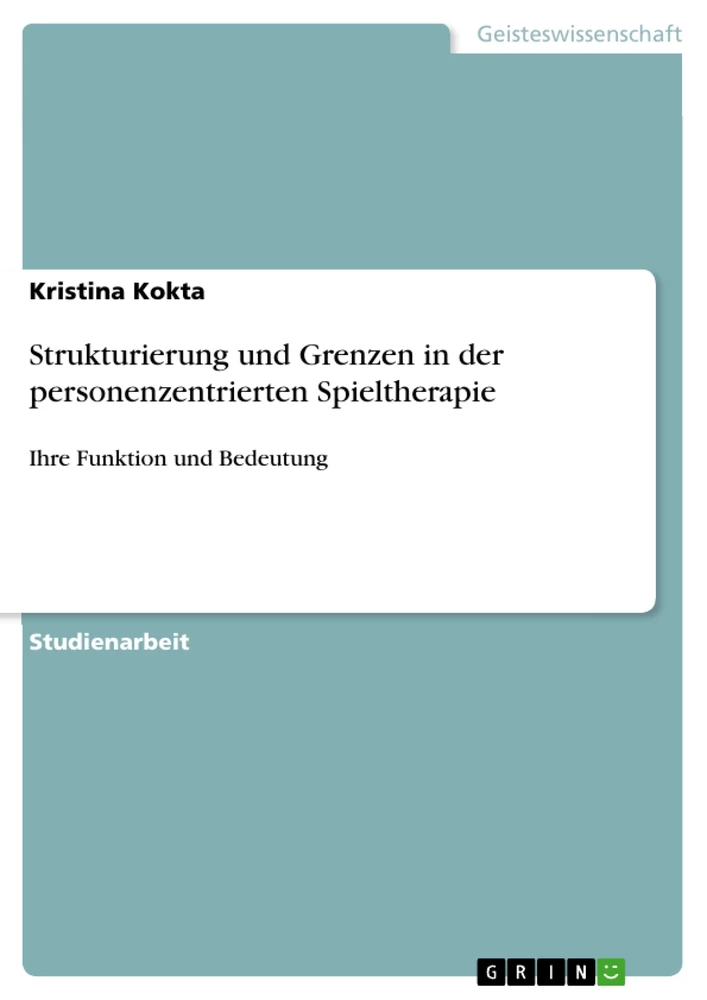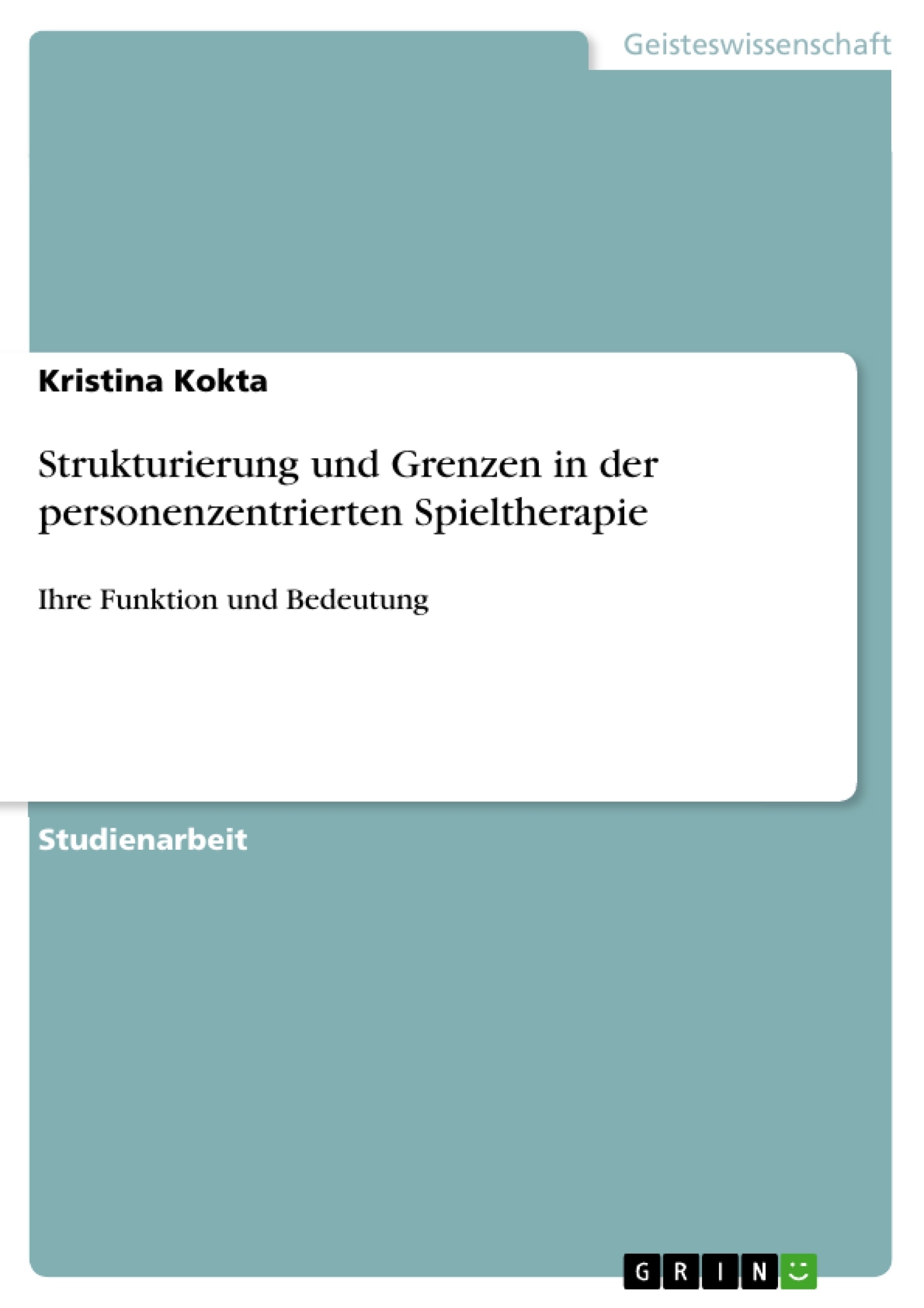Die personenzentrierte Psychotherapie gilt als nicht-direktive Therapieform, in der der Klient den Weg selbst vorgeben kann.
Die personenzentrierte Spieltherapie, die sich primär an Kinder wendet, unterscheidet sich jedoch in Bezug auf ihre Strukturierung und Begrenzung von der ursprünglichen personenzentrierten Erwachsenentherapie.
Die Forschungsfrage dieser Arbeit lautet demzufolge: "An welcher Stelle tauchen Grenzsetzungen sowie klare Strukturierungen in einer personenzentrierten Kinderspieltherapie auf?", "Welche Bedeutung und Notwendigkeit haben diese Rahmenvorgaben, aus welchem Grund erfolgen sie?"
Inhaltsverzeichnis (Table of Contents)
- Einleitung
- 1 Kinderspieltherapie – eine Zusammenschau...
- 1.1 Personenzentrierte Psychotherapie / personenzentrierter Ansatz
- 1.2 Geschichte der Spieltherapie im Allgemeinen
- 1.2.1 Psychoanalytische Spieltherapie.……………...
- 1.2.2 Freisetzende Spieltherapie (Release Play Therapy)
- 1.2.3 Beziehungs-Spieltherapie (Relationship Play Therapy)
- 1.3 Nicht-direktive Spieltherapie
- 1.3.1 Wesensbestimmung
- 1.3.2 Die 8 Prinzipien von Axline
- 1.3.3 Die Rolle des Therapeuten
- 1.4 Aktuelle Entwicklungen
- 1.5 Spezielle Erscheinungsformen
- 1.5.1 Filialtherapie...
- 1.5.2 Gruppenspieltherapie..
- 1.6 Spieltherapeutische Einrichtungen
- 1.7 Studien / Forschungsergebnisse
- 2 Die Strukturierung in der personenzentrierten Spieltherapie..
- 2.1 Ausstattung
- 2.2 Spielarten....
- 2.3 Ablauf
- 2.4 Personenzentrierte Gruppentherapie
- 2.5 Hintergrundinformation / Diagnostik..
- 2.6 Exkurs: Die strukturierte Spieltherapie von Oaklander
- 3 Die Grenzsetzung in der Spieltherapie..
- 3.1 Situationsbezogene Grenzen
- 3.2 Vorgangsweise bei der Grenzsetzung
- 3.3 Interpretationen
- 3.4 Grenzen des Therapeuten
- 3.5 Gruppenspieltherapie
- 3.6 Filialtherapie...
- 4 Zur Bedeutung und Funktion von Rahmenvorgaben, Grenzen und Strukturierung in\nKinderspieltherapien
- 4.1 Realitätsbezug
- 4.2 Vereinfachung der Entscheidungsfindung, Selbstkontrolle und Selbstverantwortung
- 4.3 Verantwortung des Therapeuten .
- 4.4 Aufrechterhaltung der therapeutischen Variablen
- 4.5 Persönliche Grenzen des Therapeuten
- 5 Resumé - persönliche Stellungnahme
- 6 Literaturverzeichnis .
Zielsetzung und Themenschwerpunkte (Objectives and Key Themes)
Die Forschungsarbeit befasst sich mit der Bedeutung von Strukturierung und Grenzsetzung in der personenzentrierten Kinderspieltherapie. Sie untersucht, an welchen Stellen diese Elemente in der Therapie auftauchen und welche Bedeutung sie für den therapeutischen Prozess haben.
- Die Rolle der Strukturierung in der personenzentrierten Spieltherapie
- Die Bedeutung von Grenzsetzung für Kinder in der Therapie
- Der Unterschied zwischen der personenzentrierten Spieltherapie und der traditionellen personenzentrierten Erwachsenentherapie in Bezug auf Strukturierung und Grenzen
- Die Herausforderungen der Grenzsetzung in der Spieltherapie
- Die Notwendigkeit von klaren Rahmenbedingungen in der Spieltherapie
Zusammenfassung der Kapitel (Chapter Summaries)
Das erste Kapitel bietet eine Einführung in die personenzentrierte Kinderspieltherapie. Es beleuchtet die Geschichte dieser Therapieform, ihre wichtigsten Prinzipien und den aktuellen Forschungsstand. Das zweite Kapitel widmet sich der Strukturierung in der personenzentrierten Spieltherapie, inklusive Aspekten wie Ausstattung, Spielarten, Ablauf und Hintergrundinformationen. Das dritte Kapitel behandelt die Thematik der Grenzsetzung, insbesondere die Situationen, in denen sie notwendig sind, die Vorgehensweise bei der Grenzsetzung und die Rolle des Therapeuten.
Schlüsselwörter (Keywords)
Personenzentrierte Spieltherapie, Strukturierung, Grenzsetzung, Kindertherapie, Rahmenbedingungen, therapeutische Beziehung, Spiel, Selbstkontrolle, Selbstverantwortung, therapeutische Variablen.
- Quote paper
- Kristina Kokta (Author), 2010, Strukturierung und Grenzen in der personenzentrierten Spieltherapie, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/169844