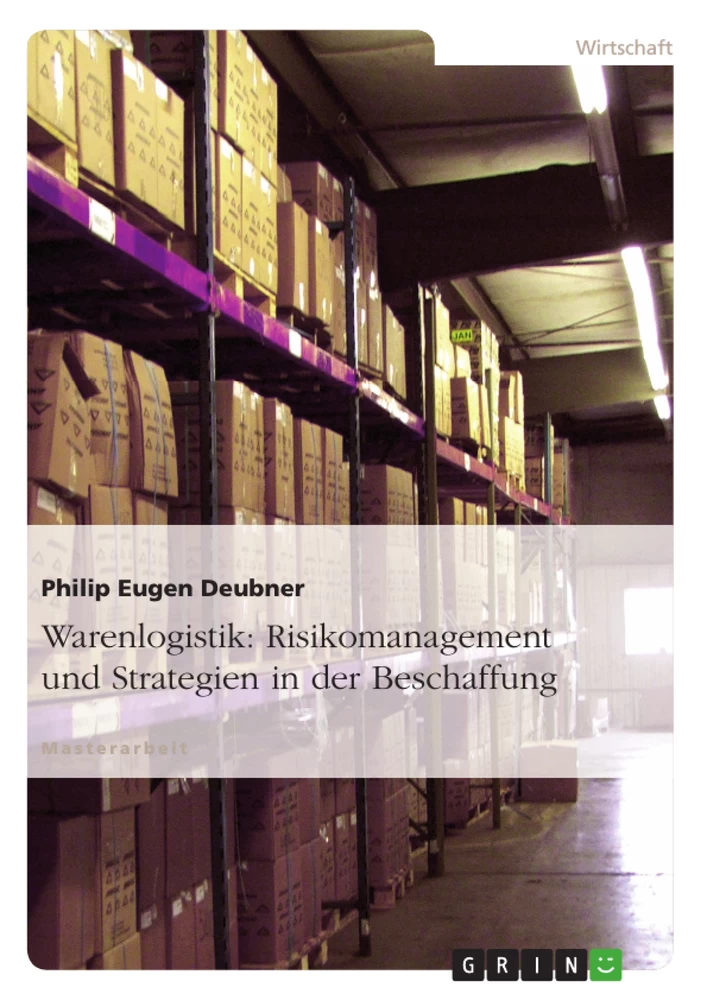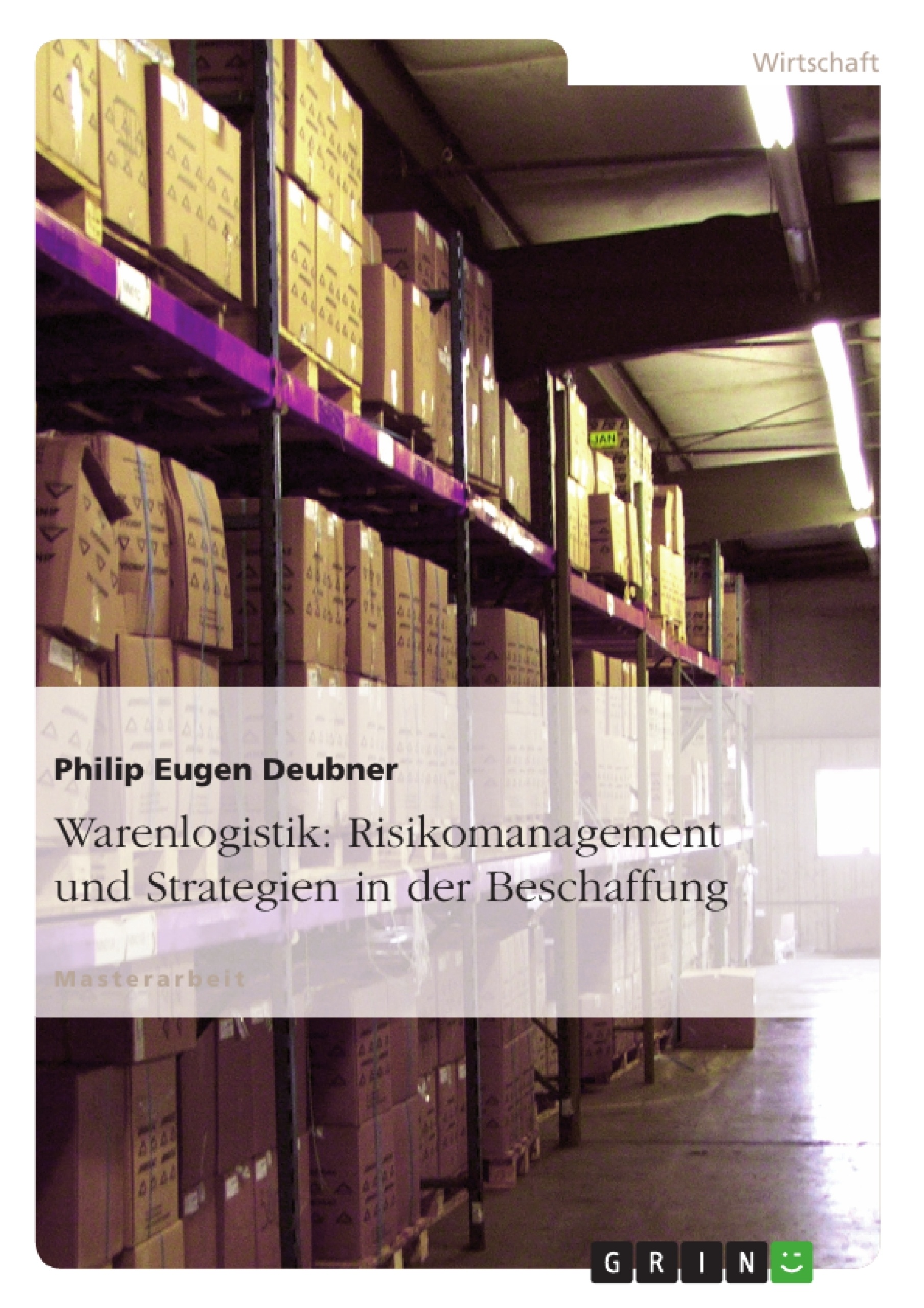Kunden erwarten nicht mehr nur die Eignung eines Produktes, ihr jeweiliges Bedürfnis zu befriedigen, sondern zugleich soll der jeweilige Artikel qualitativ hochwertig und günstig sein sowie zugleich eine hohe Verfügbarkeit aufweisen. Dieses fordert in einer arbeitsteiligen Wirtschaftswelt nicht mehr nur das einzelne Unternehmen, sondern sämtliche an der Produkterstellung beteiligten Unternehmen. Die Erkenntnis, dass der Endkunde, bzw. dessen Wünsche, in das Zentrum der Leistungserstellung rückt, führt dazu, dass nicht mehr nur einzelne Unternehmen miteinander im Wettbewerb stehen, sondern komplette Wertschöpfungsnetzwerke.
Zugleich stehen die beteiligten Unternehmen allerdings auch unter einem hohen Kostendruck. Dieser ist sowohl durch Megatrends wie die Globalisierung, aber auch durch das bereits genannte steigende Kostenbewusstsein des Abnehmers begründet. Betrachtet man lediglich die logistische Seite, so können Kostenersparnisse grundsätzlich in den Bereichen Beschaffung, Produktion und Distribution gehoben werden. Wird nun weiterhin beachtet, dass die Fertigungstiefe innerhalb von Unternehmen stetig abnimmt, so dass beispielsweise die Wertschöpfung der Porsche AG am Geländewagen Cayenne lediglich ca. 11 % beträgt, dann kann aus diesem Umstand die herausragende Bedeutung der Beschaffung für den Gesamterfolg des Unternehmens abgeleitet werden.
Vor diesem Hintergrund wird versucht, die Beschaffung so kosteneffektiv wie möglich zu gestalten. Zugleich stellen jedoch hier denkbare Lösungen, wie die Verringerung der Fertigungstiefe oder die Erschließung von internationalen Lieferquellen gewisse Risiken dar. Damit erscheint es eindeutig, dass die Kenntnis von möglichen Beeinträchtigungen und die Suche nach Handlungsempfehlungen, diesen Herausforderungen zu begegnen, für die wirtschaftliche Zukunft einer Unternehmung von elementarer Bedeutung ist.
Zugleich ist der Beschaffung innerhalb der Unternehmensfunktionen aus den bereits dargelegten Gründen eine gesteigerte Bedeutung beizumessen. Somit wird deutlich, dass ein aktives Management von möglichen Beeinträchtigungen – oder besser Risiken – der Beschaffung von zentraler Bedeutung für jedes Unternehmen ist.
Ziel der vorliegenden Arbeit ist es, mögliche Risiken im Rahmen der Beschaffung zu definieren und zu systematisieren, sowie in einem weiteren Schritt Ansatzpunkte für denkbare Werkzeuge eines Risikomanagements zu entwickeln.
Inhaltsverzeichnis (Table of Contents)
- A. Einleitung
- 1. Problemstellung und Zielsetzung der Arbeit
- II. Gang der Untersuchung
- B. Beschaffung als zentrale Unternehmensschnittstelle
- 1. Begriff der Beschaffung
- II. Ableitung der Beschaffungsziele
- III. Hebelwirkung der Beschaffung
- IV. Die Beschaffungsstrategie
- C. Einführung in das System des Risikomanagement
- 1. Risikobegriff
- II. Risikomanagement
- 1. System des Risikomanagement
- 2. Festlegung einer Risikostrategie
- 3. Einbettung in das Unternehmensrisikomanagement
- 4. Risikoanalyse
- 4.1. Identifizierung von Risiken
- 4.2. Bewertung von Risiken
- 4.3. Aggregation von Risiken
- 5. Steuerung von Risiken
- 6. Überwachung von Risiken
- 7. Risikodokumentation
- 8. Zusammenfassung der bisherigen theoretischen Erfordernisse
- D. Ansätze einer Risikoidentifizierung durch Risikosystematisierung
- 1. Bedarf der Systematisierung
- II. Erarbeitung eines möglichen Vorgehens
- III. Risikotreiber
- 1. Definition
- 2. Trend zu internationalen Wertschöpfungsnetzwerken
- 3. Lean-Management
- 4. Target-Costing
- 5. Mass Customization
- 6. Produktlebenszyklus
- IV. Anwendung der Methodik
- 1. Kostenrisiken
- 2. Qualitätsrisiken
- 3. Sicherheitsrisiken
- 4. Unabhängigkeits- und Flexibilitätsrisiken
- 5. Bedarf eines Frühwarnsystems
- E. Instrumente des Risikomanagement
- 1. Erfordernis eines einheitlichen Werkzeugkastens
- II. Das Lieferantenmanagement als zentrales Risikoinstrument der Beschaffung
- III. Bewertung
- 1. Gewährleistung der Objektivität
- 2. Schadenseintritt
- 3. Schadensausmaβ
- 4. Risikoinventar
- IV. Aggregation
- V. Steuerung
- 1. Auswirkungen von Unternehmensstrategien
- 2. Vermeidung
- 3. Verringerung
- 4. Steuerungsentscheidung
- 5. Übertragung
- 6. Übernahme
- 7. Diversifikation
- VI. Überwachung
- VII. Dokumentation
- F. Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte (Objectives and Key Themes)
Die vorliegende Masterthesis befasst sich mit dem Thema Risikomanagement in der Beschaffung. Ziel ist es, die Bedeutung des Risikomanagements für die Beschaffung zu beleuchten und ein praxisnahes Vorgehen zur Identifizierung, Bewertung und Steuerung von Beschaffungsrisiken zu entwickeln. Die Arbeit soll einen Beitrag zur Optimierung der Beschaffungsprozesse im Hinblick auf die Minimierung von Risiken leisten.
- Risikomanagement in der Beschaffung
- Identifizierung und Bewertung von Beschaffungsrisiken
- Steuerung von Beschaffungsrisiken
- Einfluss von Risikotreibern auf die Beschaffung
- Entwicklung eines praxisnahen Vorgehensmodells für das Risikomanagement in der Beschaffung
Zusammenfassung der Kapitel (Chapter Summaries)
Die Einleitung führt in das Thema Risikomanagement in der Beschaffung ein und definiert die Problemstellung sowie die Zielsetzung der Arbeit. Kapitel B beleuchtet die Beschaffung als zentrale Unternehmensschnittstelle und beleuchtet die Bedeutung der Beschaffungsziele und die Hebelwirkung der Beschaffung. In Kapitel C wird das System des Risikomanagements vorgestellt, einschließlich der Definition des Risikobegriffs, der Festlegung einer Risikostrategie und der Einbettung in das Unternehmensrisikomanagement. Die Risikoanalyse wird in diesem Kapitel ebenfalls behandelt, mit Schwerpunkten auf der Identifizierung und Bewertung von Risiken sowie der Aggregation von Einzelrisiken. Kapitel D beschäftigt sich mit Ansätzen zur Risikoidentifizierung durch Risikosystematisierung, indem es die Bedeutung einer systematischen Vorgehensweise und die Rolle von Risikotreibern wie internationalen Wertschöpfungsnetzwerken, Lean-Management und Target-Costing beleuchtet. Die Anwendung der Methodik wird anhand von Beispielen für Kostenrisiken, Qualitätsrisiken und Sicherheitsrisiken erläutert. In Kapitel E werden Instrumente des Risikomanagements vorgestellt, darunter das Lieferantenmanagement als zentrales Instrument zur Steuerung von Beschaffungsrisiken. Die Bewertung von Risiken, die Aggregation von Einzelrisiken sowie die Steuerung von Risiken durch verschiedene Maßnahmen werden im Detail behandelt.
Schlüsselwörter (Keywords)
Die Arbeit fokussiert auf das Risikomanagement in der Beschaffung, insbesondere auf die Identifizierung und Bewertung von Beschaffungsrisiken, die Entwicklung eines systematischen Vorgehensmodells zur Risikosteuerung und die Anwendung von Instrumenten wie dem Lieferantenmanagement. Weitere wichtige Begriffe sind Risikotreiber, internationale Wertschöpfungsnetzwerke, Lean-Management, Target-Costing und Mass Customization.
Häufig gestellte Fragen
Warum ist Risikomanagement in der Beschaffung heute so wichtig?
Durch sinkende Fertigungstiefen und globale Lieferketten hängt der Unternehmenserfolg massiv von der Zuverlässigkeit und Effizienz der Beschaffung ab.
Was versteht man unter der Hebelwirkung der Beschaffung?
Kostenersparnisse in der Beschaffung wirken sich direkt und überproportional auf den Gewinn eines Unternehmens aus, da der Materialkostenanteil oft sehr hoch ist.
Welche Risikotreiber beeinflussen die moderne Warenlogistik?
Wichtige Treiber sind Globalisierung, Lean-Management, Target-Costing, Mass Customization und verkürzte Produktlebenszyklen.
Wie werden Beschaffungsrisiken bewertet?
Risiken werden primär nach ihrer Eintrittswahrscheinlichkeit und dem potenziellen Schadensausmaß beurteilt.
Welche Rolle spielt das Lieferantenmanagement beim Risikomanagement?
Es dient als zentrales Instrument, um Lieferantenausfälle zu vermeiden, Qualitäten zu sichern und Abhängigkeiten durch Diversifikation zu steuern.
- Quote paper
- Dipl.-Kfm., M. Sc. Philip Eugen Deubner (Author), 2011, Warenlogistik: Risikomanagement und Strategien in der Beschaffung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/169919