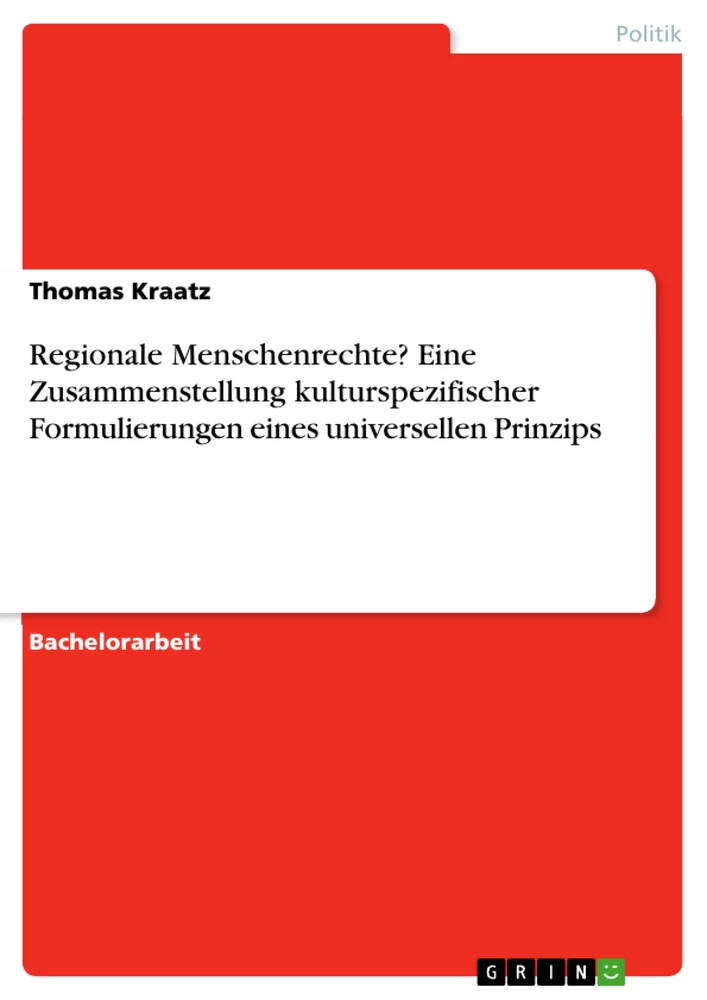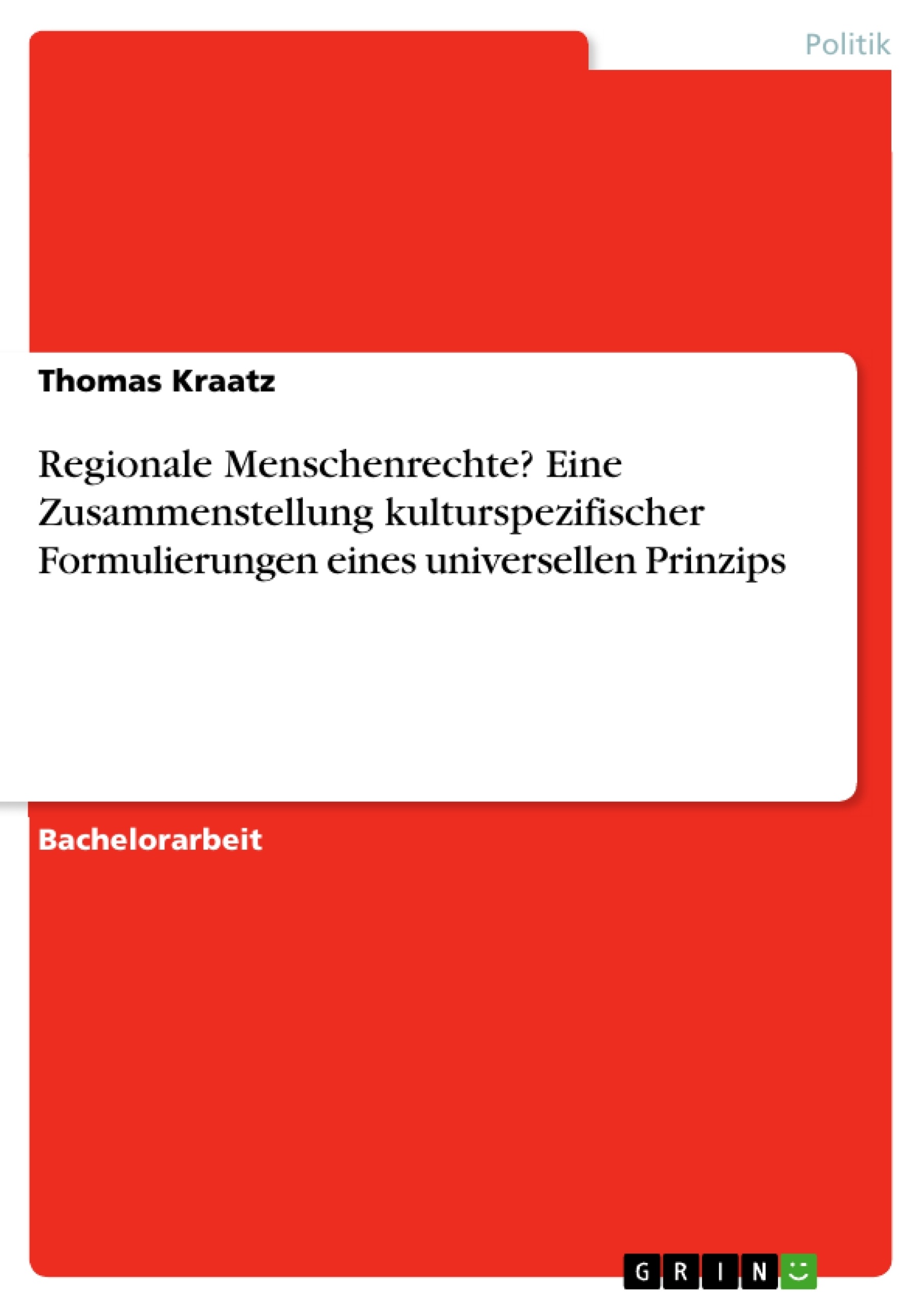Haben Menschenrechte geistesgeschichtliche Wurzeln in allen großen Kulturen der Erde, oder sind sie nur ein spezifisch westliches Konstrukt?
In seiner Bachelorarbeit klärt der Autor diese Frage, indem er sowohl Rechtsdokumente, als auch Religionen und Philosophien des Westens und des Ostens vorstellt und miteinander in Beziehung setzt. Dabei stellt sich heraus, dass das Prinzip der Menschenrechte universell ist.
Im zweiten Kapitel werden zunächst die Genese und erste Dokumente des Menschenrechts im Westen vorgestellt. Die Verbindung mit dem Naturrecht und die individualistische Auffassung stellen sich dabei als besondere Merkmale heraus.
Im Gegensatz dazu weisen die im dritten Kapitel untersuchten Rechtsdokumente Asiens und Afrikas mehr Kollektivrechte und Pflichten auf. Dennoch lassen sich viele Übereinstimmungen, vor allem zur Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte, finden.
Im Zwischenfazit wird festgehalten, dass alle Erklärungen einen mehr oder minder starken Mangel an der Durchsetzung aufweisen. Daher haben diese Texte eher moralische als praktische Bedeutung, was nicht unbedingt negativ zu werten sein muss.
Die im dritten Kapitel aufgefundenen Unterschiede werden im vierten Kapitel auf ihre Ursachen hin untersucht. Hier werden Ansätze des Menschenrechts im Hinduismus, Buddhismus, Taoismus, Konfuzianismus und im Islam gesucht. In den ersten beiden Religionen lassen sich viele Ansätze finden, was der Offenheit und dem humanistischen Anspruch zuzuschreiben ist. Die chinesischen Konzepte sind zwar sehr gemeinschaftszentriert, was so stark im Westen nicht vorkommt, dennoch sind bspw. die konfuzianische Idee der Mitmenschlichkeit und die Bedeutung des Einzelnen als Teil der Gesellschaft elementare Voraussetzungen für die Idee des Menschenrechts. Der Islam hat zwar eine stark exklusive Komponente, weist aber innerhalb der umma (musl. Gemeinschaft) Ansätze des Menschenrechts auf. Hier wird festgestellt, dass es einer "islamischen Aufklärung" bedarf.
Im Fazit wird dargelegt, dass das Menschenrecht in allen Kulturen vorkommt. Der Autor plädiert dafür, die Unterschiede als mögliche Ergänzungen zu verstehen, um den kulturell geprägten eigenen Standpunkt zu erweitern. Anstatt sich voneinander abzugrenzen ist es nötig und möglich, voneinander zu lernen.
Inhaltsverzeichnis (Table of Contents)
- 1. Einleitung
- 1.1 Vorgehen und Ziele der Arbeit
- 1.2 Präzisierung der Fragestellung
- 2. Geschichte des MR im westlichen Kulturkreis
- 2.1 Entstehung des MR aus dem System des NR
- 2.2 Grundlagen und erste Dokumente
- 2.3 Die Positivierung des MR im 20. Jahrhundert
- 2.3.1 Die allgemeine Erklärung der Menschenrechte
- 2.3.2 Die europäische Menschenrechtskonvention
- 2.3.3 Die amerikanische Menschenrechtskonvention
- 3. MR-Dokumente außerhalb der westlichen Kultur
- 3.1 Banjul-Charta
- 3.2 MR in der islamischen Welt
- 3.3 Bangkok-Deklaration (1993)
- 4. Anknüpfungen in asiatischer Philosophie und Religion
- 4.1 Vorbemerkungen
- 4.2 Hinduismus
- 4.3 Buddhismus
- 4.4 Daoismus
- 4.5 Konfuzianismus
- 4.6 Islam
- 5. Fazit - regionale Menschenrechte!
Zielsetzung und Themenschwerpunkte (Objectives and Key Themes)
Diese Bachelorarbeit untersucht die Frage, ob Menschenrechte (MR) universell oder kulturspezifisch sind. Sie analysiert die historischen Wurzeln des MR-Konzepts im Westen und setzt diese in Relation zu anderen Kulturkreisen, insbesondere Asien und der islamischen Welt. Das Ziel ist, eine Synthese zwischen den unterschiedlichen globalen Formulierungen des MR und dem Anspruch auf Universalität zu finden.
- Die Entwicklung des MR-Konzepts aus der Tradition des Naturrechts (NR)
- Vergleichende Analyse von MR-Dokumenten im Westen und in anderen Kulturkreisen
- Die Suche nach Ansätzen des MR in asiatischen Religionen und Philosophien
- Die Frage nach der Universalität von MR angesichts kultureller Unterschiede
- Die Relevanz von kulturellen Eigenheiten für die Gestaltung von MR
Zusammenfassung der Kapitel (Chapter Summaries)
Das erste Kapitel führt in die Fragestellung ein und erläutert das Vorgehen der Arbeit. Es wird die Problematik des westlichen Konzepts des MR und die Behauptung der Universalität thematisiert. Das zweite Kapitel beleuchtet die Entstehung des MR-Konzepts aus der Tradition des NR-Denkens im Westen und stellt die wichtigsten historischen Dokumente vor. Das dritte Kapitel untersucht MR-Dokumente außerhalb des westlichen Kulturkreises, darunter die Banjul-Charta, MR in der islamischen Welt und die Bangkok-Deklaration.
Schlüsselwörter (Keywords)
Menschenrechte, Naturrecht, Universalität, Kulturalität, Kulturvergleich, Asien, Islam, Philosophie, Religion, Hinduismus, Buddhismus, Daoismus, Konfuzianismus, Banjul-Charta, Bangkok-Deklaration
Häufig gestellte Fragen
Sind Menschenrechte eine rein westliche Erfindung?
Die Arbeit argumentiert, dass das Prinzip der Menschenrechte universell ist, aber in verschiedenen Kulturen (Westen, Asien, Afrika) unterschiedliche geistesgeschichtliche Wurzeln und Formulierungen hat.
Was ist das Besondere am westlichen Menschenrechtsverständnis?
Es ist stark durch das Naturrecht und eine individualistische Auffassung geprägt, bei der die Rechte des Einzelnen gegenüber dem Staat im Vordergrund stehen.
Wie unterscheiden sich asiatische und afrikanische Menschenrechtsdokumente?
Dokumente wie die Banjul-Charta oder die Bangkok-Deklaration betonen oft stärker Kollektivrechte, die Gemeinschaft und die Pflichten des Einzelnen gegenüber der Gesellschaft.
Gibt es Ansätze für Menschenrechte im Islam?
Ja, innerhalb der muslimischen Gemeinschaft (Umma) gibt es Konzepte von Gerechtigkeit und Schutzrechten, wobei die Arbeit die Notwendigkeit einer „islamischen Aufklärung“ diskutiert.
Was ist die Banjul-Charta?
Die Banjul-Charta ist die Afrikanische Charta der Menschenrechte und der Rechte der Völker, die universelle Rechte mit spezifisch afrikanischen Werten und Traditionen verbindet.
- Quote paper
- Bachelor of Arts Thomas Kraatz (Author), 2010, Regionale Menschenrechte? Eine Zusammenstellung kulturspezifischer Formulierungen eines universellen Prinzips, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/169940