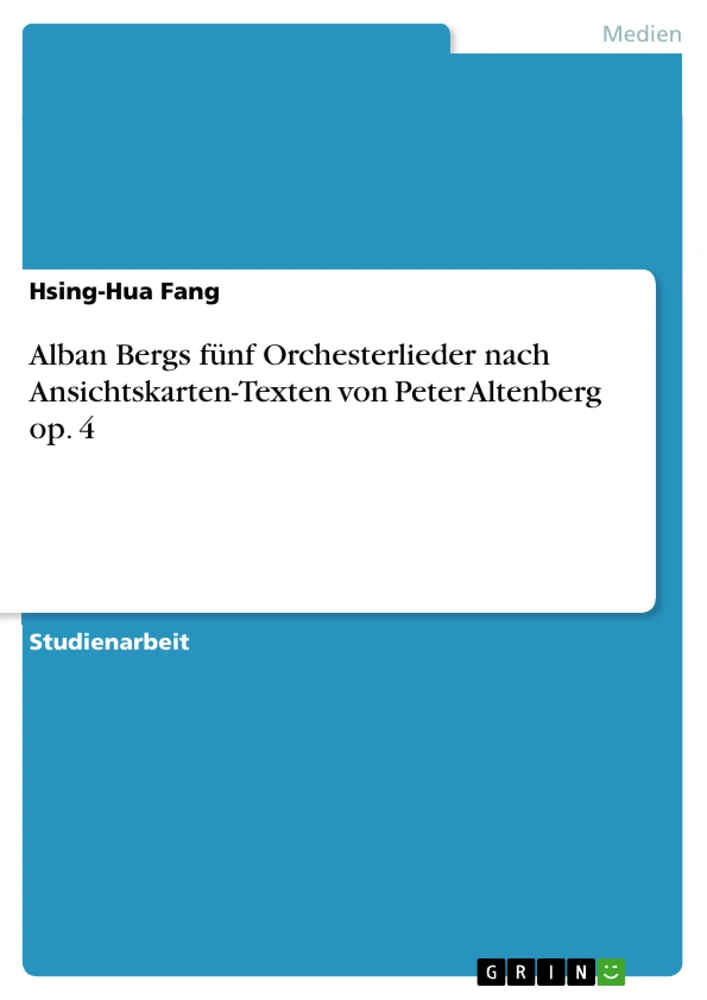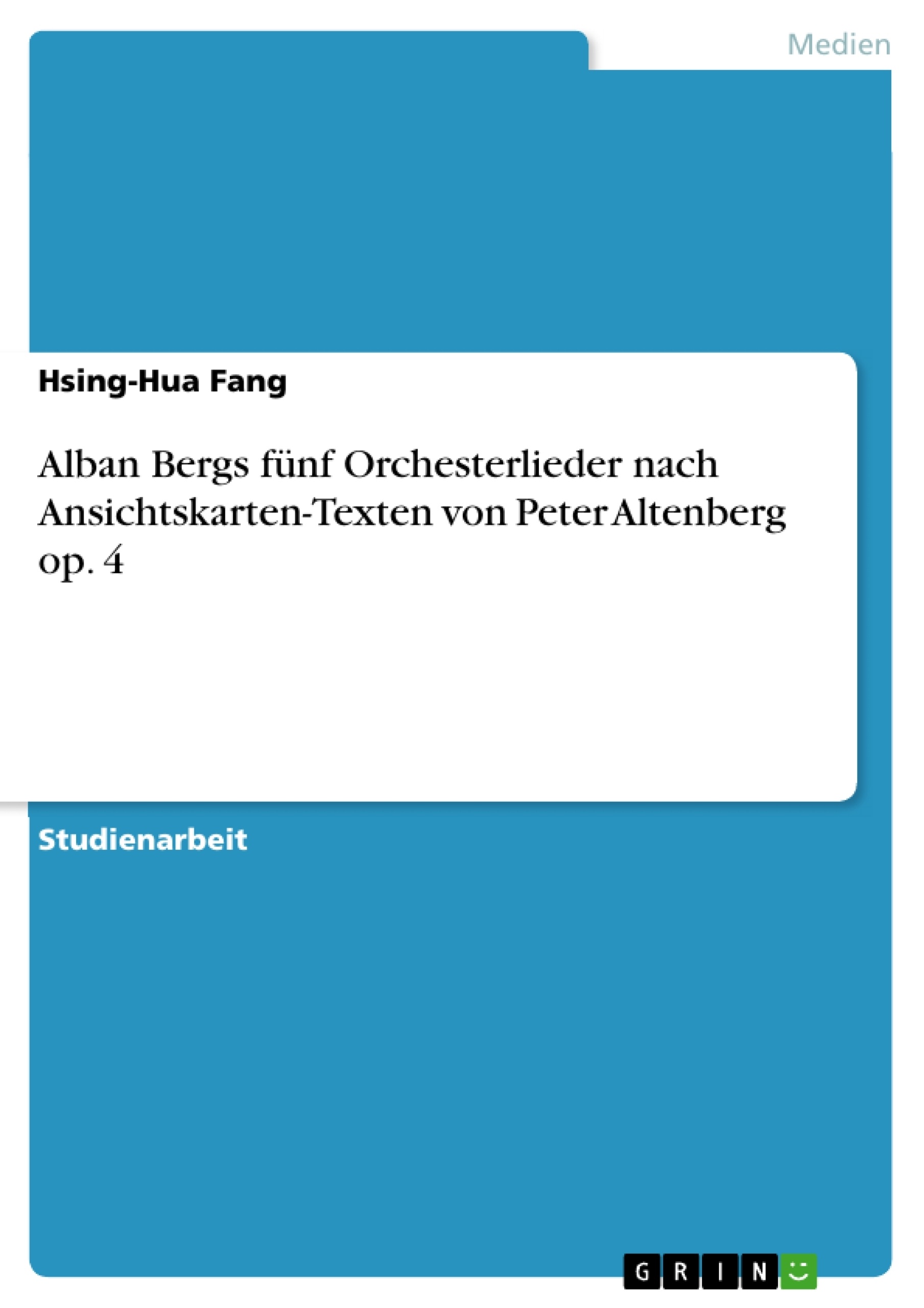Die Altenberg-Lieder, der richtige Titel „Fünf Orchesterlieder nach Ansichtskarten-Texten
von Peter Altenberg op. 4“, entstand im Jahre 1912. Sie sind Bergs erste völlig eigenständige
Kompositionen und auch sein erstes Orchesterwerk nach Abschluss seiner Studien bei
Schönberg. Die Idee dieser Komposition kommt teilweise aus Schönberg. Schönberg hat in
einem Brief an Berg vom 13. Januar 1912 geschrieben: „Warum schreiben Sie nichts! Sie
sollten Ihr Talent nicht solange rasten lassen. Schreiben Sie doch ein paar Lieder wenigstens.
Es ist gut sich von Gedichten wieder in die Musik einführen zu lassen. Aber dann: einmal was
für Orchester.“ Berg nimmt die fünf Ansichtskarten-Texte von Peter Altenberg, die 1911 in
einem Band mit dem Titel „Neues Altes“ veröffentlicht wurden. Die Dichtungen waren Bergs
Frau Helene gewidmet. Altenberg bleibt bis seinen Tod 1919 mit Berg und Bergs Frau
befreundet.
Inhaltsverzeichnis
- I. Alban Bergs Leben – Eine Übersicht
- II. Peter Altenbergs Leben – Eine Übersicht
- III. Die Entstehungsgeschichte der Altenberg-Lieder
- IV. Musikalische Analyse der Altenberg-Lieder von Alban Berg
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Dieses Arbeitspapier befasst sich mit den fünf Orchesterliedern nach Ansichtskarten-Texten von Peter Altenberg op. 4 von Alban Berg. Es bietet eine umfassende Übersicht über das Leben und Werk der beiden Künstler sowie die Entstehungsgeschichte und musikalische Analyse der Altenberg-Lieder.
- Alban Bergs Leben und Schaffen
- Peter Altenbergs Leben und Werk
- Die Entstehung der Altenberg-Lieder
- Die musikalische Analyse der einzelnen Lieder
- Die Bedeutung der Altenberg-Lieder in Bergs Werk
Zusammenfassung der Kapitel
I. Alban Bergs Leben – Eine Übersicht
Dieser Abschnitt bietet eine kurze Biografie von Alban Berg, beleuchtet seine musikalische Ausbildung und seine frühen Kompositionen. Er beschreibt die Freundschaft zu Arnold Schönberg und Anton von Webern und stellt die Entstehung der ersten Werke Bergs dar.
II. Peter Altenbergs Leben – Eine Übersicht
Dieser Abschnitt präsentiert eine Biografie von Peter Altenberg, seinem literarischen Schaffen und seinen Beziehungen zu anderen Künstlern. Er schildert Altenbergs schwieriges Leben und seine psychischen Probleme, die schließlich zu seinem frühen Tod führten.
III. Die Entstehungsgeschichte der Altenberg-Lieder
Dieser Abschnitt erläutert die Entstehung der Altenberg-Lieder, beschreibt die Auswahl der Texte und die Inspiration durch Arnold Schönberg. Es beleuchtet die Komposition der Lieder und die Reaktionen von Schönberg auf das Werk.
IV. Musikalische Analyse der Altenberg-Lieder von Alban Berg
Dieser Abschnitt analysiert die einzelnen Altenberg-Lieder, die musikalische Struktur, die Verwendung von Motiven und die Beziehung von Musik und Text. Er untersucht die Verwendung von Zwölftontechnik und die Bedeutung der Orchesterbegleitung.
Schlüsselwörter
Alban Berg, Peter Altenberg, Orchesterlieder, Ansichtskarten-Texte, Musikalische Analyse, Zwölftontechnik, Schönberg, Webern, Wien, Expressionismus, Moderne Musik.
Häufig gestellte Fragen
Was sind die "Altenberg-Lieder" von Alban Berg?
Es handelt sich um die "Fünf Orchesterlieder nach Ansichtskarten-Texten von Peter Altenberg op. 4", Bergs erstes eigenständiges Orchesterwerk aus dem Jahr 1912.
Wer war Peter Altenberg?
Peter Altenberg war ein Wiener Dichter der Moderne, bekannt für seine kurzen Prosatexte und Skizzen, die oft auf Ansichtskarten geschrieben wurden.
Welchen Einfluss hatte Arnold Schönberg auf dieses Werk?
Schönberg war Bergs Lehrer und ermutigte ihn in einem Brief dazu, nach seinem Studium Lieder und schließlich auch Orchesterwerke zu komponieren.
Wird in den Altenberg-Liedern die Zwölftontechnik verwendet?
Die Lieder markieren einen Übergang in Bergs Schaffen und enthalten bereits frühe Ansätze serieller Strukturen und komplexer motivischer Arbeit.
An wen waren die Dichtungen ursprünglich gewidmet?
Die von Berg vertonten Texte aus dem Band "Neues Altes" waren ursprünglich Bergs Frau Helene gewidmet.
- Citar trabajo
- Hsing-Hua Fang (Autor), 2001, Alban Bergs fünf Orchesterlieder nach Ansichtskarten-Texten von Peter Altenberg op. 4, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/169999