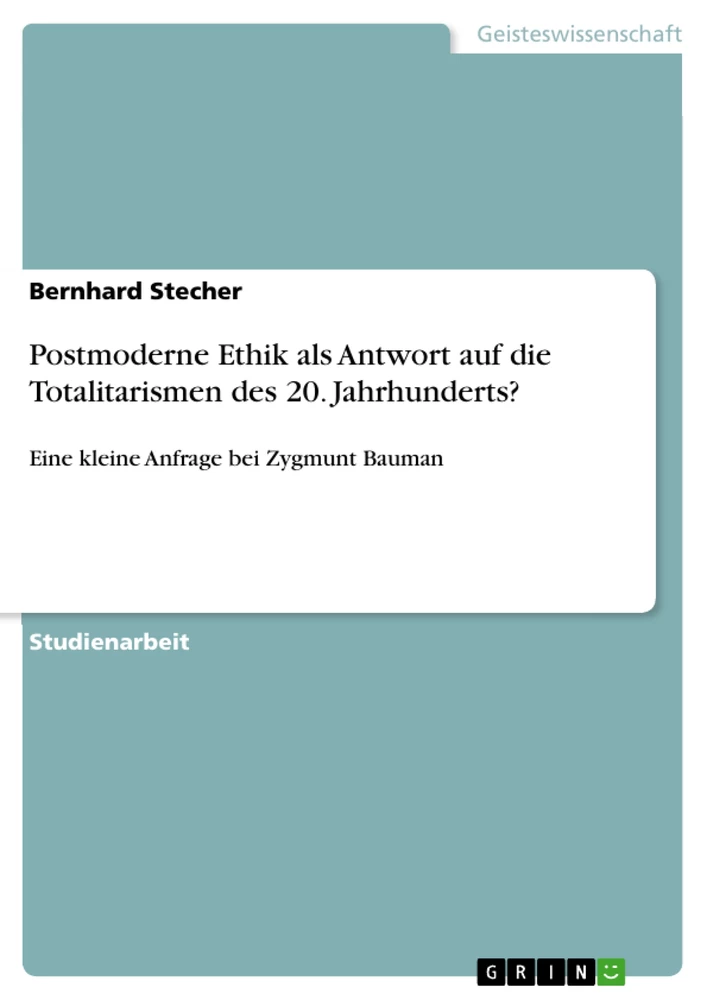Die Auseinandersetzung mit den Ursachen und Determinanten für die Entstehung von totalitären Herrschaftssystemen im 20. Jahrhundert ist eines der zentralen Themen mit denen sich die wissenschaftlichen Arbeiten des polnisch-englischen Soziologen Zygmunt Bauman beschäftigen. In diesem Kontext vertritt er die These, dass die totalitären Exzesse keine Atavismen waren, sondern im Projekt
der Moderne – mit ihrem rationalen Anspruch auf Universalität, Homogenität, Gleichförmigkeit und Transparenz – tief verwurzelt sind. Mithilfe dieser Prinzipien sollte der Makel der Ambivalenz und der permanenten Unsicher- und Ungewissheit beseitigt und damit die Lücke geschlossen werden, welche die Aufklärung durch die „Entmachtung Gottes“ erzeugte, ohne jedoch die Grundannahme zu verändern, wonach unkontrollierte Freiheit zwangsläufig in
Zügellosigkeit und Chaos mündet. Spätestens mit dem Scheitern der
sozialistischen Herrschaftssysteme in Osteuropa sind diese
Begründungszusammenhänge jedoch obsolet und durch neue normative
Bezugspunkte, die eine postmoderne Perspektive ermöglichte bzw. hervorbrachte, diskreditiert worden. Diese „neue Sichtweise“ stellt der Eindeutigkeit und dem Ordnungspostulat der Moderne die „Bürde“ der Ambivalenz und Kontingenz gegenüber, welche die Chance auf eine Revitalisierung der moralischen Befähigung der Menschen mit sich bringt.
Im Rahmen der vorliegenden Arbeit werden die Chancen und Risiken im Hinblick auf eine Wiederentdeckung und -belebung der Moral aus einer postmodernen Perspektive aufgezeigt, wie sie Zygmunt Bauman in seinem Buch „Postmoderne Ethik“ entwickelt und darlegt.
Inhaltsverzeichnis (Table of Contents)
- Einleitung
- Ausgangspunkt und Erkenntnisinteresse
- Das zwangslaufige Scheitern der Moralkonzeption der Moderne
- Universalität
- (Letzt)begründung
- Sozialisierung
- Sozialität
- Moderne Technik
- Postmoderne Ethik als adaquate Antwort auf die totalitaren Exzesse?
- Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte (Objectives and Key Themes)
Diese Arbeit untersucht das Scheitern der Moralkonzeption der Moderne und die Frage, ob die Postmoderne eine adäquate Antwort auf die totalitären Exzesse der Moderne bietet.
- Das Scheitern der Universalität moderner Moralkonzepte
- Die Problematik der (Letzt)begründung in der Moderne
- Die Rolle von Sozialisierung und Sozialität in der modernen Moral
- Der Einfluss von moderner Technik auf die Moral
- Die postmoderne Kritik an den totalitären Exzessen der Moderne
Zusammenfassung der Kapitel (Chapter Summaries)
- Die Einleitung stellt den Ausgangspunkt und das Erkenntnisinteresse der Arbeit dar. Sie skizziert die Problematik des Scheiterns der Moralkonzeption der Moderne.
- Das zweite Kapitel analysiert die Schwächen der Moralkonzeption der Moderne, insbesondere im Hinblick auf Universalität, (Letzt)begründung, Sozialisierung, Sozialität und den Einfluss moderner Technik.
- Das dritte Kapitel befasst sich mit der postmoderne Ethik und ihrer Kritik an den totalitären Exzessen der Moderne.
Schlüsselwörter (Keywords)
Die zentralen Begriffe dieser Arbeit sind: Moralkonzeption der Moderne, Universalität, (Letzt)begründung, Sozialisierung, Sozialität, moderne Technik, Postmoderne, totalitäre Exzesse, Ethik.
Häufig gestellte Fragen
Warum scheiterte die Moralkonzeption der Moderne laut Zygmunt Bauman?
Sie scheiterte an ihrem rationalen Anspruch auf Universalität und Homogenität, der versuchte, Ambivalenz und Unsicherheit gewaltsam zu beseitigen.
Wie hängen Moderne und Totalitarismus zusammen?
Bauman vertritt die These, dass totalitäre Exzesse tief im Projekt der Moderne verwurzelt sind, da diese nach absoluter Transparenz und Ordnung strebt.
Was bietet die postmoderne Ethik als Alternative an?
Sie stellt dem Ordnungspostulat die 'Bürde' der Ambivalenz und Kontingenz gegenüber, was eine Revitalisierung der individuellen moralischen Befähigung ermöglicht.
Welchen Einfluss hat moderne Technik auf die Moral?
Die Arbeit untersucht, wie technische Rationalität in der Moderne moralische Bedenken oft verdrängt oder instrumentalisiert hat.
Was bedeutet 'Entmachtung Gottes' im Kontext der Aufklärung?
Es beschreibt die Lücke, die entstand, als religiöse Begründungsmuster wegfielen und die Moderne versuchte, diese durch universelle Vernunftregeln zu füllen.
Gibt es Risiken bei der Wiederentdeckung der Moral in der Postmoderne?
Ja, die Arbeit beleuchtet sowohl die Chancen als auch die Risiken, die mit dem Wegfall fester normativer Bezugspunkte verbunden sind.
- Quote paper
- Bernhard Stecher (Author), 2007, Postmoderne Ethik als Antwort auf die Totalitarismen des 20. Jahrhunderts?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/170010