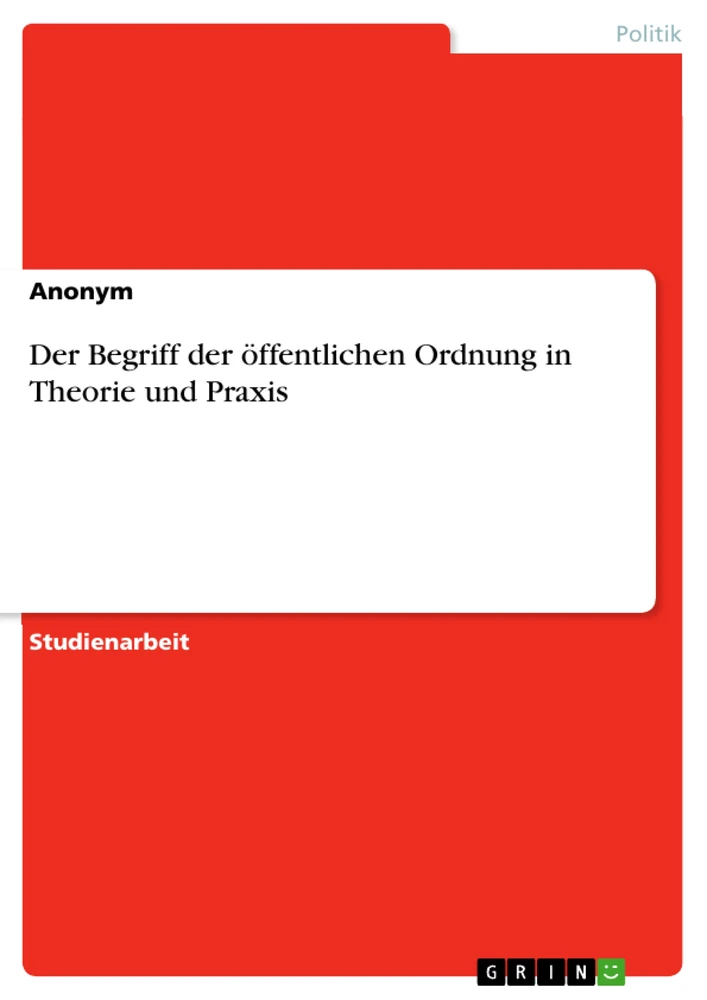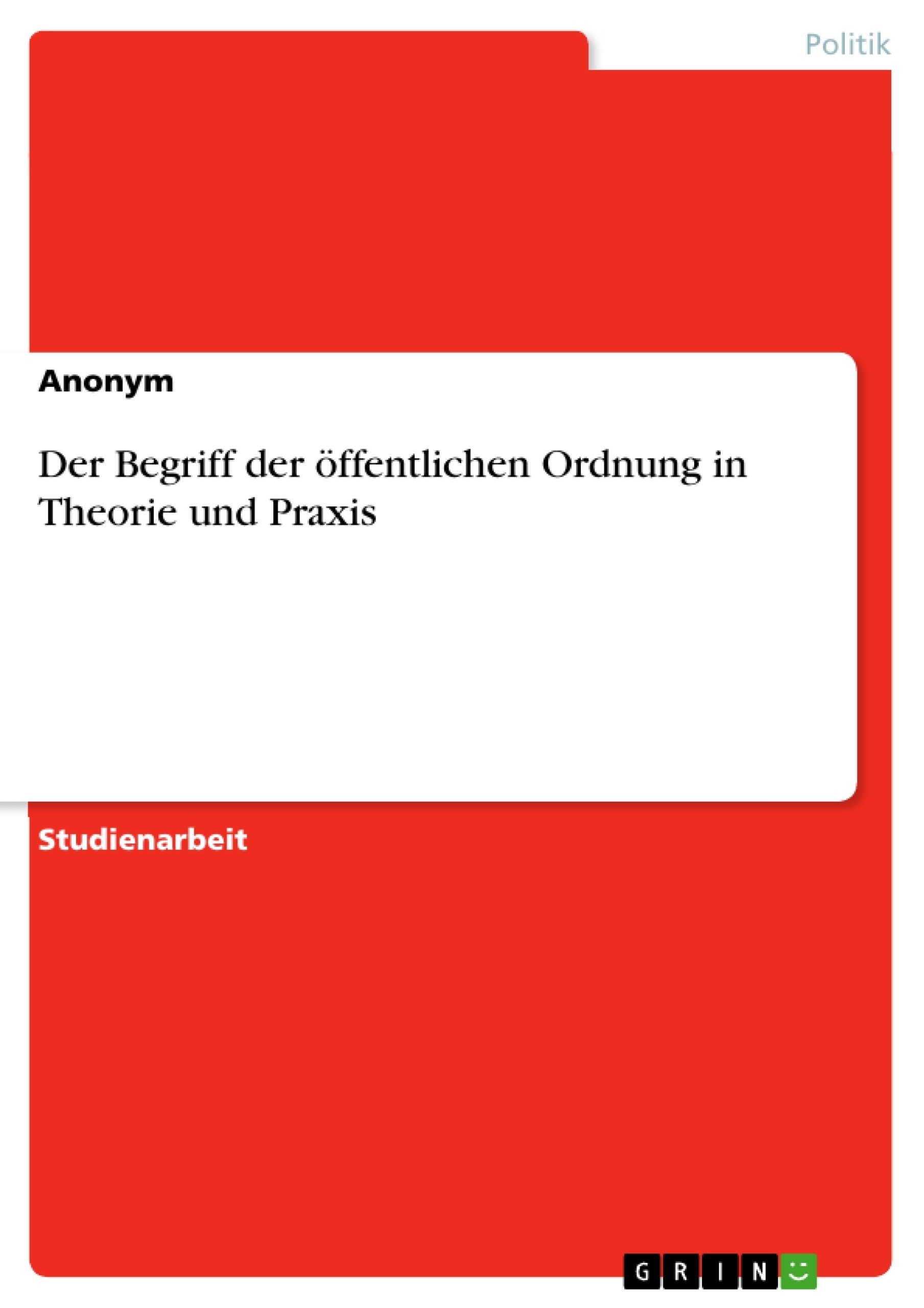Der Grundsatz Prävention vor Repression und der Grundsatz der Subsidiarität spannen ein sich stetig wandelndes Feld auf, um vor allem ortsbezogene Sicherheitsvorsorge adäquat und flexibel zu gewährleisten.
Bürgerbefragungen haben ergeben, dass die Angst vor „klassischen Straftaten“ kleiner ist, als die Abneigung gegenüber „sichtbaren Zeichen“ abweichenden Verhaltens - wie Verwahrlosung, Lärm, Belästigung, Bettelei, Graffiti, Unsauberkeit etc.2 Diese stellen allein noch kein kriminalisierendes Verhalten dar und sind somit durch gesetzlich normierte Wertvorstellungen nicht handhabbar. Die Sicherheit in einer Stadt bestimmt wesentlich die Lebensqualität der Bürgerinnen und Bürger.3
Wie kann diesen sich wandelnden Sicherheitsbedürfnissen gegenüber reagiert werden? Wie lässt sich die Bedürfnisanalyse, also das Verorten von akzeptablen und nichtakzeptablen Verhalten innerhalb der kommunalen Gemeinschaft, bewerkstelligen und welche Möglichkeiten bzw. Handlungsalternativen lassen sich aus der staatsrechtlichen Praxis ableiten?
Hier kristallisiert sich vor allem der Begriff der öffentlichen Ordnung i.V.m. dem Begriff der öffentlichen Sicherheit heraus - beide sowohl in den Polizeigesetzen der meisten Ländern aber auch im Grundgesetz verankert und für die thematische Betrachtung äußerst fruchtbar.
Der oben beschriebene Sachverhalt soll dabei als thematisches Gerüst dienen, an denen sich polizei- und ordnungsrechtliche Begriffsbestimmungen und innerstädtische Problemstellungen im Bezug auf „unakzeptables“ Verhalten in der Öffentlichkeit abarbeiten. Rechtliche Grundlage bietet dabei das Polizei- und Ordnungsrecht, in kleinen Teilen das Straßenrecht sowie die verfassungsmäßige Grundordnung der BRD. Im Ergebnis sollen Aussagen über den heutigen Stellenwert der „öffentliche Ordnung“ in der verfassungs- und staatsrechtlichen Praxis herausgearbeitet werden und die Möglichkeiten durchleuchtet werden, das subjektive Sicherheitsgefühl der Bürger v.a. in den Innenstädten zu verbessern.
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung: Kriminalitätsfurcht – Begriff im Wandel?
- II. Die Schutzgüter öffentliche Sicherheit und öffentliche Ordnung
- 1. Die polizei- und ordnungsbehördlichen Generalklauseln
- 2. Der Begriff der öffentlichen Sicherheit
- 3. Das Schutzgut der öffentlichen Ordnung
- a) Die Entwicklung des Schutzgutes der öffentlichen Ordnung
- b) Der Inhalt des Begriffs der öffentlichen Ordnung
- c) tradiertes vs. „modernes“ Begriffsverständnis
- d) Die verfassungsrechtliche Notwendigkeit des Schutzgutes der öffentlichen Ordnung
- e) Die Grundrechte als Abwehrrechte und als staatliche Schutzpflicht
- f) Das Grundrecht auf Sicherheit nach Isensee
- g) Die öffentliche Ordnung als Garant für die Gewährleistung bestmöglicher Sicherheit?
- 4. Die aggressive Bettelei als Verstoß gegen die öffentliche Ordnung?
- a) Der Begriff aggressive Bettelei
- b) Die Ermittlung einer entsprechenden Sozialnorm am Beispiel der aggressiven Bettelei
- c) Die Ermittlung einer eventuell herrschenden Sozialnorm
- d) Verstoß der herrschenden Sozialnorm gegen Art. 2 Abs. 1 GG?
- e) Besteht bei aggressiver Bettelei eine Gefahr für polizeiliche Schutzgüter?
- 5. Weiter Tatbeständen i.V.m. dem Schutzgut der öffentlichen Ordnung
- 6. Das Sexualitätsverständnis als Beispiel für die Wandelbarkeit des Begriffs der öffentlichen Ordnung
- 7. Fazit
- III. ziviles Ungehorsam – Hindernis Mehrheitsprinzip?
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit beschäftigt sich mit dem Begriff der öffentlichen Ordnung und seinem Wandel im Kontext der aktuellen gesellschaftlichen Entwicklungen. Ziel ist es, die theoretischen Grundlagen und die praktische Relevanz des Begriffs zu beleuchten, insbesondere im Hinblick auf die polizeiliche Praxis und die Gewährleistung des subjektiven Sicherheitsempfindens der Bürger.
- Entwicklung des Begriffs der öffentlichen Ordnung und seine verfassungsrechtliche Grundlage
- Abgrenzung des Schutzgutes der öffentlichen Ordnung von der öffentlichen Sicherheit
- Analyse von Tatbeständen, die als Verstoß gegen die öffentliche Ordnung gelten, insbesondere die aggressive Bettelei
- Der Wandel des Begriffs im Kontext der sich ändernden gesellschaftlichen Wertvorstellungen
- Die Rolle des zivilen Ungehorsams als Mittel zur Veränderung der öffentlichen Ordnung
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel widmet sich der Einleitung und stellt den Begriff der Kriminalitätsfurcht in den Kontext der sich wandelnden Sicherheitsbedürfnisse der Bürger. Es wird auf die Bedeutung der öffentlichen Ordnung in der Praxis kommunaler Politik hingewiesen.
Im zweiten Kapitel werden die Schutzgüter der öffentlichen Sicherheit und der öffentlichen Ordnung analysiert. Es werden die polizei- und ordnungsbehördlichen Generalklauseln erläutert und die Unterschiede und Überschneidungen zwischen den beiden Schutzgütern beleuchtet. Die Entwicklung des Begriffs der öffentlichen Ordnung wird historisch dargestellt und das Verhältnis des Schutzgutes zu den Grundrechten erörtert.
Kapitel drei befasst sich mit dem Tatbestand der aggressiven Bettelei als Beispiel für einen Verstoß gegen die öffentliche Ordnung. Die Definition des Begriffs wird erörtert und die Ermittlung einer entsprechenden Sozialnorm analysiert. Die Abwägung zwischen dem Grundrecht auf freie Entfaltung der Persönlichkeit und dem Recht auf Schutz vor Belästigung wird diskutiert.
Das vierte Kapitel stellt weitere Tatbestände vor, die im Zusammenhang mit dem Schutzgut der öffentlichen Ordnung relevant sind, wie beispielsweise der Alkoholkonsum in der Öffentlichkeit oder das Nächtigen auf Straßen. Der Wandel des Begriffs der öffentlichen Ordnung im Kontext des sich verändernden Sexualitätsverständnisses wird anhand von Beispielen verdeutlicht.
Im fünften Kapitel wird die Theorie des zivilen Ungehorsams von John Rawls vorgestellt und auf die Problematik der vermeintlich bindenden Sozialnormen, welche unter das Schutzgut der öffentlichen Ordnung fallen, angewendet. Es wird diskutiert, ob man sich den Mehrheitsbeschlüssen unterordnen muss oder ob es legitime Mittel gibt, um auf vermeintliche Missstände aufmerksam zu machen.
Schlüsselwörter
Öffentliche Ordnung, öffentliche Sicherheit, polizeiliche Generalklausel, Sozialnormen, Mehrheitsauffassung, Grundrechte, aggressive Bettelei, ziviler Ungehorsam, „zero-tolerance“-Politik, Kriminalitätsfurcht, subjektives Sicherheitsempfinden.
- Arbeit zitieren
- Anonym (Autor:in), 2007, Der Begriff der öffentlichen Ordnung in Theorie und Praxis, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/170015