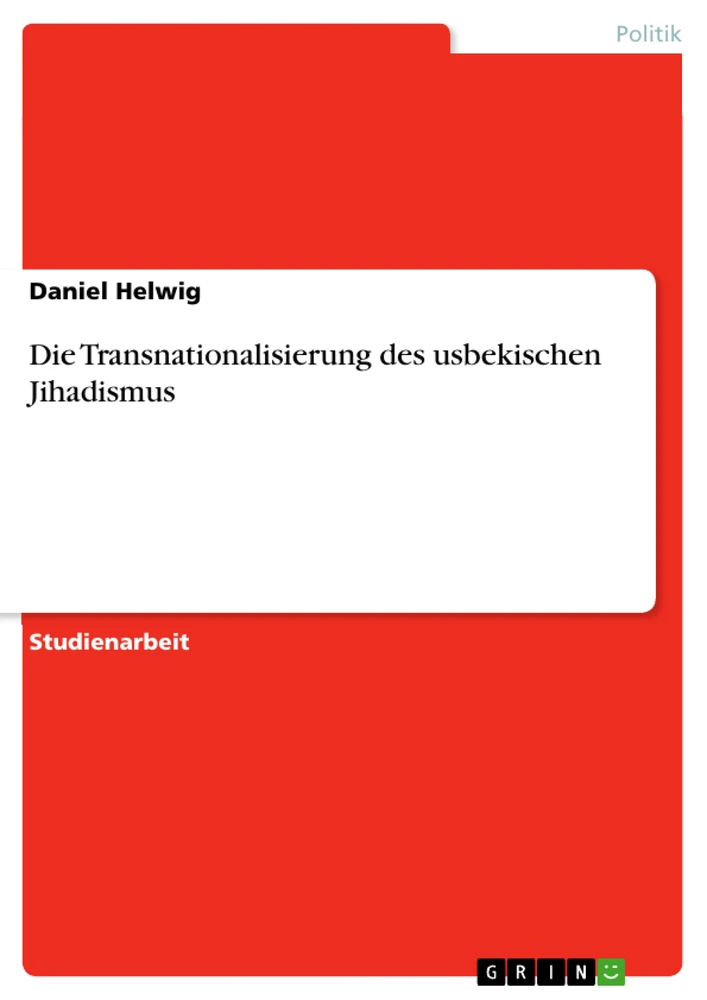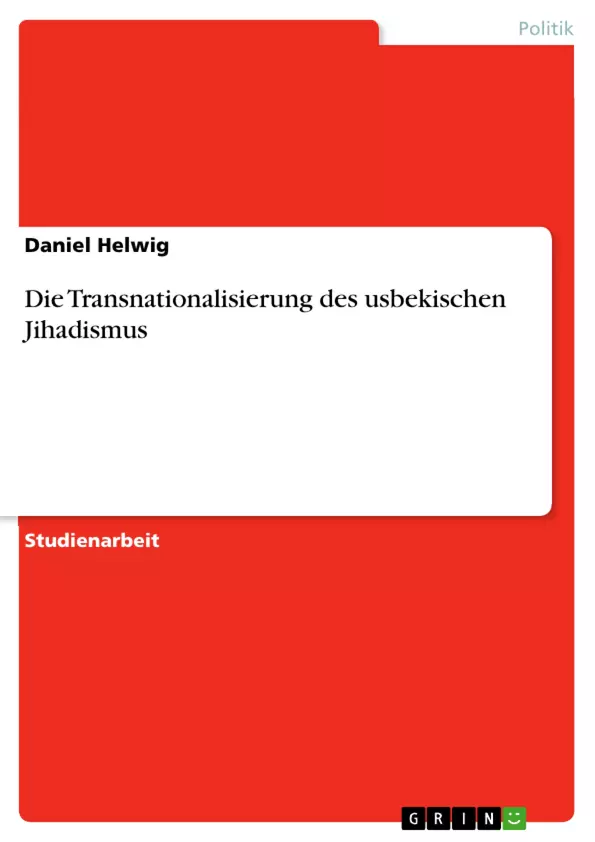Ziel dieser Arbeit ist, zu zeigen, dass gut begründbar von einer Transnationalisierung des religiös motivierten usbekischen Terrorismus die Rede sein kann. Hierzu wird zunächst die theoretische Konzeption des transnationalen Terrorismus näher vorgestellt. Die zentralen Charakteristika dieses „neuen Terrorismus“, prototypisch verkörpert durch das islamistische Terrornetzwerk al-Qaida, werden in Abgrenzung zu „herkömmlichen“ Formen von Terrorismus erläutert und als Analysehilfsmittel greifbar gemacht. Anhand der herausgestellten
Merkmale, wird im Weiteren der usbekische Jihadismus auf die Ausprägung dieser zentralen Wesenszüge des transnationalen Terrorismus untersucht. Hierzu wird innerhalb der einzelnen Merkmale chronologisch vorgegangen. Vom Aufkommen der islamistischen Bewegung „Adolat“ zu Beginn der 90er Jahre, bis zur „modernen“ Erscheinung der IJU, wird die Entwicklung der Ausprägung der einzelnen Merkmale zugänglich gemacht. Es wird argumentiert, dass der usbekische Jihadismus erst mit Auftreten der IJU eine Komponente aufweist, welche den theoretischen Annahmen des transnationalen Terrorismus vollständig entspricht.
Zwar zeigt schon die IBU im Laufe ihrer Geschichte deutliche Anzeichen einer Internationalisierung, doch die Spezifika in Agenda, Ideologie, Mitgliederstruktur und Vernetzungsgrad mit anderen Gruppen werden erst durch die IJU zu Beispielen für die empirische Haltbarkeit der Annahmen über Charakteristika des transnationalen Terrorismus.
Inhaltsverzeichnis
I. Veränderungen im usbekischen Jihadismus
II. Transnationaler Terrorismus
II.1 - Internationale Agenda
II.2 - Transnationale Ideologie
II.3 - Multinationale Mitgliedschaft
II.4 - Vernetzung und Zusammenarbeit einzelner Gruppen
III. Die Entwicklung der militanten Jihad-Bewegung Usbekistans
III.1 - Agenda
III.2 - Ideologie
III.3 - Mitgliedschaft
III.4 - Zusammenarbeit mit anderen Gruppen
IV. Einordnung in das Konzept „Transnationaler Terrorismus“
Literaturverzeichnis
Häufig gestellte Fragen
Was bedeutet "Transnationalisierung" im Kontext des usbekischen Jihadismus?
Es beschreibt den Wandel von einer lokal begrenzten Bewegung hin zu einer global vernetzten Ideologie mit internationaler Agenda und multinationalen Mitgliedern.
Was ist der Unterschied zwischen der IBU und der IJU?
Die IBU (Islamische Bewegung Usbekistans) war primär auf Zentralasien fokussiert; die IJU (Islamische Jihad Union) agiert global und ist eng mit al-Qaida vernetzt.
Welche Rolle spielt al-Qaida für usbekische Terrorgruppen?
Al-Qaida dient als ideologisches Vorbild und bietet logistische Unterstützung sowie Ausbildungslager, was die globale Ausrichtung der usbekischen Gruppen verstärkt.
Wie hat sich die Ideologie dieser Gruppen über die Zeit verändert?
Sie entwickelte sich von rein nationalistischen Zielen (Sturz des Karimov-Regimes) hin zum globalen Jihad gegen den Westen.
Was kennzeichnet "neuen Terrorismus"?
Merkmale sind eine dezentrale Struktur, eine religiös motivierte, grenzüberschreitende Agenda und die Nutzung moderner Kommunikationstechnologien zur Rekrutierung.
- Quote paper
- Daniel Helwig (Author), 2010, Die Transnationalisierung des usbekischen Jihadismus, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/170023