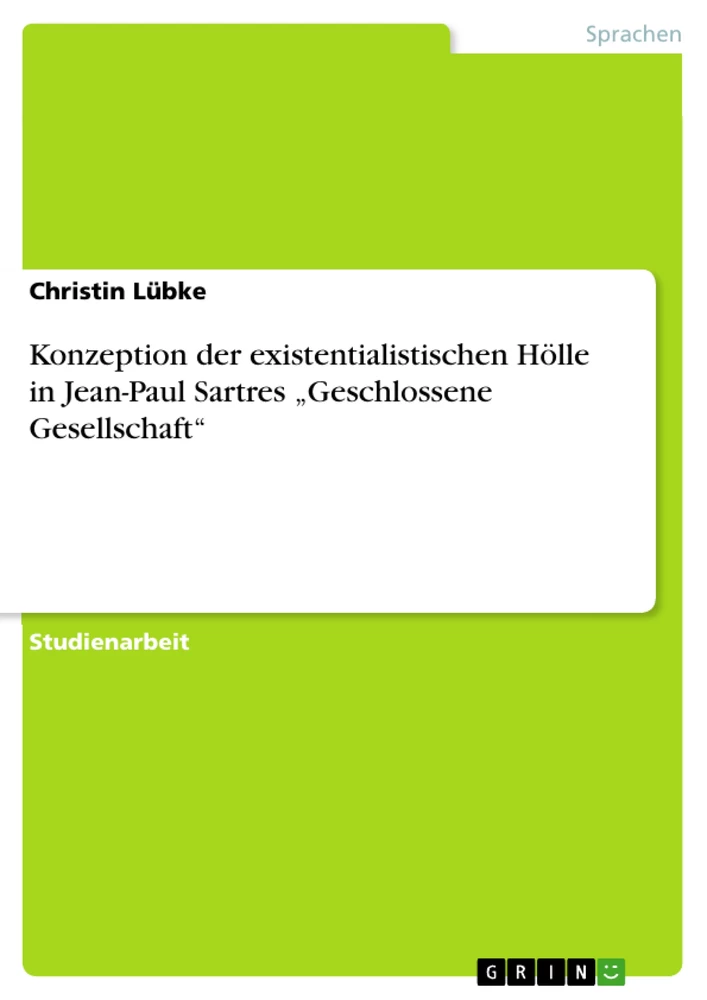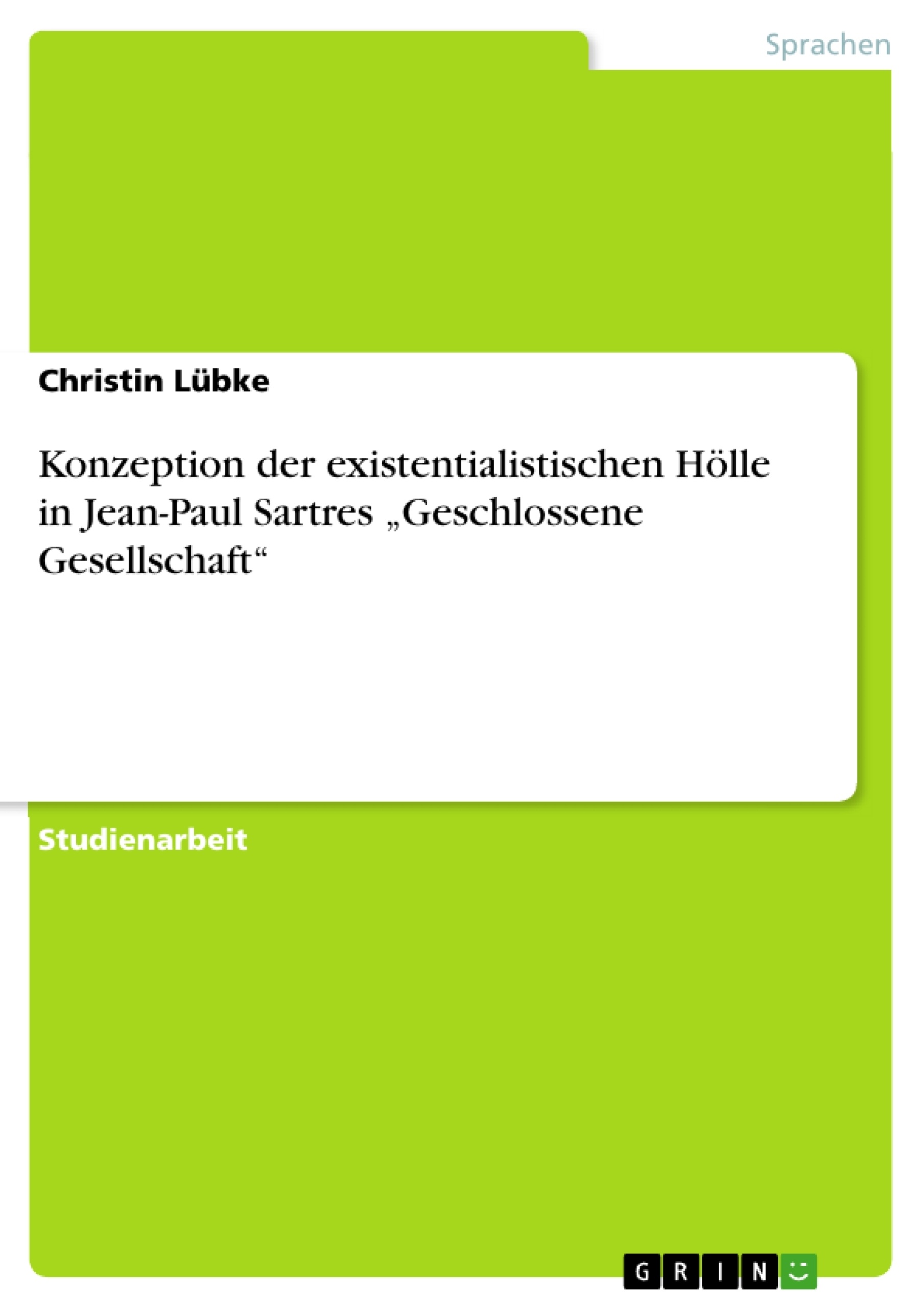Für die Nachkriegsgeneration stellte Jean-Paul Sartre eine Kultfigur dar. Er repräsentierte die Auflehnung gegen gesellschaftliche Konventionen und verhärtete Denkmuster und gilt als Vorreiter und Hauptvertreter des Existentialismus, sowie als einer der wichtigsten Intellektuellen des 20. Jahrhunderts in Frankreich. In seinen dramatischen Werken verwirklichte Sartre einige wichtige Elemente seiner existentialistischen Philosophie. So auch in dem Einakter Huis clos (1944), welcher einen der ersten Höhepunkte seines dramatischen Schaffens markierte und der vorliegenden Arbeit zugrunde liegt.
Huis clos handelt von drei sich vollkommen unbekannten Personen, die jeweils nacheinander von einem Kellner in einen Raum geführt werden und dort für immer bleiben. Das ist die Hölle! Warum eigentlich? Diese Frage möchte ich im Folgenden versuchen zu klären und somit die Grundzüge der existentialistischen Hölle Sartres aufdecken.
Um verstehen zu können, wie die Hölle Sartres funktioniert, konzentriere ich mich zunächst auf die Rahmenbedingungen des Dramas. Es werden der Ort des Geschehens, sowie die verschiedenen Charaktere beleuchtet. Bei der Figurencharakteristik lege ich einen besonderen Schwerpunkt auf die Entwicklung der Personen im Verlauf des Stückes, indem schrittweise ihr wahres Wesen zum Vorschein kommt. Anschließend möchte ich einige Elemente des Existentialismus Sartres herausarbeiten, welche die Ursache für die Höllenqualen darstellen. In diesem Sinne gehe ich zunächst auf die Abhängigkeit von den anderen ein, ihre gegenseitigen Blicke und die Funktion des Spiegels, danach komme ich auf die Unaufrichtigkeit zu sprechen. Am Schluss möchte ich den Gegensatz von erstarrten Gewohnheiten und der Freiheit aufzeigen.
Inhaltsverzeichnis (Table of Contents)
- Einleitung
- Die existentialistische Hölle
- Schauplatz - Hölle
- Figurencharakteristik
- Joseph Garcin
- Inés Serrano
- Estelle Rigault
- Elemente des Existentialismus in Huis clos
- Die Abhängigkeit von den anderen
- Blicke und Spiegel
- Die Unwahrhaftigkeit (mauvaise foi)
- Gewohnheit vs. Freiheit
- Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte (Objectives and Key Themes)
Diese Arbeit untersucht die Konzeption der existentialistischen Hölle in Jean-Paul Sartres Einakter Huis clos (1944). Dabei wird der Fokus auf die Rahmenbedingungen des Dramas gelegt, insbesondere auf den Ort des Geschehens und die Charakterentwicklung der Figuren. Die Analyse betrachtet außerdem wichtige Elemente des Existentialismus, die zu den Höllenqualen der Figuren beitragen, wie beispielsweise die Abhängigkeit von anderen, das Spiel der Blicke und die Unwahrhaftigkeit.
- Die Konzeption der Hölle in Sartres Huis clos
- Die Bedeutung der Figurencharakteristik und deren Entwicklung
- Die Rolle des Existentialismus in der Gestaltung der Hölle
- Die Abhängigkeit von anderen und das Spiel der Blicke
- Die Unwahrhaftigkeit als Ursache für die Höllenqualen
Zusammenfassung der Kapitel (Chapter Summaries)
- Einleitung: Diese Einleitung führt in das Thema der Arbeit ein, indem sie den Kontext des Existentialismus und Sartres Werk Huis clos beleuchtet. Sie skizziert die zentralen Aspekte, die im weiteren Verlauf der Arbeit behandelt werden, und stellt die Forschungsfrage nach der Grundzüge der existentialistischen Hölle Sartres.
- Die existentialistische Hölle: Dieser Abschnitt beleuchtet die Konzeption der Hölle in Huis clos. Zunächst wird der Schauplatz, ein geschmacklos eingerichteter Salon, beschrieben. Dann werden die Charaktere vorgestellt, die in diese Hölle geschickt werden. Dabei wird betont, dass die Hölle Sartres nicht durch körperliche Folter, sondern durch die unaufhaltsame Konfrontation mit anderen geprägt ist.
- Schauplatz - Hölle: Dieser Teil beschreibt den Salon, in dem das Drama spielt. Dabei wird gezeigt, wie die Einrichtung und die fehlenden Möglichkeiten der Gefangenen, sich abzuschließen oder zu entkommen, zum Zustand der Qual beitragen.
- Figurencharakteristik: Hier werden die Figuren des Dramas, Joseph Garcin, Inés Serrano und Estelle Rigault, vorgestellt. Ihre Lebensgeschichten und ihre Motivationen werden betrachtet, und es wird hervorgehoben, dass sie alle Antihelden sind, die durch ihre eigenen Taten in die Hölle gelangt sind.
- Joseph Garcin: Dieser Unterabschnitt gibt einen Einblick in die Figur des Joseph Garcin, einem Journalisten, der während des Krieges erschossen wurde. Es wird gezeigt, dass er unter Selbstzweifeln und Unsicherheit leidet, die sich in seinem Verhalten äußern.
Schlüsselwörter (Keywords)
Die Arbeit beschäftigt sich mit den zentralen Themen des Existentialismus, insbesondere mit der Abhängigkeit von anderen, dem Spiel der Blicke, der Unwahrhaftigkeit und der Freiheit. Sie beleuchtet die Konzeption der Hölle in Sartres Huis clos als einen Ort der ständigen Konfrontation und des Mangels an Privatsphäre. Die Analyse der Figurencharakteristik konzentriert sich auf die Entwicklung der Personen im Laufe des Dramas und auf die Frage, wie sie mit ihrem eigenen Sein und den anderen Figuren umgehen.
Häufig gestellte Fragen
Was bedeutet Sartres berühmter Satz „Die Hölle, das sind die anderen“?
In Huis clos ist die Hölle kein Ort physischer Folter, sondern die unaufhörliche Konfrontation mit den Urteilen und Blicken der Mitmenschen.
Was ist „Unwahrhaftigkeit“ (mauvaise foi) bei Sartre?
Es beschreibt den Versuch des Menschen, seine eigene Freiheit zu verleugnen und sich hinter Rollen oder Ausreden zu verstecken.
Welche Funktion hat der Spiegel im Drama?
Das Fehlen von Spiegeln zwingt die Charaktere dazu, sich nur durch die Augen der anderen wahrzunehmen, was ihre Abhängigkeit verstärkt.
Wer sind die drei Hauptfiguren in „Geschlossene Gesellschaft“?
Es handelt sich um Joseph Garcin, Inés Serrano und Estelle Rigault – drei „Antihelden“, die durch ihre Taten in der Hölle gelandet sind.
Wie stehen Freiheit und erstarrte Gewohnheiten im Gegensatz?
Die Figuren sind in ihren Taten der Vergangenheit erstarrt und haben im Jenseits die Freiheit verloren, sich durch neues Handeln zu definieren.
- Quote paper
- Christin Lübke (Author), 2010, Konzeption der existentialistischen Hölle in Jean-Paul Sartres „Geschlossene Gesellschaft“ , Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/170028