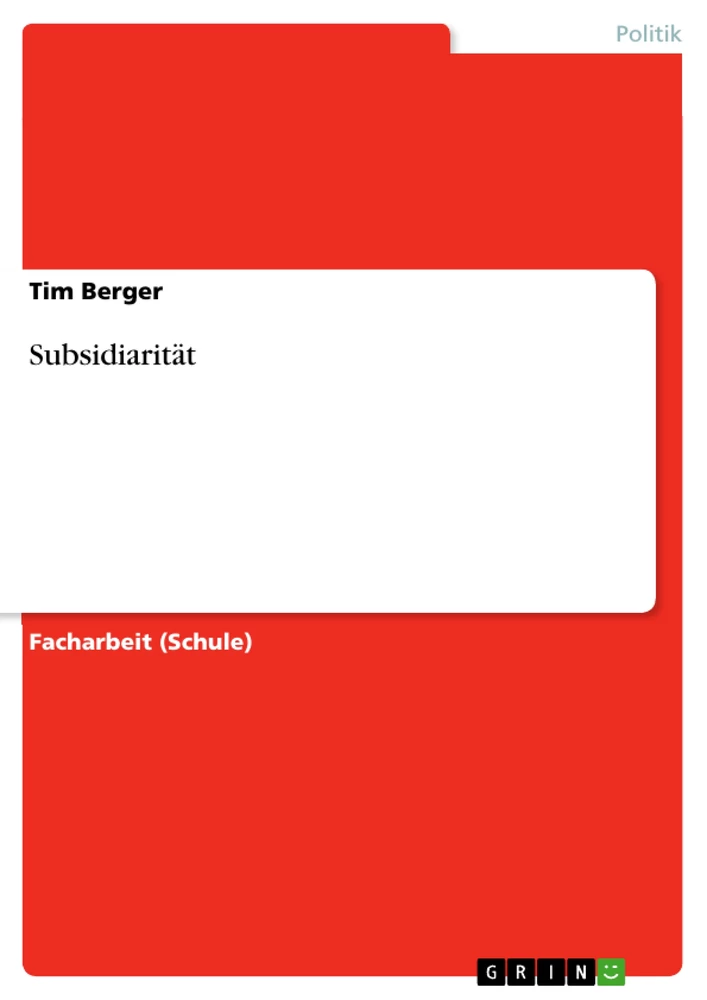Die folgende Facharbeit beschäftigt sich mit dem Begriff der Subsidiarität. Der Grundgedanke der Subsidiarität in Europa lautet: „Das Subsidiaritätsprinzip in Europa hat die Aufgabe, als Ordnungsprinzip die Kompetenzabgrenzung zwischen der Europäischen Union, den Mitgliedstaaten und den Ländern bzw. Regionen zu gewährleisten. Somit ist die Subsidiarität ein Garant für ein bürgernahes Europa.“ Ich versuche diesen Grundgedanken während meiner Facharbeit kurz und bündig zu erklären.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Subsidiarität
- 2.1 Definition und Herkunft
- 2.2 Ziele des Subsidiaritätsprinzips
- 2.3 Die positive und die negative Seite des Subsidiaritätsprinzips
- 2.4 Anwendungsbereiche der Subsidiarität
- 3. Subsidiaritätsprinzip in den europäischen Verträgen
- 3.1 Verträge und Verpflichtungen
- 3.2 Reichweite des Subsidiaritätsprinzips
- 3.3 Neuerungen durch den Vertrag von Amsterdam
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Facharbeit untersucht den Begriff der Subsidiarität, seine Ursprünge und seine Anwendung, insbesondere im Kontext der Europäischen Union. Das Ziel ist es, den Grundgedanken der Subsidiarität zu erklären und seine Bedeutung für die Kompetenzabgrenzung zwischen verschiedenen Ebenen der europäischen und nationalen Verwaltung zu verdeutlichen.
- Definition und historische Entwicklung des Subsidiaritätsprinzips
- Ziele und Funktionen des Subsidiaritätsprinzips
- Positive und negative Aspekte des Subsidiaritätsprinzips
- Anwendungsbereiche des Subsidiaritätsprinzips auf verschiedenen Ebenen
- Verankerung des Subsidiaritätsprinzips in europäischen Verträgen
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema Subsidiarität ein und skizziert den Fokus der Facharbeit: die Erklärung des Grundgedankens der Subsidiarität und seiner Rolle als Ordnungsprinzip in Europa zur Kompetenzabgrenzung zwischen EU, Mitgliedsstaaten und Regionen, um ein bürgernahes Europa zu gewährleisten.
2. Subsidiarität: Dieses Kapitel definiert den Begriff Subsidiarität, leitet ihn von seinem lateinischen Ursprung ab und beschreibt ihn als gesellschaftsethisches Prinzip aus der katholischen Soziallehre. Es zielt auf die Entfaltung individueller Fähigkeiten, Selbstbestimmung und Selbstverantwortung ab. Der Staat greift nur subsidiär ein, wenn die Möglichkeiten Einzelner oder kleinerer Gruppen nicht ausreichen. Das Kapitel beleuchtet die Ziele des Prinzips – Hilfe bei unzureichenden Problemlösungen auf niedrigeren Ebenen und Wahrung der Mitgliedsstaatenkompetenzen – und unterscheidet zwischen der negativen Seite (Funktionssperre, Schutz der Autonomie) und der positiven Seite (Hilfe zur Selbsthilfe). Es listet verschiedene Anwendungsbereiche auf, von überstaatlichen Gemeinschaften bis hin zu nichtstaatlichen Gemeinschaften.
3. Subsidiaritätsprinzip in den europäischen Verträgen: Dieses Kapitel beschreibt die Formulierung und den Einzug des Subsidiaritätsprinzips in den EG-Vertrag (Artikel 5, ex-Art 3b) nach dem Europäischen Rat von Maastricht. Die Bedeutung des Prinzips als tragende Säule der EU wird hervorgehoben, ebenso seine Rolle bei der Verringerung von Bürokratie. Das Kapitel behandelt die im Vertrag von Amsterdam enthaltenen Präzisierungen und die zwei notwendigen Bedingungen für die Rechtfertigung des Handelns der EU: unzureichende Erreichung der Ziele durch Mitgliedsstaaten und bessere Erreichung durch gemeinschaftliche Maßnahmen. Die Notwendigkeit der Begründung durch die Kommission wird ebenfalls betont.
Schlüsselwörter
Subsidiarität, Subsidiaritätsprinzip, katholische Soziallehre, Europäische Union, Kompetenzabgrenzung, Mitgliedsstaaten, Regionen, Selbstbestimmung, Selbstverantwortung, Hilfe zur Selbsthilfe, Funktionssperre, Maastricht, Amsterdam, EG-Vertrag, Bürgernähe.
Häufig gestellte Fragen zur Facharbeit: Subsidiarität in der Europäischen Union
Was ist der Gegenstand dieser Facharbeit?
Die Facharbeit untersucht das Subsidiaritätsprinzip, seine Ursprünge und seine Anwendung, insbesondere im Kontext der Europäischen Union. Sie erklärt den Grundgedanken der Subsidiarität und verdeutlicht dessen Bedeutung für die Kompetenzabgrenzung zwischen verschiedenen Ebenen der europäischen und nationalen Verwaltung.
Welche Themen werden in der Facharbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themen: Definition und historische Entwicklung des Subsidiaritätsprinzips; Ziele und Funktionen des Prinzips; positive und negative Aspekte; Anwendungsbereiche auf verschiedenen Ebenen; Verankerung in europäischen Verträgen. Die Arbeit analysiert die Bedeutung des Prinzips für ein bürgernahes Europa und die Verringerung von Bürokratie.
Wie ist die Facharbeit strukturiert?
Die Facharbeit umfasst eine Einleitung, ein Kapitel zur Definition und Erläuterung des Subsidiaritätsprinzips, ein Kapitel zum Subsidiaritätsprinzip in den europäischen Verträgen und ein abschließendes Kapitel mit Schlüsselbegriffen. Die Kapitel beinhalten eine detaillierte Erläuterung der jeweiligen Aspekte des Subsidiaritätsprinzips.
Was ist das Subsidiaritätsprinzip?
Das Subsidiaritätsprinzip, abgeleitet aus der katholischen Soziallehre, besagt, dass höhere Ebenen (z.B. der Staat) nur dann eingreifen sollen, wenn niedrigere Ebenen (z.B. Individuen, Gruppen) ein Problem nicht selbst lösen können. Es fördert Selbstbestimmung, Selbstverantwortung und die Entfaltung individueller Fähigkeiten. Es hat sowohl eine negative (Schutz der Autonomie) als auch eine positive (Hilfe zur Selbsthilfe) Seite.
Welche Ziele verfolgt das Subsidiaritätsprinzip?
Das Subsidiaritätsprinzip zielt darauf ab, Probleme auf der jeweils niedrigsten, effektivsten Ebene zu lösen, die Autonomie von Individuen und kleineren Gruppen zu schützen und die Kompetenzabgrenzung zwischen verschiedenen Verwaltungsebenen zu klären. Es soll ein bürgernahes Europa gewährleisten und unnötige Bürokratie vermeiden.
Wie ist das Subsidiaritätsprinzip in den europäischen Verträgen verankert?
Das Subsidiaritätsprinzip wurde nach dem Europäischen Rat von Maastricht in den EG-Vertrag (Artikel 5, ex-Art 3b) aufgenommen. Der Vertrag von Amsterdam präzisierte das Prinzip und legte zwei Bedingungen für das Handeln der EU fest: unzureichende Zielerreichung durch Mitgliedsstaaten und bessere Erreichung durch gemeinschaftliche Maßnahmen. Die Kommission ist verpflichtet, die Rechtfertigung für gemeinschaftliches Handeln zu begründen.
Welche Schlüsselwörter sind für diese Facharbeit relevant?
Schlüsselwörter sind: Subsidiarität, Subsidiaritätsprinzip, katholische Soziallehre, Europäische Union, Kompetenzabgrenzung, Mitgliedsstaaten, Regionen, Selbstbestimmung, Selbstverantwortung, Hilfe zur Selbsthilfe, Funktionssperre, Maastricht, Amsterdam, EG-Vertrag, Bürgernähe.
- Citation du texte
- Tim Berger (Auteur), 2010, Subsidiarität, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/170048