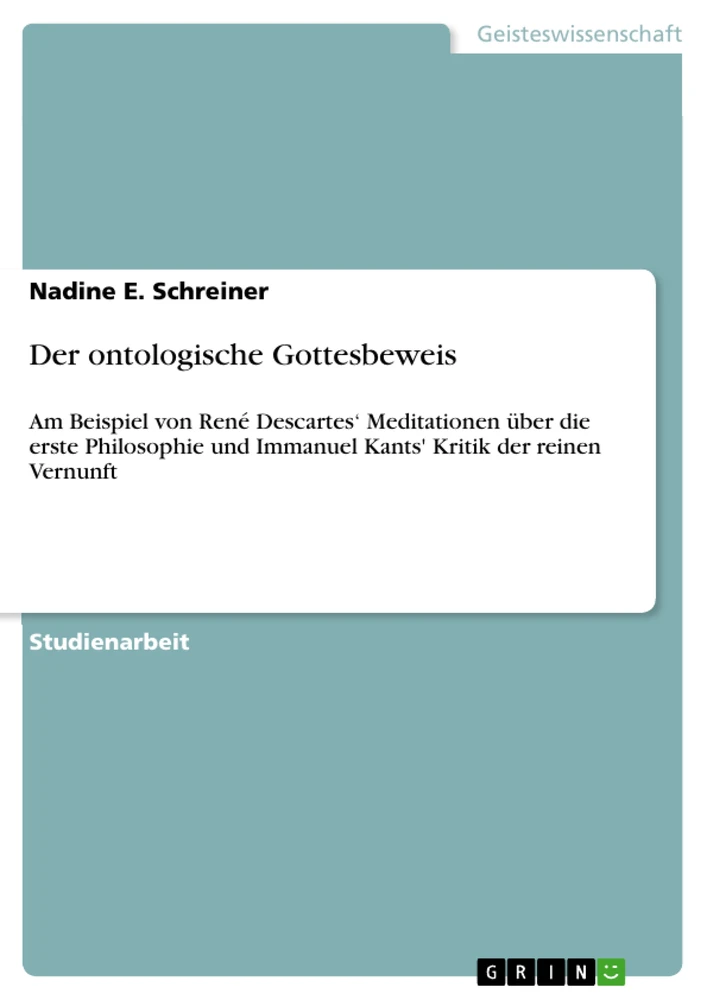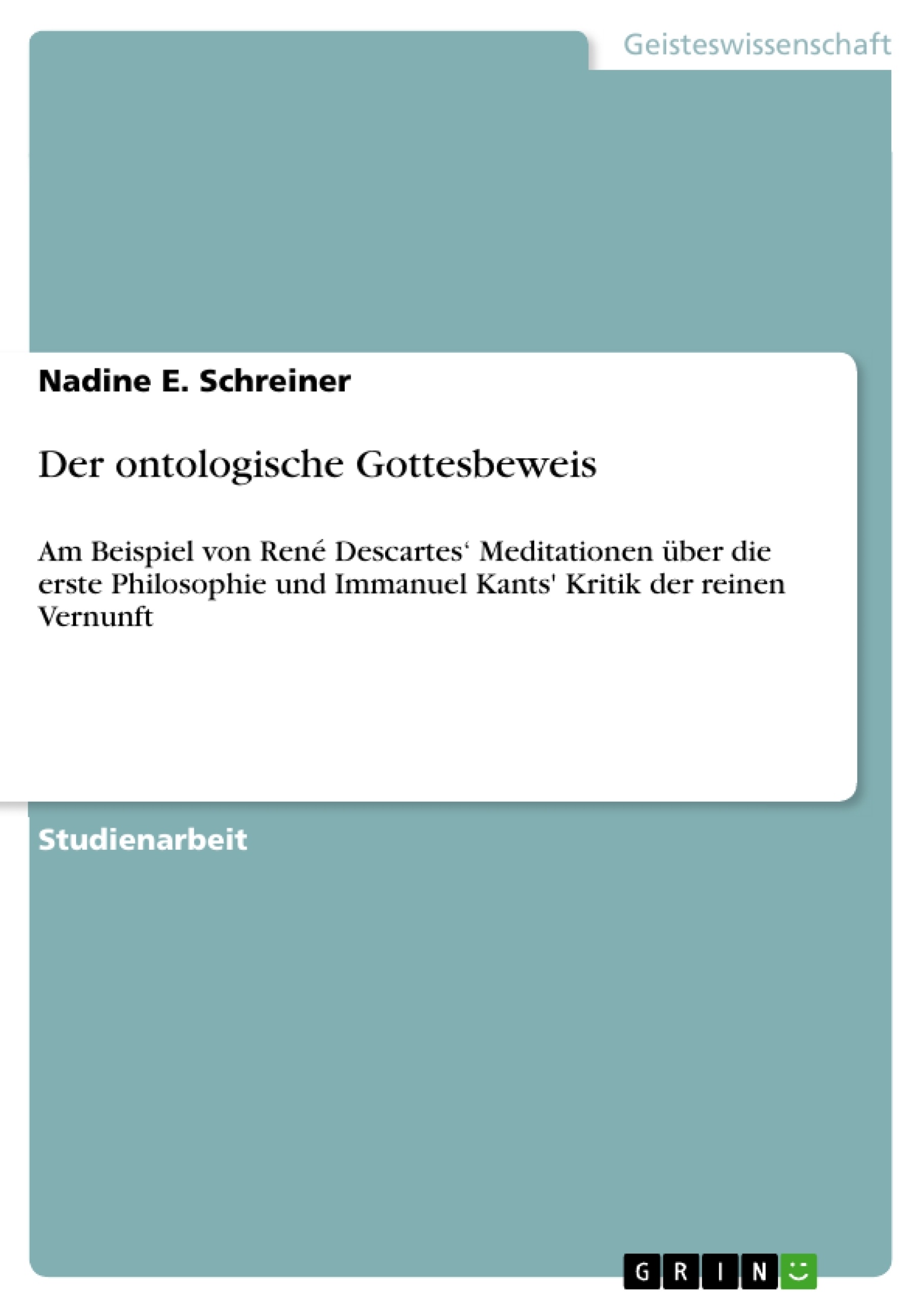Eine der grundlegenden Fragen der Menschheit ist die nach einem höheren Wesen. Mag dieses höhere Wesen nun Gott, Jahwe, Allah, oder einen sonstigen Namen tragen, versu-chen doch Menschen verschiedenster Herkunft, Bildung oder Standes, die Existenz dieses Wesens zu beweisen oder Beweise für die Existenz einer solch höheren, gar außerirdischen, oder besser überirdischen Macht zu finden.
Die Frage nach einem höheren Wesen ist seit je her eine interdisziplinäre Fragestellung, da man diese Fragestellung aus den verschiedensten Blickwinkeln und mit den unter-schiedlichsten Motivationen betrachten kann. So fällt jedem bei der Betrachtung der Fra-ge nach einem höheren Wesen natürlich sofort die Theologie als zuständige wissenschaft-liche Disziplin ein. Jedoch kann man, wenn man etwas länger an der Frage, wer sich mit dieser Themenstellung befasst, verharrt und sich hierüber Gedanken macht, dass auch die Ethnologie, die Philosophie und ja selbst die Naturwissenschaften dieser Frage auf den Grund gehen. Jede sicherlich aus ihrer eigenen Motivation heraus und mit unterschiedli-cher Intensität, jedoch kann jede Disziplin ihren Beitrag zu einem Gottesbeweis leisten.
Diese Arbeit, die rein der philosophischen Disziplin Rechnung trägt, wird sich nach einer kurzen Einführung in die Begriffe der Ontologie und einem historischen Abriss der Got-tesbeweise, im Kern mit dem ontologischen Gottesbeweis aus René Descartes´ „Mediati-onen über die Erste Philosophie“ und dessen Kritik aus Kants Werk „Kritik der reinen Vernunft“ befassen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Begriffserklärungen
- Ontologie
- Sein
- Entität
- Geschichtlicher Abriss des Gottesbeweises
- Der Gottesbeweis in der Antike
- Der Gottesbeweis im Mittelalter
- Der Gottesbeweis in der frühen Neuzeit
- Der Gottesbeweis in der Neuzeit und heute
- René Descartes
- René Descartes Leben
- René Descartes Werk
- René Descartes` ontologischer Gottesbeweis
- Der Gottesbeweis durch die Definition von Gott
- Der Gottesbeweis am Beispiel des Dreiecks
- Resümee zu René Descartes Gottesbeweis
- Immanuel Kant
- Immanuel Kants Leben
- Immanuel Kants Werk
- Immanuel Kant und der ontologische Gottesbeweis
- Gott existiert als synthetischer oder analytischer Satz
- Sein – logisches oder reales Prädikat
- Resümee zu Kants Darstellungen zum ontologischen Gottesbeweis
- Resümee der Werke von René Descartes und Immanuel Kant
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit dem ontologischen Gottesbeweis, einer philosophischen Frage, die Menschen seit jeher beschäftigt. Im Zentrum stehen die Werke von René Descartes' „Meditationen über die Erste Philosophie“ und Immanuel Kants „Kritik der reinen Vernunft“.
- Der ontologische Gottesbeweis als philosophisches Konzept
- Die unterschiedlichen Ansätze von Descartes und Kant
- Kritik des ontologischen Gottesbeweises durch Kant
- Die Rolle von Denken und Erfahrung in der Gottesfrage
- Der Einfluss des Zeitgeistes auf die Philosophie
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Arbeit stellt die grundlegende Frage nach einem höheren Wesen und führt in die Thematik des ontologischen Gottesbeweises ein. Es wird die Bedeutung dieses Themas für verschiedene Disziplinen wie Theologie, Ethnologie und Philosophie beleuchtet.
- Begriffserklärungen: Es werden die zentralen Begriffe Ontologie, Sein und Entität erklärt, um ein gemeinsames Verständnis für die weitere Analyse zu schaffen.
- Geschichtlicher Abriss des Gottesbeweises: Es werden verschiedene historische Ansätze zur Gottesfrage in der Antike, im Mittelalter, der frühen Neuzeit und der Neuzeit dargestellt.
- René Descartes: Die Arbeit beleuchtet Descartes' Leben und Werk, mit besonderem Fokus auf seine „Meditationen über die Erste Philosophie“. Descartes` ontologischer Gottesbeweis wird anhand seiner Argumentation in den „Meditationen“ erläutert.
- Immanuel Kant: Kants Leben und Werk werden dargestellt, mit Fokus auf seine Kritik des ontologischen Gottesbeweises in der „Kritik der reinen Vernunft“.
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselwörter dieser Arbeit sind: Ontologie, Gottesbeweis, René Descartes, Immanuel Kant, Meditationen über die Erste Philosophie, Kritik der reinen Vernunft, analytisches Urteil, synthetisches Urteil, Sein, Existenz, reales Prädikat, logisches Prädikat.
Häufig gestellte Fragen
Was ist ein ontologischer Gottesbeweis?
Ein philosophisches Argument, das versucht, die Existenz Gottes rein aus dem Begriff oder dem Wesen Gottes abzuleiten, ohne auf Sinneserfahrung zurückzugreifen.
Wie begründet René Descartes die Existenz Gottes?
Descartes argumentiert, dass die Idee eines vollkommenen Wesens (Gott) die Existenz beinhalten muss, da Existenz eine notwendige Vollkommenheit ist.
Was ist Kants Hauptkritik am ontologischen Gottesbeweis?
Kant argumentiert in der "Kritik der reinen Vernunft", dass "Sein" kein reales Prädikat ist – man kann die Existenz eines Dinges nicht einfach zu dessen Begriff hinzufügen.
Was ist der Unterschied zwischen analytischen und synthetischen Sätzen?
Analytische Sätze erläutern nur, was bereits im Begriff enthalten ist; synthetische Sätze fügen dem Begriff eine neue Information (z. B. die Existenz in der Realität) hinzu.
Welche Rolle spielt die Ontologie in dieser Debatte?
Die Ontologie befasst sich mit der Lehre vom Seienden; der Gottesbeweis untersucht, ob das "höchste Wesen" notwendigerweise Teil der Realität sein muss.
- Citar trabajo
- Nadine E. Schreiner (Autor), 2011, Der ontologische Gottesbeweis, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/170089