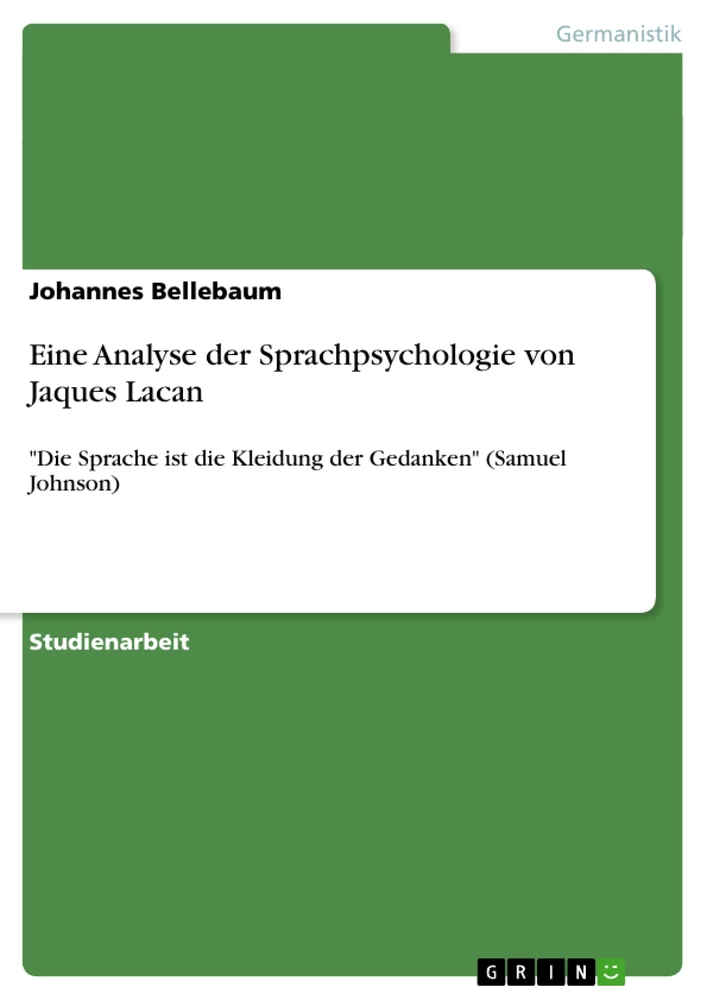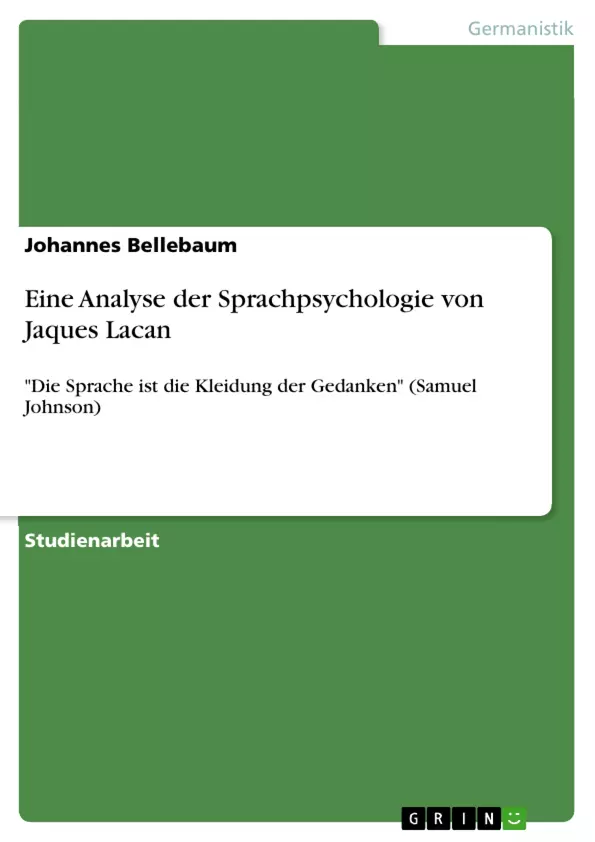Cogito ergo sum, ubi cogito, ibi sum. Ich denke, also bin ich und ich bin dort, wo ich denke (Jaques Lacan: Das Drängen des Buchstabens im Unbewußten oder die Vernunft seit Freud). Die Rolle des Bewusstseins der eigenen Identität als Beleg für die eigene Existenz führt zu Überlegungen über die Lokalisierung des Selbst in der Welt. Denn während die physische Verortung aufgrund der Körperlichkeit des Menschen noch einfach zu bewerkstelligen ist, so bleibt die Frage, an welchem Ort der Geist des Menschen, eben jener Teil, durch den wir uns überhaupt gedanklich selbst wahrnehmen können, beheimatet ist. Wo ich denke, dort bin ich. Diese philosophischen Überlegungen stellen die Rolle des Denkens als Anker und Verbindung zur Welt in den Vordergrund. Während die Möglichkeit der physischen Einflussnahme auf die Welt aufgrund der Körperlichkeit einfach und eindeutig zu benennen ist, so bedarf der intellektuelle Austausch mit einem anderen, denkenden Bewusstsein eines Mediums, das diesen kommunikativen Austausch erlaubt: das Medium der Sprache. Genau an diesem Punkt setzen Jacques Lacans Überlegungen und Theorien ein, welche er in seinem Text „Das Drängen des Buchstaben im Unbewussten oder die Vernunft seit Freud“ - wieder über das Medium der Sprache – zu erklären versucht: Wenn sowohl der Austausch mit anderen Menschen als auch die eigene Wahrnehmung - denn zur Formulierung des Gedankens „Ich denke, also bin ich.“ ist auch bereits die Verwendung von Spracheunumgänglich - nur durch den Einsatz von Sprache überhaupt möglich ist, welche Rolle spielt dann die Sprache in unserem Denken? Wie nimmt sie Einfluss auf die Entwicklung des Geistes und damit auch auf die Persönlichkeit des Menschen? Zur Beantwortung dieser Fragen sind zunächst Überlegungen zur Struktur der Sprache erforderlich, um ihre Rolle in Bezug auf das menschliche Denken näher untersuchen zu können.
Inhaltsverzeichnis
- Ich spreche, also bin ich
- Die Natur der Sprache
- Die Entdeckung des Ichs
- Die Rolle des Subjekts
- Das Subjekt als Sprachwesen
- Die Struktur des Subjekts
- Das Subjekt als begehrendes Subjekt
- Die Rhetorik des Begehrens
- Die Metonymie
- Die Metapher
- Ein Vergleich zu Freud
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Ausarbeitung analysiert Jacques Lacans Sprachpsychologie, ausgehend von der Aussage „Ich spreche, also bin ich“. Ziel ist es, die Rolle der Sprache in der Entwicklung des Ichs und der Konstitution des Subjekts zu beleuchten. Die Arbeit untersucht Lacans Konzepte im Kontext philosophischer Überlegungen zur Lokalisierung des Selbst und zur Natur der Sprache.
- Die Sprache als konstitutives Element des Selbst
- Die Struktur und der Aufbau der Sprache nach Lacan
- Das Verhältnis von Signifikant und Signifikat
- Die Rolle des Begehrens in Lacans Theorie
- Der Einfluss von Saussure auf Lacans Sprachtheorie
Zusammenfassung der Kapitel
Ich spreche, also bin ich: Dieser einleitende Abschnitt erörtert die philosophische Frage nach der Lokalisierung des Selbst und dem Verhältnis von Denken und Sein. Ausgehend von „Cogito ergo sum“ wird die zentrale Rolle des Bewusstseins und die Notwendigkeit eines Mediums – der Sprache – für den intellektuellen Austausch hervorgehoben. Die Ausführungen führen zur zentralen Fragestellung der Arbeit: Wie beeinflusst die Sprache unser Denken, die Entwicklung des Geistes und die Persönlichkeit? Die Einleitung legt den Grundstein für die anschließende Analyse von Lacans Sprachtheorie.
Die Natur der Sprache: Dieses Kapitel definiert den Gegenstand der Untersuchung: die Struktur und den Aufbau der Sprache anhand Lacans Definition des „Buchstabens“ als materiellem Substrat des Diskurses. Lacan verwendet die Saussuresche Terminologie (Signifikant/Signifikat) und betont die Arbitrarität sprachlicher Zeichen. Die Arbeit illustriert, wie Sprache durch Vereinfachung und Zusammenfassung Verständigung ermöglicht, aber gleichzeitig eine unvollständige Abbildung der Realität darstellt. Das Beispiel der Bezeichnungen „Männer“ und „Damen“ an Toilettentüren verdeutlicht den Unterschied zwischen Bezeichnung und tatsächlicher Bedeutung und die Komplexität des Verhältnisses von Signifikant und Signifikat. Der Abschnitt betont die Bedeutung dieser Überlegungen für Lacans Theorie des Subjekts.
Schlüsselwörter
Jacques Lacan, Sprachpsychologie, Signifikant, Signifikat, Subjekt, Sprache, Begehren, Saussure, Bewusstsein, Identität, Kommunikation.
Häufig gestellte Fragen zu: Jacques Lacans Sprachpsychologie
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert Jacques Lacans Sprachpsychologie, ausgehend von der Aussage „Ich spreche, also bin ich“. Sie beleuchtet die Rolle der Sprache in der Entwicklung des Ichs und der Konstitution des Subjekts im Kontext philosophischer Überlegungen zur Lokalisierung des Selbst und zur Natur der Sprache.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt zentrale Themen wie die Sprache als konstitutives Element des Selbst, die Struktur und den Aufbau der Sprache nach Lacan, das Verhältnis von Signifikant und Signifikat, die Rolle des Begehrens in Lacans Theorie und den Einfluss von Saussure auf Lacans Sprachtheorie. Konkrete Beispiele und Kapitel befassen sich mit der philosophischen Frage nach dem Selbst, der Arbitrarität sprachlicher Zeichen und der Komplexität des Verhältnisses zwischen Bezeichnung und Bedeutung.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit und worum geht es darin?
Die Arbeit gliedert sich in Kapitel wie „Ich spreche, also bin ich“, welches die philosophische Frage nach dem Selbst und der Rolle des Bewusstseins erörtert. Das Kapitel „Die Natur der Sprache“ definiert die Struktur und den Aufbau der Sprache nach Lacan, unter Verwendung der Saussureschen Terminologie (Signifikant/Signifikat) und beleuchtet die Arbitrarität sprachlicher Zeichen. Weitere Kapitel befassen sich vertieft mit der Rolle des Subjekts und der Rhetorik des Begehrens.
Welche Schlüsselbegriffe sind zentral für das Verständnis der Arbeit?
Schlüsselbegriffe sind Jacques Lacan, Sprachpsychologie, Signifikant, Signifikat, Subjekt, Sprache, Begehren, Saussure, Bewusstsein und Identität.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, die Rolle der Sprache in der Entwicklung des Ichs und der Konstitution des Subjekts nach Lacan zu analysieren und seine Konzepte im Kontext philosophischer Überlegungen zu verorten. Sie untersucht, wie Sprache unser Denken, die Entwicklung des Geistes und die Persönlichkeit beeinflusst.
Wie ist der Aufbau der Arbeit?
Die Arbeit beinhaltet ein Inhaltsverzeichnis, eine Einleitung mit Zielsetzung und Themenschwerpunkten, Kapitelzusammenfassungen und eine Liste der Schlüsselwörter. Die Struktur ist logisch aufgebaut und führt den Leser von den grundlegenden philosophischen Fragen zur detaillierten Analyse von Lacans Sprachtheorie.
Wer ist die Zielgruppe dieser Arbeit?
Die Arbeit richtet sich an Personen, die sich akademisch mit Jacques Lacans Sprachpsychologie und den damit verbundenen philosophischen Fragestellungen auseinandersetzen möchten. Sie eignet sich insbesondere für Studierende der Philosophie, Literaturwissenschaft oder Sprachwissenschaft.
- Quote paper
- Johannes Bellebaum (Author), 2009, Eine Analyse der Sprachpsychologie von Jaques Lacan, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/170095