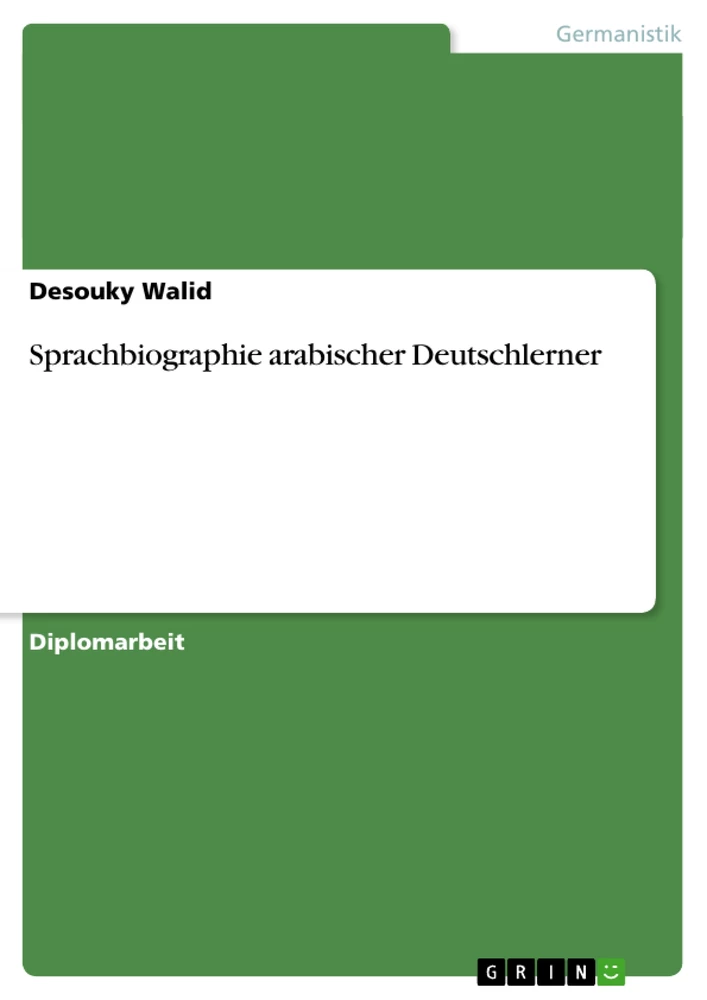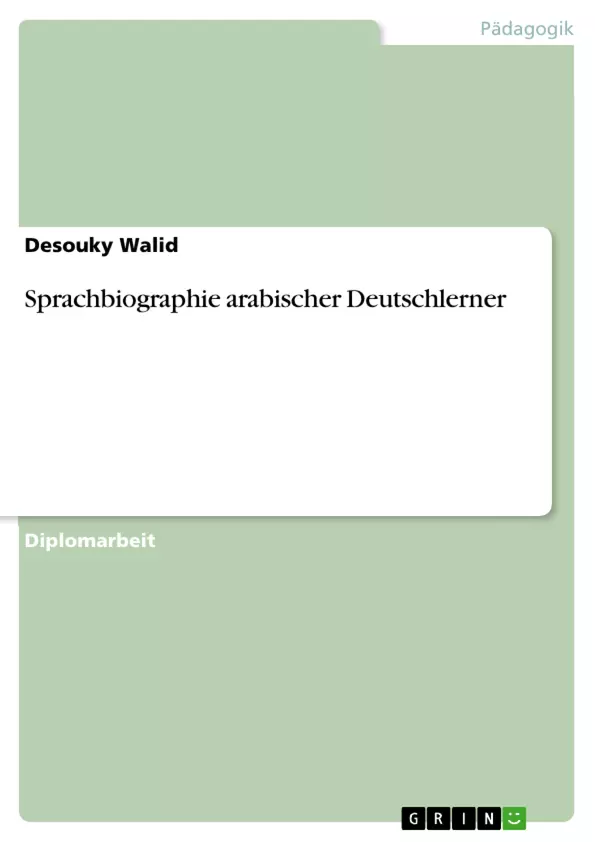1. Einleitung
Im Rahmen dieser Arbeit soll die lernsprachliche Kompetenz meiner Informanten untersucht werden und wie sich unterschiedliche außersprachliche Faktoren auf die lernersprachliche Kompetenz der Informanten auswirken. Zu diesem Zweck wurden drei Interviews mit drei arabischstämmigen Emigranten geführt, deren lernersprachliche Kompetenz unterschiedlich war und bei denen, ich meine Informanten, bestimmte Fragen gestellt habe, die sie einen erzählgenerierenden Impuls geben und sie zum Erinnerungenschwelgen ermuntern sollten.
Die linguistischen und sozialen Daten wurden in dieser Arbeit miteinander verglichen und in Verbindung gebracht. Ich möchte ihre Geschichte und Erlebnisse schildern lassen, unter besonderer Berücksichtigung der sprachlichen Aspekten ihrer Biographien. Am Ende der Arbeit als Anhang wurden die Gespräche von mir transkribiert und analysiert, um Sprachbiographien zu erstellen, in denen sich Personen in freier narrativer Form über ihr Verhältnis zur Sprache äußern. (Vgl. Franceschini 2001. S. 113).
Das Hauptaugenmerk der Arbeit liegt auf der Untersuchung der sprachlichen Entwicklung meiner Informanten sowie auf die Verhandlungen über eine neue Identität in der deutschen Gesellschaft. Denn diese Emigranten bieten sich als eine neue, interessante Gruppe für eine linguistische Untersuchung besonders an, möchte ich In dieser Arbeit einen Abriss über die Geschichte des großen Maghrebs geben sowie auch einen Abriss über die arabische Sprache als Ausgangssprache geben. Als eine semitische Sprache unterscheidet sich das Arabische in seiner Gesamtstruktur sehr stark vom Deutschen.
[...]
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Die arabischen Migranten in Deutschland
- 3. Die Geschichte vom Maghreb und die Berber und ihre Sprache
- 4. Die arabische Sprache und ihre Linguistik
- 4.1. Klassisches Arabisch
- 4.2. Modernes Hocharabisch
- 4.3. Dialekte des Arabischen
- 4.4. Das Vokalsystem des Arabischen
- 4.5. Die Morphologie der Arabischsprache
- 4.6. Die Wortarten des Arabischen
- 4.6.1. Das Verb
- 4.6.2. Das Nomen
- 4.6.3. Die Partikeln
- 5.1. Über die Sprachbiographie
- 5.2. Darstellung der Sprachbiographie
- 5.3. Die Interviews und Datenerhebungsmethode
- 5.4. Die Auswahl von Informanten
- 5.5. Persönliche Daten und Migration der Informanten
- 5.6. Die Situation: Ort, Zeit, Anwesende
- 5.7. Rückkehrabsichten und emotionale Situation
- 5.8. Sprachkompetenz während der Interviews
- 6. Spracherwerb
- 6.1. Zweitspracherwerb
- 6.1.1. Ungesteuerter Zweitspracherwerb
- 6.1.2. Gesteuerter Zweitspracherwerb
- 6.2. Die Komponenten des Spracherwerbs
- 6.2.1. Der Antrieb
- 6.2.1.1. Soziale Integration
- 6.2.1.2. Das Bedürfnis nach Kommunikation
- 6.2.1.3. Einstellungen
- 6.2.1.4. Erziehung
- 6.2.2. Das Sprachvermögen
- 6.2.3. Der Zugang
- 6.2.4. Die Verlaufsstruktur
- 6.2.5. Das Tempo
- 6.2.6. Endzustand
- 6.2.1. Der Antrieb
- 6.1. Zweitspracherwerb
- 7. Die Entwicklung der Sprachen
- 7.1. Sprachen und Identitätskonflikt
- 7.2.1. Parallele Muttersprache: Arabisch/Französisch (Bilingualismus)
- 7.2.2. Französisch
- 7.2.3. Englisch
- 7.2.4. Motivation zum Deutschlernen
- 7.2.4.1 Deutscherwerb und Lernstrategien
- 7.2.5. Andere Sprachen
- 8. Identität
- 8.1. Sprachliche Identität
- 8.1.1 Ob es eine Pidgin ist? Gastarbeiterdeutsch
- 8.2. Kulturelle Identität
- 8.3. Nachwort
- 8.1. Sprachliche Identität
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Magisterarbeit untersucht die sprachliche Kompetenz arabischstämmiger Migranten in Deutschland und den Einfluss außersprachlicher Faktoren darauf. Drei Interviews bilden die Grundlage der Analyse. Ziel ist es, die sprachbiografischen Profile der Informanten zu erstellen und die Verhandlung ihrer Identität im Kontext der deutschen Gesellschaft zu beleuchten.
- Sprachliche Entwicklung arabischstämmiger Migranten in Deutschland
- Einfluss von Migrationshintergrund und kultureller Identität auf den Spracherwerb
- Herausforderungen und Strategien beim Erwerb der deutschen Sprache
- Sprachliche und kulturelle Identität im Kontext der Integration
- Analyse der sprachbiografischen Erzählungen der Informanten
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Arbeit untersucht die sprachliche Kompetenz arabischstämmiger Migranten und den Einfluss außersprachlicher Faktoren. Drei Interviews mit Migranten mit unterschiedlichem Deutschniveau bilden die Datenbasis. Die linguistischen und sozialen Daten werden verglichen, um die sprachlichen Aspekte ihrer Biografien zu beleuchten. Der Fokus liegt auf der sprachlichen Entwicklung und der Aushandlung neuer Identitäten in der deutschen Gesellschaft. Die Arbeit enthält einen Abriss der Geschichte des Maghreb und der arabischen Sprache als Ausgangssprache.
2. Die arabischen Emigranten in Deutschland: Dieses Kapitel beleuchtet die Migrationsgeschichte arabischer Menschen nach Deutschland, beginnend lange vor dem 19. Jahrhundert mit Zwangsmigration. Es werden die Schwierigkeiten der Integration aufgrund sprachlicher Barrieren und kultureller Missverständnisse thematisiert, sowie die Diskussion um Einbürgerung und die Problematik der Ghettoisierung. Der Fokus liegt auf den Herausforderungen der Migration und der Bedeutung der Muttersprache neben dem Deutschlernen für eine gelungene Integration. Das Kapitel verweist auf den Anstieg der Einwanderungswellen nach dem Zweiten Weltkrieg und die spezifische Situation arabischer Migranten in Deutschland, besonders nach dem 11. September. Es beschreibt die ersten Kontakte arabischer Menschen mit Deutschland im 18. Jahrhundert und die verstärkte Einwanderung ab den 1960er Jahren im Kontext von Arbeitskräfteanwerbeabkommen.
Schlüsselwörter
Sprachbiografie, arabische Migranten, Deutschland, Spracherwerb, Zweitspracherwerb, Integration, Identität, kulturelle Identität, sprachliche Identität, Migrationsgeschichte, Deutsch als Zweitsprache, Maghreb, Arabisch.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Magisterarbeit: Sprachliche Kompetenz arabischstämmiger Migranten in Deutschland
Was ist der Gegenstand dieser Magisterarbeit?
Die Magisterarbeit untersucht die sprachliche Kompetenz arabischstämmiger Migranten in Deutschland und den Einfluss außersprachlicher Faktoren darauf. Im Mittelpunkt stehen die sprachbiografischen Profile der Interviewten und die Aushandlung ihrer Identität im Kontext der deutschen Gesellschaft.
Welche Methode wurde verwendet?
Die Arbeit basiert auf drei Interviews mit arabischstämmigen Migranten. Die linguistischen und sozialen Daten aus diesen Interviews werden verglichen, um die sprachlichen Aspekte ihrer Biografien zu beleuchten.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die sprachliche Entwicklung arabischstämmiger Migranten in Deutschland, den Einfluss von Migrationshintergrund und kultureller Identität auf den Spracherwerb, die Herausforderungen und Strategien beim Erwerb der deutschen Sprache, sprachliche und kulturelle Identität im Kontext der Integration sowie eine Analyse der sprachbiografischen Erzählungen der Interviewten. Weiterhin wird die Geschichte der arabischen Migration nach Deutschland, die Geschichte des Maghreb und der arabischen Sprache beleuchtet.
Welche Aspekte der arabischen Sprache werden behandelt?
Die Arbeit enthält eine Übersicht über das Klassische Arabisch, das Moderne Hocharabisch und die arabischen Dialekte. Es werden das Vokalsystem, die Morphologie und die Wortarten des Arabischen erläutert.
Wie wird der Spracherwerb behandelt?
Die Arbeit unterscheidet zwischen gesteuertem und ungesteuertem Zweitspracherwerb und analysiert die Komponenten des Spracherwerbs (Antrieb, Sprachvermögen, Zugang, Verlaufsstruktur, Tempo und Endzustand). Der Fokus liegt auf dem Erwerb der deutschen Sprache als Zweitsprache.
Welche Rolle spielt die Identität?
Die Arbeit untersucht die sprachliche und kulturelle Identität der Interviewten und beleuchtet den möglichen Identitätskonflikt im Kontext des Mehrsprachigkeit und der Integration in die deutsche Gesellschaft. Der Begriff "Gastarbeiterdeutsch" und die Frage nach der Entstehung eines Pidgins werden ebenfalls diskutiert.
Welche Sprachen werden neben Deutsch und Arabisch betrachtet?
Die Arbeit betrachtet auch den Einfluss von Französisch und Englisch auf den Spracherwerb der Interviewten.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit ist in acht Kapitel gegliedert: Einleitung, Arabische Migranten in Deutschland, Geschichte des Maghreb und der Berber und ihrer Sprache, Arabische Sprache und ihre Linguistik, Sprachbiografien der Informanten, Spracherwerb, Entwicklung der Sprachen und Identität.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Sprachbiografie, arabische Migranten, Deutschland, Spracherwerb, Zweitspracherwerb, Integration, Identität, kulturelle Identität, sprachliche Identität, Migrationsgeschichte, Deutsch als Zweitsprache, Maghreb, Arabisch.
- Arbeit zitieren
- Desouky Walid (Autor:in), 2011, Sprachbiographie arabischer Deutschlerner, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/170098