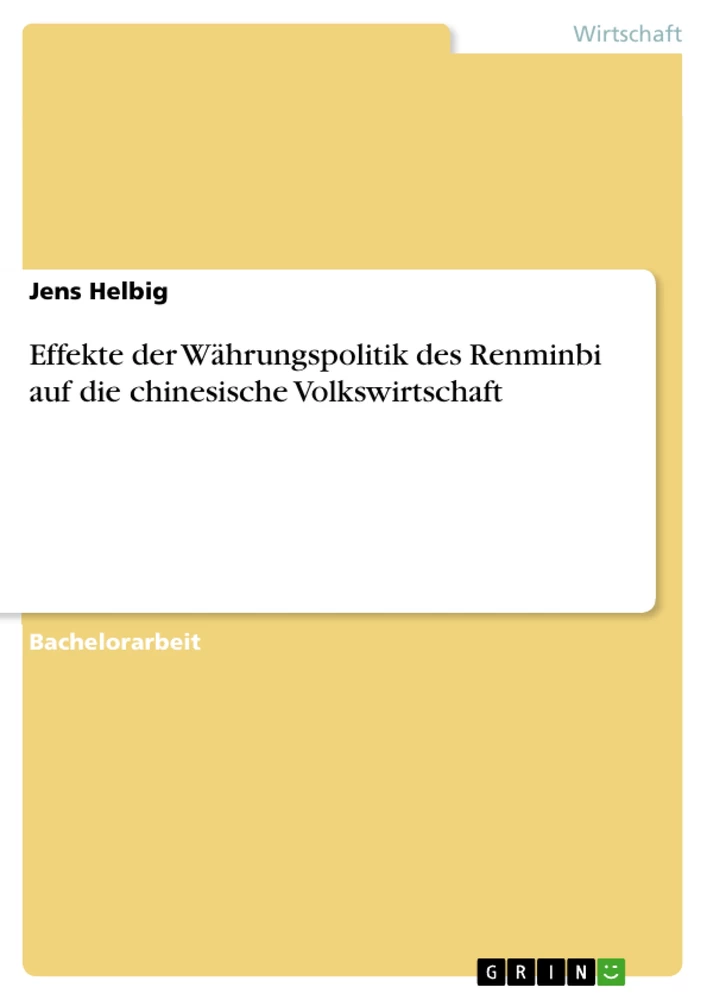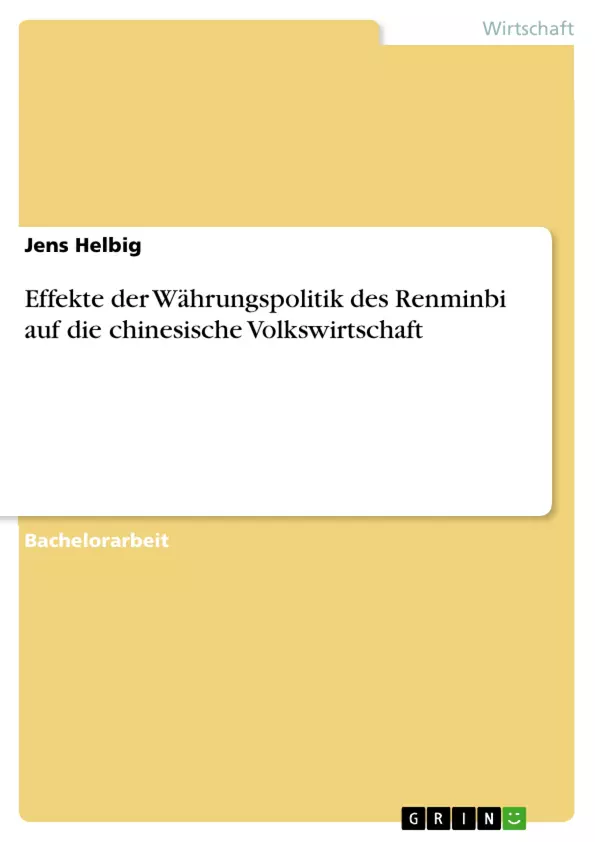Riesige Handelsbilanzüberschüsse und Devisenreserven in Billionenhöhe machen die Wechselkurspolitik der Volksrepublik China zum Streitthema Nummer Eins auf dem internationalen Parkett.
Der Vorwurf ist immer derselbe: China manipuliere den Wechselkurs seiner Landeswährung Renminbi absichtlich, um somit stärker und auf Kosten des Restes der Welt zu wachsen. Das wirft zwangsläufig die Frage auf, welche Vorteile China durch seine Wechselkurspolitik erhält und welche Gefahren es dabei in Kauf nehmen muss. Diese beiden Fragestellungen sind Hauptgegenstand der vorliegenden Arbeit.
Kapitel 2: Chinesische Währungspolitik
2.1 Das Trilemma des Wechselkursregimes
2.2 Der Verlauf des Wechselkurses zum US-Dollar
2.3 Ist der Renminbi unterbewertet?
Kapitel 3: Positive Effekte auf die chinesische Volkswirtschaft
3.1 Handelsbilanz
3.1.1 Die Nachfragefunktion in der offenen Volkswirtschaft
3.1.2 Die Nettoexporte Chinas
3.2 Ausländische Direktinvestitionen
3.3 Lehren aus der Asienkrise
3.4 Fiskalpolitische Maßnahmen im ZE-AA Modell
Kapitel 4: Gefahren für die chinesische Volkswirtschaft
4.1 Devisenreserven
4.2 Inflation
4.3 Importierte Inflation
Inhaltsverzeichnis (Table of Contents)
- 1. Einleitung
- 2. Chinas Währungspolitik
- 2.1 Das Trilemma des Wechselkursregimes
- 2.2 Der Verlauf des Wechselkurses zum US-Dollar
- 2.3 Ist der Renminbi unterbewertet?
- 3. Positive Effekte auf die chinesische Volkswirtschaft
- 3.1 Handelsbilanz
- 3.1.1 Die Nachfragefunktion in der offenen Volkswirtschaft
- 3.1.2 Die Nettoexporte Chinas
- 3.2 Ausländische Direktinvestitionen
- 3.3 Lehren aus der Asienkrise
- 3.4 Fiskalpolitische Maßnahmen im ZE-AA Modell
- 4. Gefahren für die chinesische Volkswirtschaft
- 4.1 Devisenreserven
- 4.2 Inflation
- 4.3 Importierte Inflation
- 5. Zusammenfassung und Fazit
- 6. Quellen- und Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte (Objectives and Key Themes)
Diese Bachelorarbeit untersucht die Auswirkungen der Währungspolitik des Renminbi auf die chinesische Volkswirtschaft. Die Arbeit analysiert die Wechselkurspolitik Chinas und ihre Folgen für verschiedene Wirtschaftsfaktoren, wie die Handelsbilanz, die ausländischen Direktinvestitionen, die Inflation und die Devisenreserven.
- Das Trilemma des Wechselkursregimes
- Die Unterbewertung des Renminbi
- Die Auswirkungen der Währungspolitik auf die Handelsbilanz und die ausländischen Direktinvestitionen
- Die Risiken der Währungspolitik für die chinesische Volkswirtschaft, wie Inflation und Devisenreserven
- Die Rolle fiskalpolitischer Maßnahmen im ZE-AA Modell
Zusammenfassung der Kapitel (Chapter Summaries)
- Kapitel 1: Einleitung
Dieses Kapitel liefert eine Einführung in das Thema der Arbeit und stellt die Forschungsfrage sowie die Ziele der Arbeit vor. - Kapitel 2: Chinas Währungspolitik
Dieses Kapitel beschreibt die Währungspolitik Chinas und stellt das Trilemma des Wechselkursregimes vor. Es wird auch der Verlauf des Wechselkurses des Renminbi zum US-Dollar sowie die Frage der Unterbewertung des Renminbi analysiert. - Kapitel 3: Positive Effekte auf die chinesische Volkswirtschaft
Dieses Kapitel untersucht die positiven Effekte der Währungspolitik auf die chinesische Volkswirtschaft. Es analysiert die Auswirkungen auf die Handelsbilanz, die ausländischen Direktinvestitionen und die Rolle der Fiskalpolitik. - Kapitel 4: Gefahren für die chinesische Volkswirtschaft
Dieses Kapitel untersucht die Gefahren, die mit der Währungspolitik des Renminbi für die chinesische Volkswirtschaft verbunden sind. Es analysiert die Auswirkungen auf die Devisenreserven, die Inflation und die importierte Inflation. - Kapitel 5: Zusammenfassung und Fazit
Dieses Kapitel fasst die Ergebnisse der Arbeit zusammen und zieht Schlussfolgerungen aus den Analysen.
Schlüsselwörter (Keywords)
Die Arbeit beschäftigt sich mit den Auswirkungen der Währungspolitik des Renminbi auf die chinesische Volkswirtschaft. Die wichtigsten Schlüsselwörter sind: Wechselkurspolitik, Renminbi, Handelsbilanz, ausländische Direktinvestitionen, Inflation, Devisenreserven, Trilemma des Wechselkursregimes, ZE-AA Modell, Unterbewertung.
Häufig gestellte Fragen
Warum steht Chinas Währungspolitik international in der Kritik?
China wird vorgeworfen, den Renminbi absichtlich unterbewertet zu halten, um durch billigere Exporte auf Kosten anderer Nationen zu wachsen.
Was ist das „Trilemma des Wechselkursregimes“?
Es beschreibt den Konflikt zwischen festem Wechselkurs, freiem Kapitalverkehr und unabhängiger Geldpolitik, von denen ein Land nur zwei gleichzeitig erreichen kann.
Welche positiven Effekte hat die Politik für Chinas Wirtschaft?
Die Politik fördert massive Handelsbilanzüberschüsse und zieht ausländische Direktinvestitionen an.
Welche Gefahren ergeben sich aus der Renminbi-Politik?
Zu den Risiken gehören eine steigende Inflation, die Abhängigkeit von riesigen Devisenreserven und die Gefahr einer importierten Inflation.
Welches theoretische Modell wird zur Analyse herangezogen?
Die Arbeit nutzt unter anderem das ZE-AA Modell zur Analyse fiskalpolitischer Maßnahmen.
- Quote paper
- Jens Helbig (Author), 2011, Effekte der Währungspolitik des Renminbi auf die chinesische Volkswirtschaft, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/170110