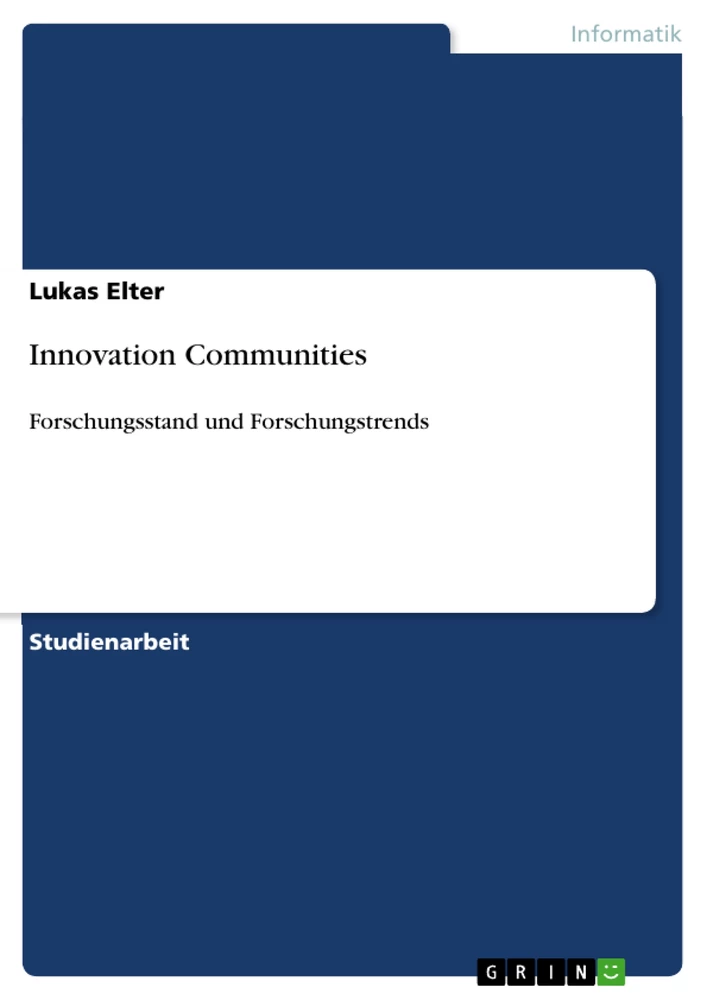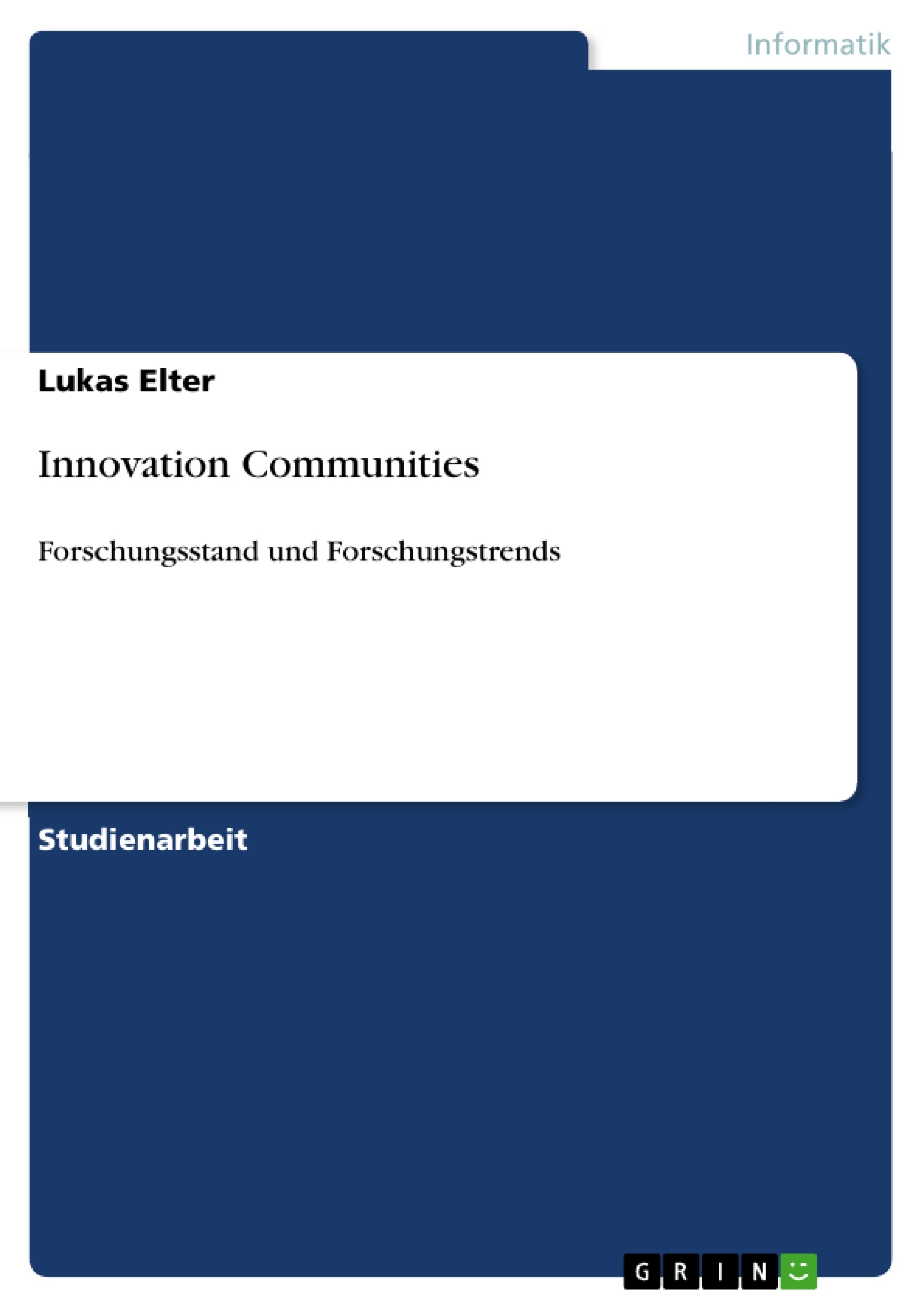Der Wandel der marktwirtschaftlichen Rahmenbedingungen zwingt Unternehmen den Innovationsprozess zu öffnen. Dabei stellt das Internet mit seinen Web 2.0 Funktionalitäten ein wesentliches Instrumentarium für Unternehmen zur Umsetzung des Einbezugs von Kunden in den Innovationsprozess dar. Eine Möglichkeit zur Realisierung dieses Vorhabens bietet die Nutzung von Innovation Communities. Diese Communities können sich aufgrund verschiedener Impulse bilden und unterschiedlich typisiert werden. In den betrachteten Online Innovation Communities finden sich die Mitglieder ungezwungen zusammen. Der offene Kommunikationsrahmen sowie die Modularisierung der Aufgaben in der Community bilden die Erfolgsbasis für die Umsetzung von Innovationsvorhaben. Für Unternehmen eröffnen sich zwei verschiedene Möglichkeiten mit Innovation Communities zu interagieren. Zum einen können von Unternehmen selbst Communities aufgebaut werden. Allerdings erfordert dies ein entsprechendes Fachwissen und Engagement des Unternehmens. Alternativ besteht die Möglichkeit bestehende Communities zu Innovation Communities auszubauen. Die Mitglieder in der Community sind je nach Typisierung entweder intrinsisch oder bei intermediären Innovation Communities aus einer Kombination aus intrinsischen und extrinsischen Faktoren motiviert. Unternehmen sollten sich bewusst sein, dass die Kooperation mit Innovation Communities ihnen ein besonderes Engagement abverlangt. Abgesehen von dem zeitlichen Aspekt ist auch ein Umdenken erforderlich um den Kunden bzw. das Mitglied der Community als aktiven Partner im Innovationsprozess zu sehen.
Inhaltsverzeichnis
- Persönliches Vorwort
- 1. Die Notwendigkeit von Open Innovation
- 2. Forschungsstand und Forschungstrends
- 2.1 Definition und Begriffsabgrenzung
- 2.2 Typen von Innovation Communities
- 2.3 Charakteristika von Innovation Communities
- 2.4 Aufbau von Innovation Communities
- 2.5 Motivation für die Teilnahme an Innovation Communities
- 2.6 Gruppendynamik und Kommunikation
- 2.7 Implikationen für die Praxis
- 3. Zusammenfassung und Fazit
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit befasst sich mit dem Forschungsstand und den aktuellen Trends im Bereich der Innovation Communities. Sie analysiert die Notwendigkeit von Open Innovation im Kontext der veränderten Rahmenbedingungen in Unternehmen und untersucht die verschiedenen Typen, Charakteristika, den Aufbau und die Motivation für die Teilnahme an Innovation Communities. Darüber hinaus werden die Gruppendynamik und Kommunikation in diesen Gemeinschaften sowie die Implikationen für die Praxis beleuchtet.
- Die Bedeutung von Open Innovation im Kontext der veränderten Rahmenbedingungen
- Die verschiedenen Typen von Innovation Communities
- Die Charakteristika und der Aufbau von Innovation Communities
- Die Motivation für die Teilnahme an Innovation Communities
- Die Gruppendynamik und Kommunikation in Innovation Communities
Zusammenfassung der Kapitel
Das Kapitel "Persönliches Vorwort" führt in die Thematik der Innovation Communities ein und beleuchtet die Bedeutung von Innovation am Beispiel des Unternehmens Apple. Das Kapitel "Die Notwendigkeit von Open Innovation" analysiert die veränderten Rahmenbedingungen in Unternehmen und stellt die Notwendigkeit von Open Innovation gegenüber der traditionellen Closed Innovation dar. Das Kapitel "Forschungsstand und Forschungstrends" befasst sich mit der Definition und Begriffsabgrenzung von Innovation Communities, den verschiedenen Typen, den Charakteristika, dem Aufbau, der Motivation für die Teilnahme, der Gruppendynamik und Kommunikation sowie den Implikationen für die Praxis.
Schlüsselwörter
Open Innovation, Innovation Communities, Crowdsourcing, Web 2.0, Interaktion, Gruppendynamik, Kommunikation, Implikationen für die Praxis.
Häufig gestellte Fragen
Was sind Online Innovation Communities?
Dies sind Gruppen von Menschen im Internet, die sich ungezwungen zusammenfinden, um gemeinsam an Innovationsvorhaben zu arbeiten und ihr Wissen für die Entwicklung neuer Produkte oder Lösungen zu teilen.
Was ist der Unterschied zwischen Open und Closed Innovation?
Closed Innovation findet ausschließlich innerhalb eines Unternehmens statt. Open Innovation öffnet den Innovationsprozess nach außen, um Wissen von Kunden, Partnern oder Communities einzubeziehen.
Was motiviert Menschen zur Teilnahme an solchen Communities?
Die Motivation kann intrinsisch (Spaß an der Sache, Problemlösung) oder extrinsisch (Belohnungen, Anerkennung, berufliche Vorteile) sein.
Welche Vorteile haben Unternehmen durch Innovation Communities?
Unternehmen erhalten Zugang zu externem Fachwissen, können Kundenbedürfnisse besser verstehen, Entwicklungskosten senken und die Marktakzeptanz neuer Produkte erhöhen.
Was erfordert die Zusammenarbeit mit einer Community von einem Unternehmen?
Es erfordert ein Umdenken: Kunden müssen als aktive Partner gesehen werden. Zudem ist ein hohes Engagement in der Kommunikation und Moderation der Community notwendig.
- Quote paper
- Lukas Elter (Author), 2011, Innovation Communities, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/170126