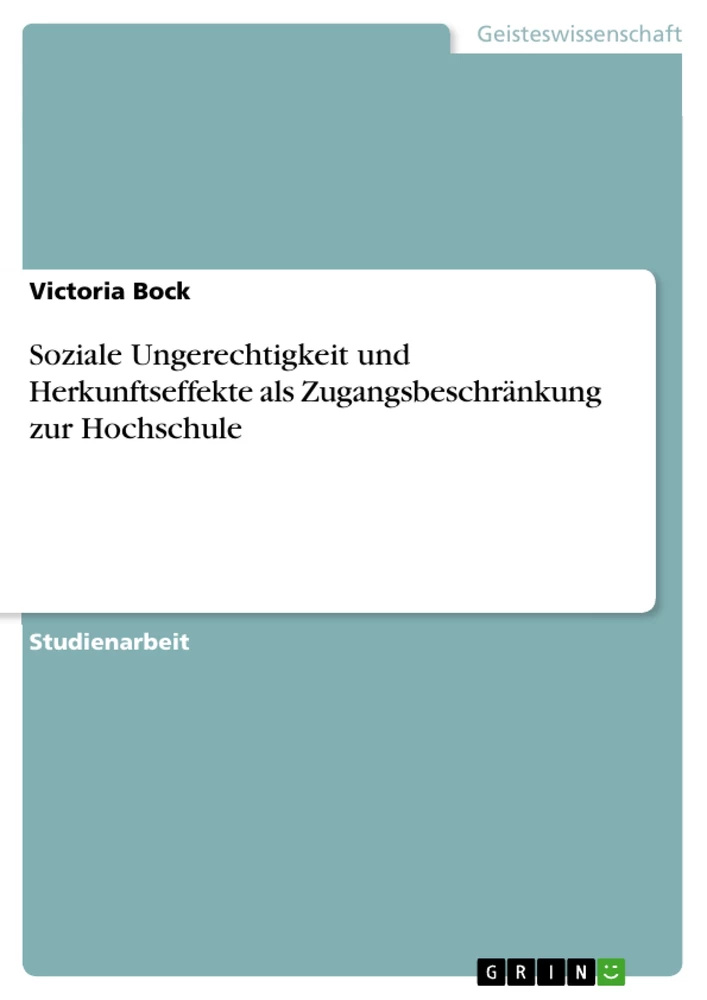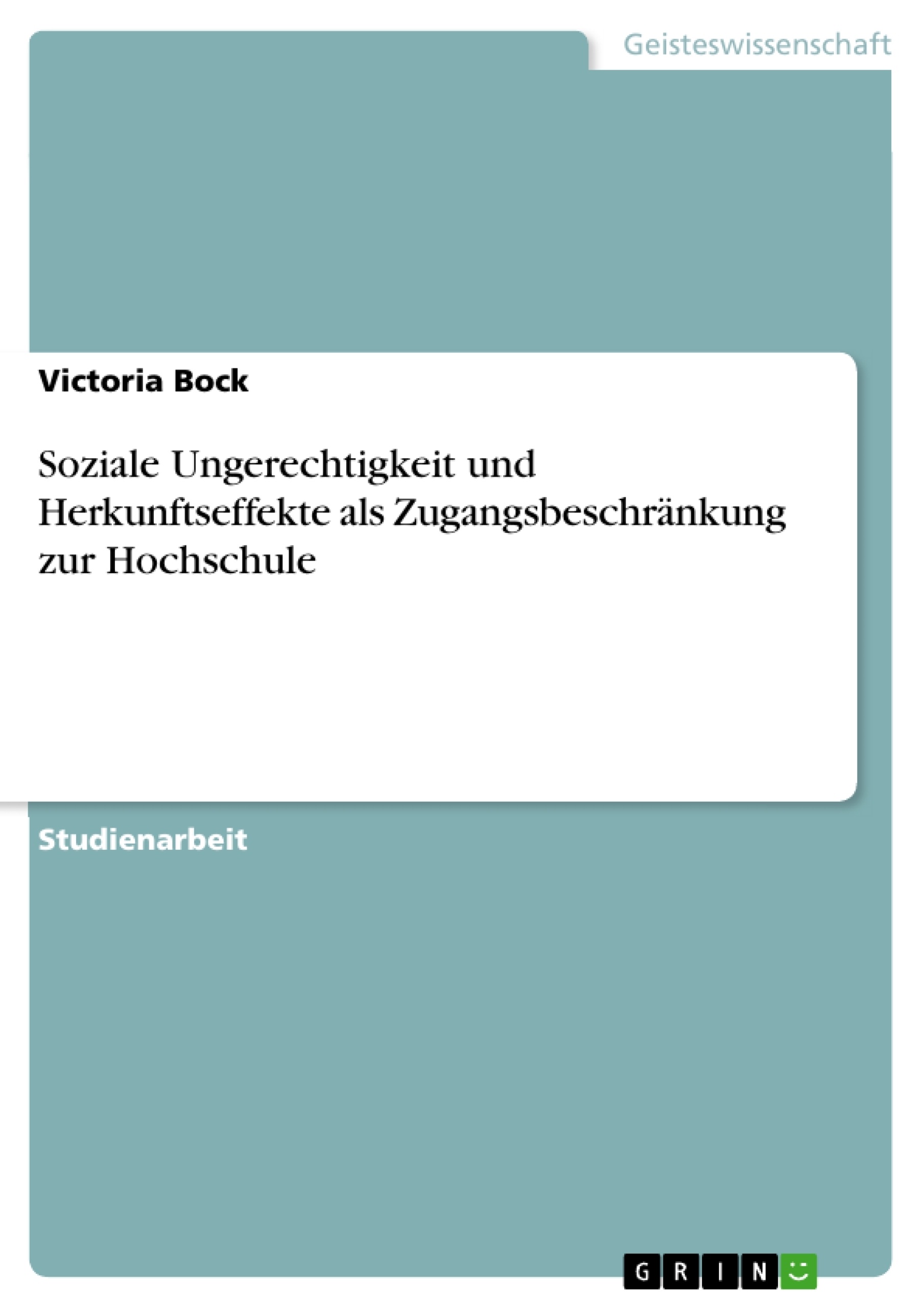„Bildung soll allen zugänglich sein. Man darf keine Standesunterschiede machen.“ Konfuzius
1. Einleitung
Ungleichheiten im Bereich der Bildung sind ein Merkmal, welches in allen modernen Gesell-schaften auftritt. Doch gerade in Deutschland sind Chancenungleichheiten beim Bildungszugang besonders groß, was nicht zuletzt die PISA Studien belegen.
Höhere Bildung ist heute noch immer ein Privileg von ohnehin schon privilegierten Sozial-schichten (vgl. Becker 2009, S.85).
In dieser Arbeit soll erläutert werden wie es zu solchen Chancenungleichheiten in der Gesellschaft überhaupt kommen kann und wie in der Vergangenheit, mittels Reformen versucht wurde diesen Zustand zu ändern. Anschließend werde ich versuchen zu klären warum es so wenige Arbeiterkinder an deutschen Universitäten gibt und werde einen Ausblick darauf geben, was man tun könnte um diese Situation zu ändern.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Bildungsexpansion
- 3. Folgen der Bildungsexpansion/ Reform
- 4. Raymond Boudon – Primäre und sekundäre Herkunftseffekte beim Hochschulzugang
- 4.1. Primäre Effekte
- 4.2. Sekundäre Effekte
- 5. Pierre Bourdieu – Reproduktionsansatz
- 6. Warum gibt es so wenige Arbeiterkinder an deutschen Universitäten?
- 6.1 Frühe Aufteilung in Bildungslaufbahnen
- 6.2 Berufsausbildung als scheinbar bessere Alternative?
- 7. Fazit und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit analysiert die Entstehung und die Auswirkungen von Chancenungleichheiten im Bildungssystem, insbesondere im Hinblick auf den Zugang zur Hochschule. Dabei werden die Auswirkungen der Bildungsexpansion und die Rolle von Herkunftseffekten im Bildungsverlauf untersucht.
- Chancenungleichheit im deutschen Bildungssystem
- Bildungsexpansion und ihre Folgen
- Herkunftseffekte und deren Einfluss auf den Hochschulzugang
- Reproduktionsansätze in der Bildungssoziologie
- Gründe für die geringe Anzahl von Arbeiterkindern an deutschen Universitäten
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema ein und stellt die zentrale Fragestellung der Arbeit dar. Kapitel 2 befasst sich mit der Bildungsexpansion in Deutschland, ihren Ursachen und ihren Folgen. Kapitel 3 analysiert die Auswirkungen der Bildungsexpansion auf das Bildungssystem und die Gesellschaft. Kapitel 4 stellt die Theorien von Raymond Boudon zu primären und sekundären Herkunftseffekten im Zusammenhang mit dem Hochschulzugang vor. Kapitel 5 behandelt den Reproduktionsansatz von Pierre Bourdieu und seine Bedeutung für die Erklärung von Bildungsungleichheiten. Kapitel 6 untersucht die Gründe für die geringe Anzahl von Arbeiterkindern an deutschen Universitäten. Das Fazit und der Ausblick fassen die zentralen Ergebnisse der Arbeit zusammen und geben einen Ausblick auf zukünftige Forschungsansätze.
Schlüsselwörter
Bildungsexpansion, Chancenungleichheit, Herkunftseffekte, Hochschulzugang, Reproduktionsansatz, Arbeiterkinder, Bildungssoziologie, PISA-Studien.
Häufig gestellte Fragen
Was sind primäre und sekundäre Herkunftseffekte?
Primäre Effekte betreffen die Schulleistung, sekundäre Effekte die Bildungsentscheidungen der Eltern unabhängig von der Leistung (nach Raymond Boudon).
Warum erreichen weniger Arbeiterkinder die Hochschule?
Gründe sind unter anderem die frühe Aufteilung in Bildungslaufbahnen und die Wahrnehmung der Berufsausbildung als sicherere Alternative.
Was besagt Bourdieus Reproduktionsansatz?
Dass das Bildungssystem soziale Ungleichheit eher reproduziert als abbaut, indem es kulturelles Kapital privilegierter Schichten belohnt.
Was ist Bildungsexpansion?
Die massive Ausweitung der Bildungsbeteiligung seit den 1960er Jahren, die jedoch die Chancenungleichheit nicht vollständig beseitigt hat.
Welche Rolle spielen die PISA-Studien?
Sie belegen empirisch den starken Zusammenhang zwischen sozialer Herkunft und Bildungserfolg in Deutschland.
- Quote paper
- Victoria Bock (Author), 2011, Soziale Ungerechtigkeit und Herkunftseffekte als Zugangsbeschränkung zur Hochschule, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/170128