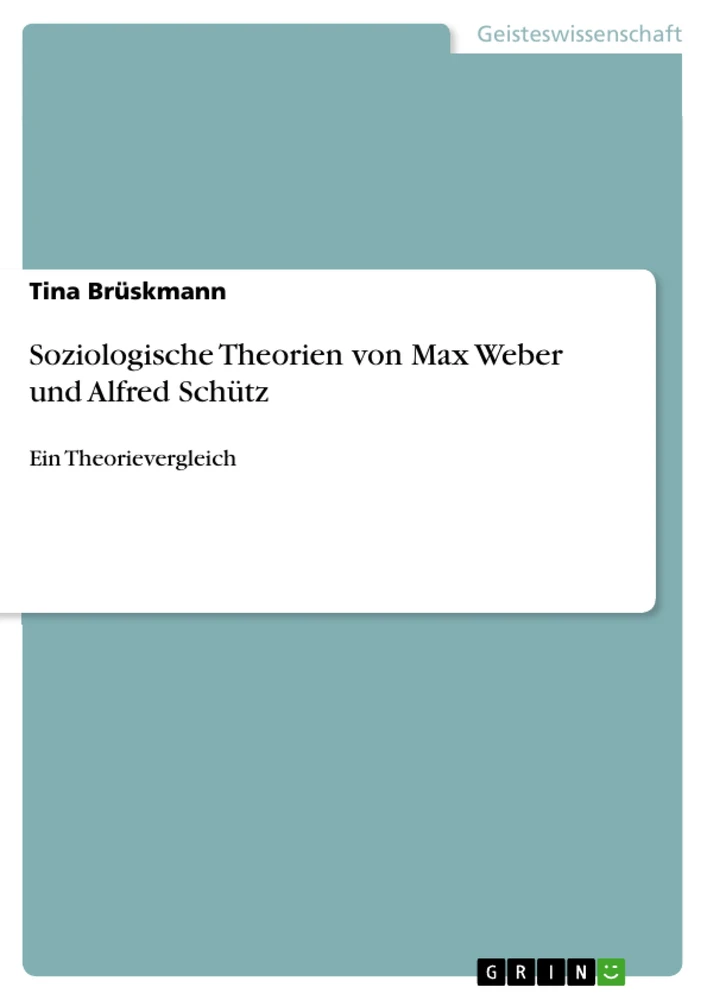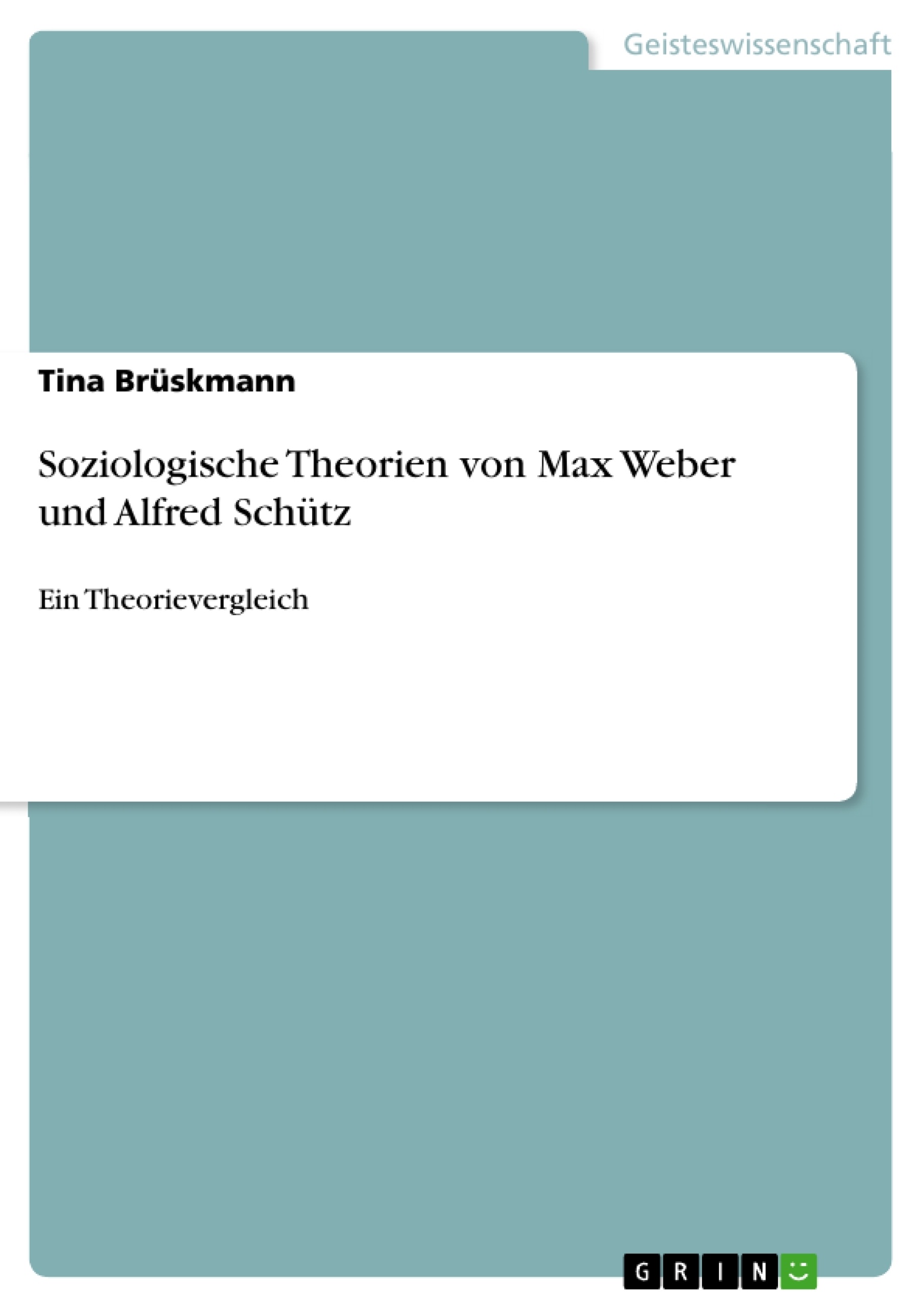Diese Ausarbeitung beschäftigt sich mit den Handlungstheorien von Max Weber, einem der Gründerväter der deutschen Soziologie, und dem Begründer der phänomenologischen Soziologie Alfred Schütz, dessen Erkenntnisse unter anderem von denen Max Webers ausgingen.
Zunächst werden die einzelnen Theorien mit ihren wichtigsten Definitionen, Begriffen und Inhalten vorgestellt. Daraufhin werden sie in einem Vergleich gegenübergestellt. Hierbei wird vor allem auf ihren Zugang zum subjektiven Sinn des Akteurs, die Möglichkeiten des Verstehens und das Alltagsverstehen der Akteure eingegangen. Anschließend wird kurz erklärt was man unter Emergenz versteht und die Theorien daraufhin geprüft.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Zwei Theorien
- 2.1 Die Handlungstheorie von Max Weber
- 2.2 Die Handlungstheorie von Alfred Schütz
- 3. Der Theorievergleich zwischen Weber und Schütz
- 3.1 Der subjektive Sinn und das Verstehen
- 3.2 Die Emergenz bei Weber und Schütz
- 4. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit hat zum Ziel, die Handlungstheorien von Max Weber und Alfred Schütz zu vergleichen und ihre Gemeinsamkeiten und Unterschiede herauszuarbeiten. Der Fokus liegt dabei auf dem Verständnis des subjektiven Sinns, dem Verstehen sozialen Handelns und dem Konzept der Emergenz.
- Vergleich der Handlungstheorien von Max Weber und Alfred Schütz
- Analyse des subjektiven Sinns im Handeln
- Untersuchung des Verstehens sozialen Handelns
- Behandlung des Konzepts der Emergenz in beiden Theorien
- Gegenüberstellung der methodischen Ansätze
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik ein und beschreibt den Gegenstand der Arbeit: einen Vergleich der Handlungstheorien von Max Weber und Alfred Schütz. Es wird der methodische Aufbau der Arbeit skizziert, der die einzelnen Theorien zunächst getrennt vorstellt, um sie anschließend vergleichend gegenüberzustellen. Besonderes Augenmerk wird auf den subjektiven Sinn, das Verstehen und das Konzept der Emergenz gelegt. Die Einleitung umreißt kurz die Bedeutung der beiden Soziologen und ihre unterschiedlichen Ansätze zur Erklärung sozialen Handelns.
2. Zwei Theorien: Dieses Kapitel dient der Vorstellung der Handlungstheorien von Max Weber und Alfred Schütz. Es bildet die Grundlage für den anschließenden Vergleich. Es werden die zentralen Begriffe und Konzepte beider Theorien erläutert, um ein umfassendes Verständnis ihrer jeweiligen Argumentationen zu schaffen. Die einzelnen Abschnitte bieten einen detaillierten Einblick in die Kernpunkte der jeweiligen Theorie, ohne den Vergleich vorwegzunehmen.
3. Der Theorievergleich zwischen Weber und Schütz: Dieses Kapitel stellt die beiden im vorherigen Kapitel vorgestellten Handlungstheorien gegenüber. Es vergleicht detailliert die jeweiligen Ansätze zum subjektiven Sinn, dem Verstehen und der Emergenz. Die Unterschiede und Gemeinsamkeiten werden prägnant herausgearbeitet, indem die Argumentationslinien der beiden Autoren explizit gegeneinander abgewogen werden. Dieser Vergleich zeigt die jeweilige Stärke und Schwäche der einzelnen theoretischen Konzepte auf und liefert so einen umfassenden Überblick über die unterschiedlichen Perspektiven auf soziales Handeln.
Schlüsselwörter
Handlungstheorie, Max Weber, Alfred Schütz, subjektiver Sinn, Verstehen, soziales Handeln, Emergenz, phänomenologische Soziologie, Idealtypus, Alltagshandeln, Intersubjektivität.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zum Vergleich der Handlungstheorien von Max Weber und Alfred Schütz
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit vergleicht die Handlungstheorien von Max Weber und Alfred Schütz. Der Fokus liegt auf dem Verständnis des subjektiven Sinns, dem Verstehen sozialen Handelns und dem Konzept der Emergenz. Die Arbeit untersucht Gemeinsamkeiten und Unterschiede beider Theorien und bewertet deren methodische Ansätze.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themen: Vergleich der Handlungstheorien von Max Weber und Alfred Schütz; Analyse des subjektiven Sinns im Handeln; Untersuchung des Verstehens sozialen Handelns; Behandlung des Konzepts der Emergenz in beiden Theorien; Gegenüberstellung der methodischen Ansätze.
Wie ist die Arbeit aufgebaut?
Die Arbeit besteht aus einer Einleitung, einem Kapitel zur Vorstellung der einzelnen Theorien von Weber und Schütz, einem Kapitel zum detaillierten Vergleich beider Theorien und einem Fazit. Die Einleitung beschreibt den Gegenstand und die Methode der Arbeit. Das zweite Kapitel erläutert die zentralen Begriffe und Konzepte der jeweiligen Theorie. Das dritte Kapitel vergleicht die Ansätze beider Autoren zum subjektiven Sinn, Verstehen und Emergenz, wobei Unterschiede und Gemeinsamkeiten herausgearbeitet werden.
Welche Kapitel gibt es und worum geht es in jedem Kapitel?
Kapitel 1 (Einleitung): Einführung in die Thematik, Beschreibung des Vergleichs von Webers und Schützes Handlungstheorien, Skizzierung des methodischen Aufbaus, Fokus auf subjektiven Sinn, Verstehen und Emergenz, kurze Vorstellung der Soziologen und ihrer Ansätze. Kapitel 2 (Zwei Theorien): Vorstellung der Handlungstheorien von Max Weber und Alfred Schütz, Erläuterung zentraler Begriffe und Konzepte, detaillierter Einblick in die Kernpunkte beider Theorien. Kapitel 3 (Theorievergleich): Vergleich der Handlungstheorien, detaillierte Gegenüberstellung der Ansätze zu subjektivem Sinn, Verstehen und Emergenz, Herausarbeitung von Unterschieden und Gemeinsamkeiten, Bewertung der Stärken und Schwächen der theoretischen Konzepte. Kapitel 4 (Fazit): Zusammenfassung der Ergebnisse und Schlussfolgerungen.
Welche Schlüsselwörter sind relevant?
Handlungstheorie, Max Weber, Alfred Schütz, subjektiver Sinn, Verstehen, soziales Handeln, Emergenz, phänomenologische Soziologie, Idealtypus, Alltagshandeln, Intersubjektivität.
Was ist das Ziel der Arbeit?
Das Ziel der Arbeit ist der Vergleich der Handlungstheorien von Max Weber und Alfred Schütz, um Gemeinsamkeiten und Unterschiede herauszuarbeiten. Der Fokus liegt auf dem Verständnis des subjektiven Sinns, dem Verstehen sozialen Handelns und dem Konzept der Emergenz.
- Quote paper
- Tina Brüskmann (Author), 2009, Soziologische Theorien von Max Weber und Alfred Schütz, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/170155