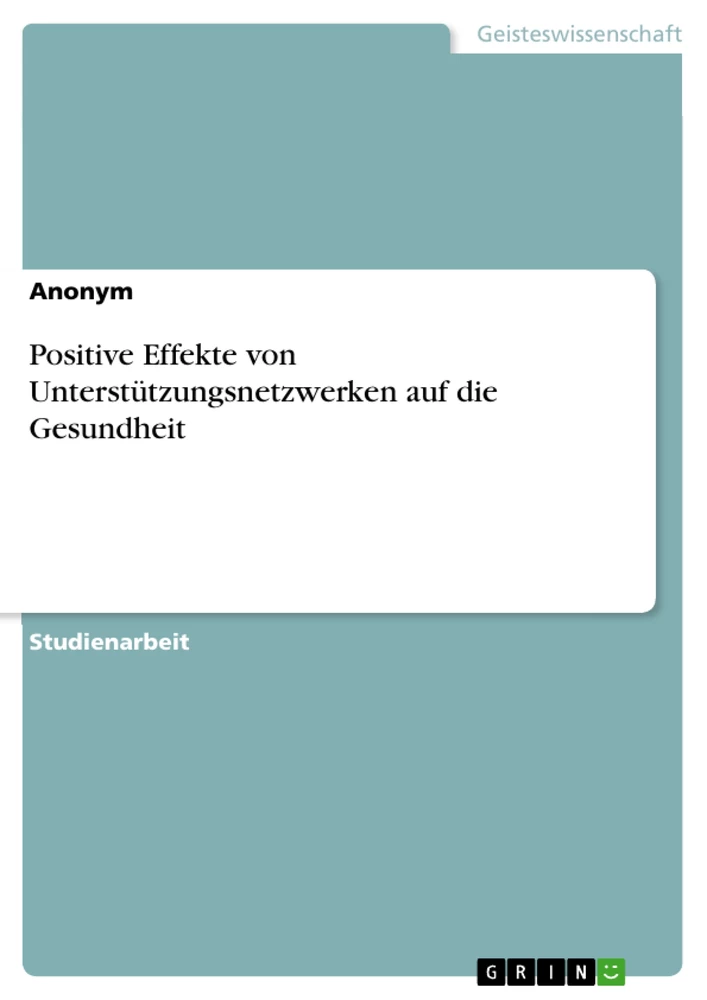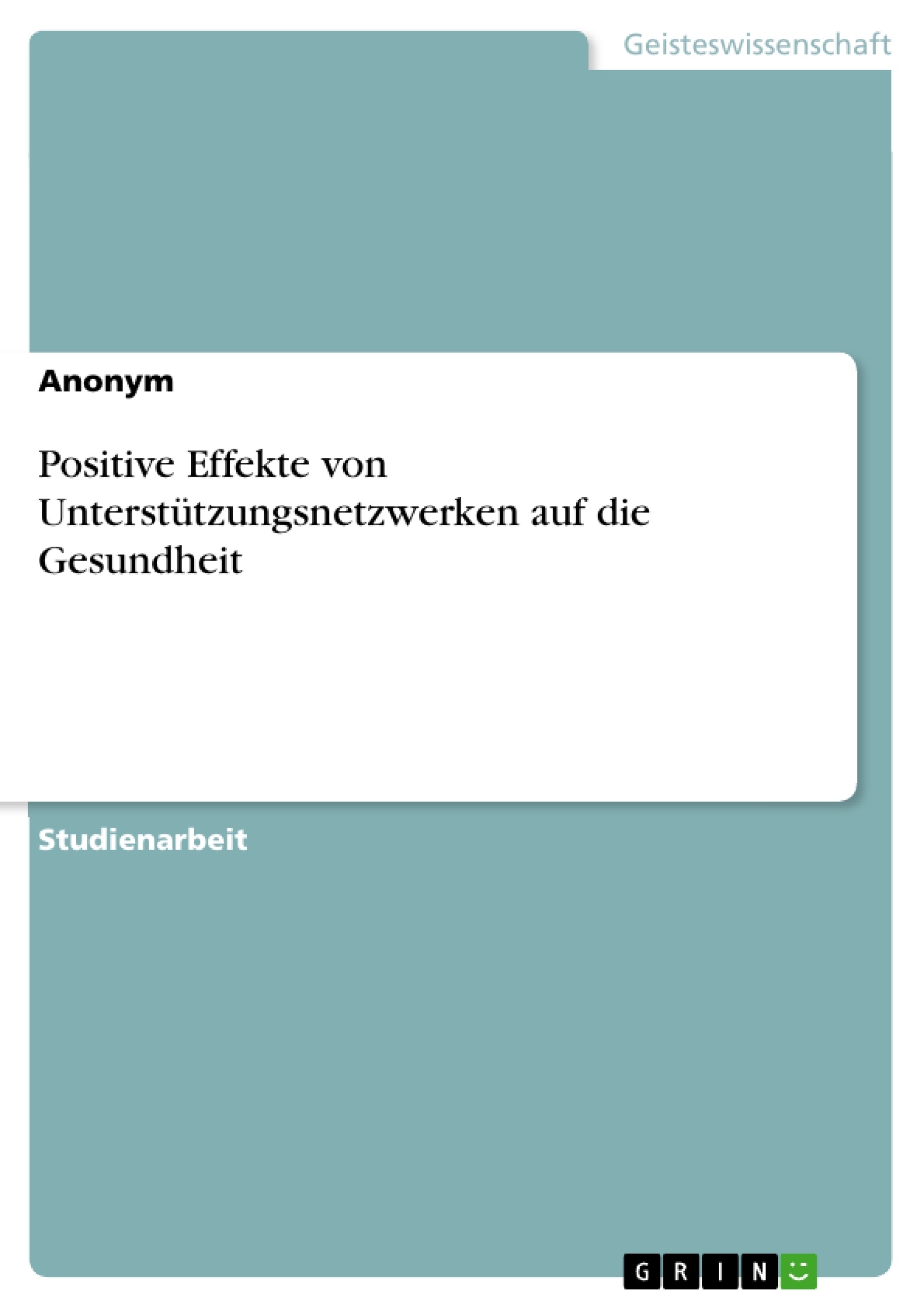Private Unterstützungssysteme wie Familie, Freundeskreis
oder Nachbarn und durch sie erfolgende Unterstützungsleis-
tungen können bei Alltagsproblemen oder akuten Krisen und
auch anderen, Stress auslösenden Ereignissen von wesentli-
cher Hilfe für den Betroffenen sein. Die meisten psychosozia-
len Probleme werden ganz ohne professionelle Hilfe (i.S. von
Psychologen, Ärzte, Seelsorger oder andere Helfersysteme)
im Familien, Verwandten-, Freundes-, Bekannten-, Nachbar-,
oder Kollegenkreis gelöst (Nestmann 1993: 5). Laireiter be-
zeichnet solche Unterstützungsnetzwerke sogar als die „dritte
Haut“ des Menschen (nach der des Körpers und der Klei-
dung) (Laireiter 2009: 75). Die vorliegende Arbeit möchte
die positiven Effekte von sozialen informellen Unterstüt-
zungsnetzwerken auf die Gesundheit unter besonderer Be-
rücksichtigung der Wirkungsmodelle des Direkt- und Puffer-
effekt und der Erweiterbarkeit dieser Modelle herausarbeiten.
Dazu werden die Konzepte des sozialen Netzwerks, der sozi-
alen Beziehung und der sozialen Unterstützung erläutert und
eventuelle Schwierigkeiten bei Ihrer Typologisierung aufge-
zeigt. Gesundheit wird als Wohlbefinden oder Abwesenheit
von Allgemeinbeschwerden definiert (Jungbauer-Gans 2002:
12). Um sich den Wirkungen von sozialer Unterstützung zu
nähern, müssen zunächst die mit ihr zusammenhängenden
Begrifflichkeiten des sozialen Netzwerkes, der sozialen Be-
ziehung und der sozialen Unterstützung geklärt werden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Soziales Netzwerk
- Soziale Beziehung
- Soziale Unterstützung (Social Support)
- Inhaltliche Leistungen informeller Beziehungen
- Wirkungsmodelle sozialer Unterstützung
- Direkt- oder Haupteffekt-These
- Puffereffekt
- Erweiterungen und Ergänzungen der Modelle
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit den positiven Effekten von informellen sozialen Unterstützungsnetzwerken auf die Gesundheit. Dabei werden die Wirkungsmodelle des Direkt- und Puffereffekts sowie deren Erweiterbarkeit näher beleuchtet. Zudem werden die Konzepte des sozialen Netzwerks, der sozialen Beziehung und der sozialen Unterstützung erläutert und mögliche Schwierigkeiten bei ihrer Typologisierung aufgezeigt.
- Analyse der Wirkungsmodelle sozialer Unterstützung (Direkt- und Puffereffekt)
- Erläuterung der Konzepte des sozialen Netzwerks, der sozialen Beziehung und der sozialen Unterstützung
- Betrachtung der Bedeutung von sozialen Netzwerken für die Gesundheit
- Untersuchung der Typologisierung von sozialen Netzwerken und Beziehungen
- Diskussion der Reziprozität als Grundlage von Unterstützungsnetzwerken
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung stellt die Bedeutung von informellen sozialen Unterstützungsnetzwerken für die Bewältigung von Alltagsproblemen und Krisen heraus. Sie führt das Konzept der „dritten Haut“ von Laireiter ein und beschreibt die Zielsetzung der Arbeit, die positiven Effekte dieser Netzwerke auf die Gesundheit zu untersuchen.
- Soziales Netzwerk: Dieses Kapitel definiert das Konzept des sozialen Netzwerks und erläutert seine verschiedenen Formen. Es beleuchtet die Bedeutung von Netzwerken für die Analyse sozialer Beziehungen und die Untersuchung von sozialen Phänomenen.
- Soziale Beziehung: Dieses Kapitel definiert den Begriff der sozialen Beziehung und erläutert ihre Bedeutung für die menschliche Entwicklung und das Wohlbefinden. Es zeigt die Variabilität sozialer Beziehungen in Abhängigkeit von Kontext, Anlass und Dauer.
- Soziale Unterstützung (Social Support): Dieses Kapitel definiert den Begriff der sozialen Unterstützung und erläutert seine Bedeutung für die Gesundheit. Es beschreibt die verschiedenen Formen von sozialer Unterstützung und die Reziprozität als Grundlage für das Funktionieren von Unterstützungsnetzwerken.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf die Themen soziale Unterstützung, soziale Netzwerke, soziale Beziehungen, Gesundheit, Direkteffekte, Puffereffekte, Reziprozität und Typologisierung.
Häufig gestellte Fragen
Wie beeinflussen private Unterstützungsnetzwerke die Gesundheit?
Private Netzwerke wie Familie und Freunde helfen bei der Bewältigung von Stress und Krisen, was sich positiv auf das psychische und physische Wohlbefinden auswirkt.
Was versteht man unter dem Begriff „Direkteffekt“?
Die Direkteffekt-These besagt, dass soziale Integration und Unterstützung generell gesundheitsfördernd wirken, unabhängig davon, ob aktuell eine Stresssituation vorliegt.
Was ist der „Puffereffekt“ in sozialen Beziehungen?
Der Puffereffekt besagt, dass soziale Unterstützung die negativen Auswirkungen von Stress auf die Gesundheit abmildert, indem sie als Schutzschild fungiert.
Warum bezeichnet Laireiter Unterstützungsnetzwerke als „dritte Haut“?
Dieser Begriff verdeutlicht, dass soziale Netzwerke nach dem Körper und der Kleidung eine lebensnotwendige Schutzschicht für den Menschen darstellen.
Welche Rolle spielt Reziprozität in diesen Netzwerken?
Reziprozität, also das Prinzip von Geben und Nehmen, ist die Grundlage für das langfristige Funktionieren und die Stabilität informeller Unterstützungsbeziehungen.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2011, Positive Effekte von Unterstützungsnetzwerken auf die Gesundheit, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/170242