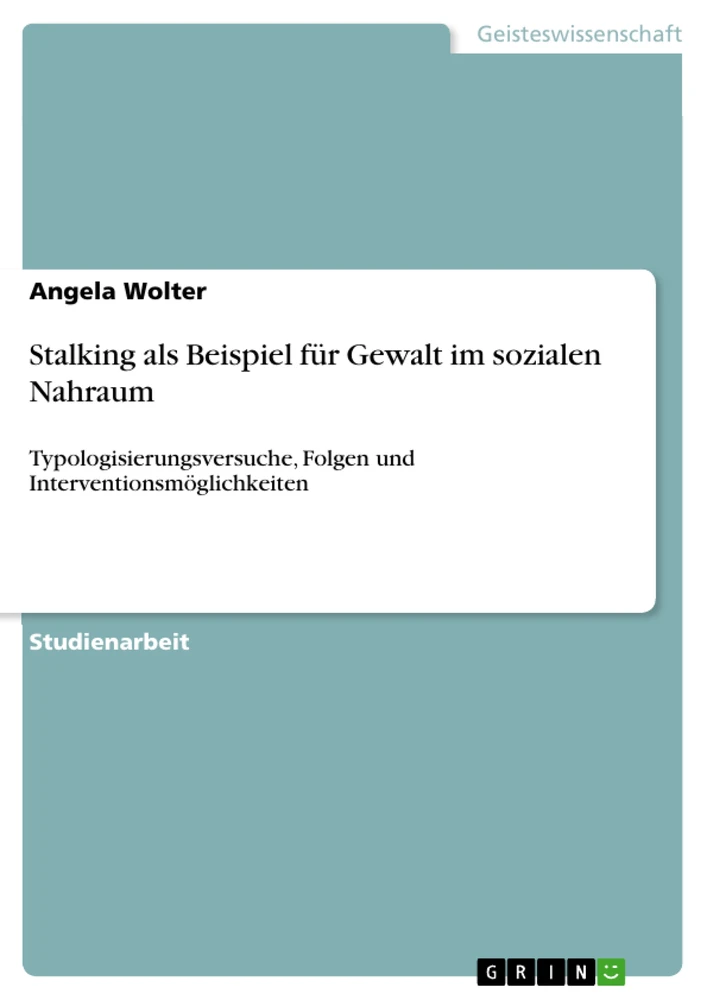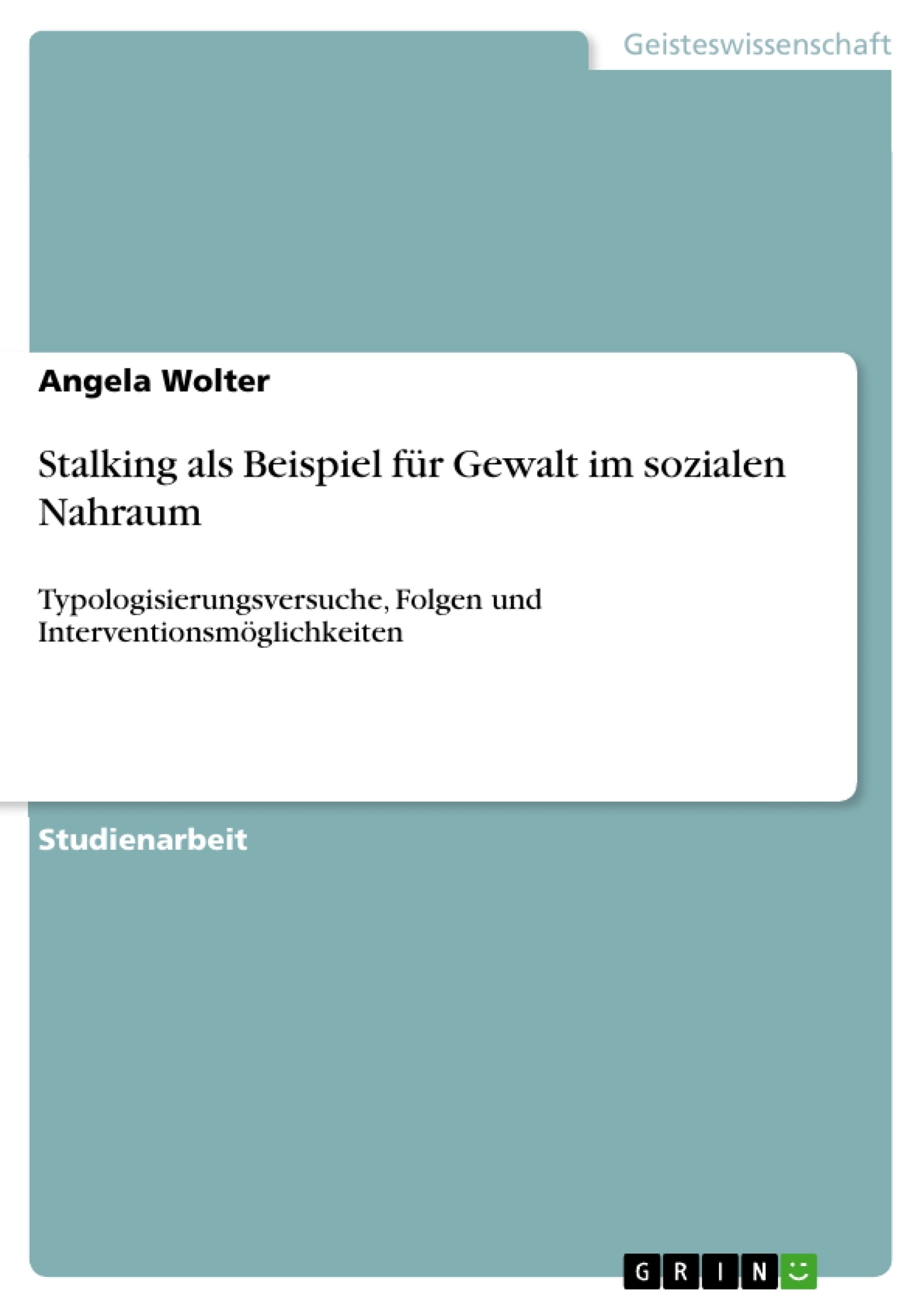Der englische Begriff „Stalking“ bzw. „to stalk“ lässt sich in etwa mit den Begriffen „anschleichen“ oder „auf die Pirsch gehen“ übersetzen. Hinter dem Anglizismus verbirgt sich ganz allgemein eine „vom Opfer nicht intendierte exzessive Verfolgung eines Menschen mit andauernder oder wiederholter Belästigung, Bedrohung oder gar Ausübung von Gewalt“ (Fiedler 2006:1).
Die vorliegende Hausarbeit unternimmt den Versuch, das Phänomen Stalking in seinen unterschiedlichen Facetten zu beleuchten und auf diese Weise die Herausforderungen für ein entsprechendes Beratungsangebot darzustellen.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung: Stalking – ein neues Phänomen?
- Exkurs: Stalking und Mobbing/Bullying - Abgrenzungsversuche
- 2 Rechtliche Rahmenbedingungen
- 3 Prävalenz
- 4 Typologisierungsversuche
- 4.1 Stalking-Typologie nach Zona et al. (1993)
- 4.2 Stalking-Typologie nach Harmon et al. (1995)
- 4.3 Stalking-Typologie nach Kienlen et al. (1997)
- 4.4 Stalking-Typologie nach Schwartz-Watts und Morgan (1998)
- 4.5 Stalking-Typologie nach DeBecker (1997)
- 4.6 Stalking-Typologie nach Mullen et al. (1999)
- 4.7 Stalking-Typologie nach Dreßing und Gass (2005)
- 5 Die Opfer des Stalking: Stalkees
- 5.1 Wer wird gestalkt – und warum?
- 5.2 Folgen
- 6 Präventions- und Interventionsmöglichkeiten
- 6.1 Präventionsmöglichkeiten: Stalking vermeiden und verhindern
- 6.2 Interventionsmöglichkeiten: Sich gegen Stalking zur Wehr setzen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Hausarbeit widmet sich dem Phänomen des Stalking. Ziel ist es, das Thema umfassend zu beleuchten und die Herausforderungen für ein Beratungsangebot im Kontext von häuslicher und sexualisierter Gewalt aufzuzeigen. Die Arbeit beleuchtet verschiedene Aspekte des Stalking, wie z.B. die rechtlichen Rahmenbedingungen, Prävalenz, Typologisierung, die Folgen für die Opfer und mögliche Präventions- und Interventionsmöglichkeiten.
- Rechtliche Definition und Einordnung von Stalking
- Typologisierung von Stalking-Verhaltensweisen
- Folgen von Stalking für die Opfer (Stalkees)
- Präventionsmöglichkeiten, um Stalking zu vermeiden
- Interventionsmöglichkeiten für Stalking-Opfer
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung beleuchtet die Geschichte des Begriffs "Stalking" und veranschaulicht die Bedeutung sozialer Normen für die Definition von Stalking. Im Anschluss werden verschiedene Definitionen von Stalking im klinisch-wissenschaftlichen und juristischen Kontext vorgestellt. Der Exkurs beleuchtet die Abgrenzung des Begriffs Stalking zu Mobbing/Bullying und stellt Unterschiede und Gemeinsamkeiten beider Phänomene dar.
Kapitel 2 behandelt die rechtlichen Rahmenbedingungen von Stalking, wobei die Unterscheidung zwischen "leichtem" und "schwerem" Stalking herausgestellt wird. Kapitel 3 befasst sich mit der Prävalenz von Stalking, während Kapitel 4 verschiedene Typologisierungsversuche von Stalking-Verhaltensweisen präsentiert.
Kapitel 5 befasst sich mit den Opfern des Stalking ("Stalkees"), wobei Fragen nach den Gründen für das Stalking und den Folgen für die Opfer im Vordergrund stehen. In Kapitel 6 werden Präventions- und Interventionsmöglichkeiten zur Vermeidung und Abwehr von Stalking aufgezeigt.
Schlüsselwörter
Stalking, Gewalt im sozialen Nahraum, Typologie, Prävalenz, Folgen, Opfer, Stalkees, Prävention, Intervention, Mobbing/Bullying, Rechtliche Rahmenbedingungen, Beratung, Häusliche Gewalt, Sexualisierte Gewalt.
Häufig gestellte Fragen
Was bedeutet der Begriff „Stalking“?
Stalking beschreibt die exzessive Verfolgung, Belästigung oder Bedrohung eines Menschen, die vom Opfer nicht gewollt ist.
Wie unterscheidet sich Stalking von Mobbing?
Die Arbeit enthält einen Exkurs zur Abgrenzung beider Phänomene, wobei Stalking oft stärker auf eine einzelne Person im privaten oder sozialen Nahraum fixiert ist.
Welche psychologischen Folgen hat Stalking für Opfer?
Opfer (Stalkees) leiden oft unter massiven psychischen Belastungen, Angstzuständen und Einschränkungen ihrer Lebensqualität.
Welche Typen von Stalkern gibt es?
Die Arbeit stellt verschiedene wissenschaftliche Typologien vor, unter anderem nach Mullen et al. oder Zona et al., um Täterprofile besser zu verstehen.
Wie kann man sich gegen Stalking zur Wehr setzen?
Es werden Präventions- und Interventionsmöglichkeiten aufgezeigt, von rechtlichen Schritten bis hin zur Inanspruchnahme spezialisierter Beratungsangebote.
- Arbeit zitieren
- Sozialarbeiterin/Sozialpädagogin, B.A. Angela Wolter (Autor:in), 2011, Stalking als Beispiel für Gewalt im sozialen Nahraum, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/170341