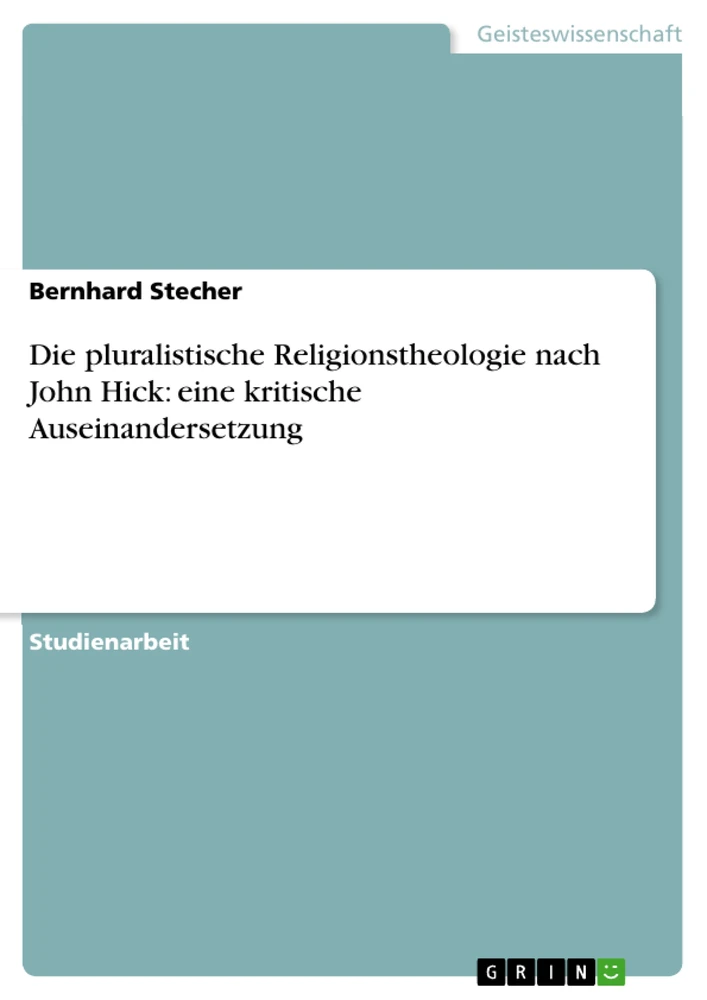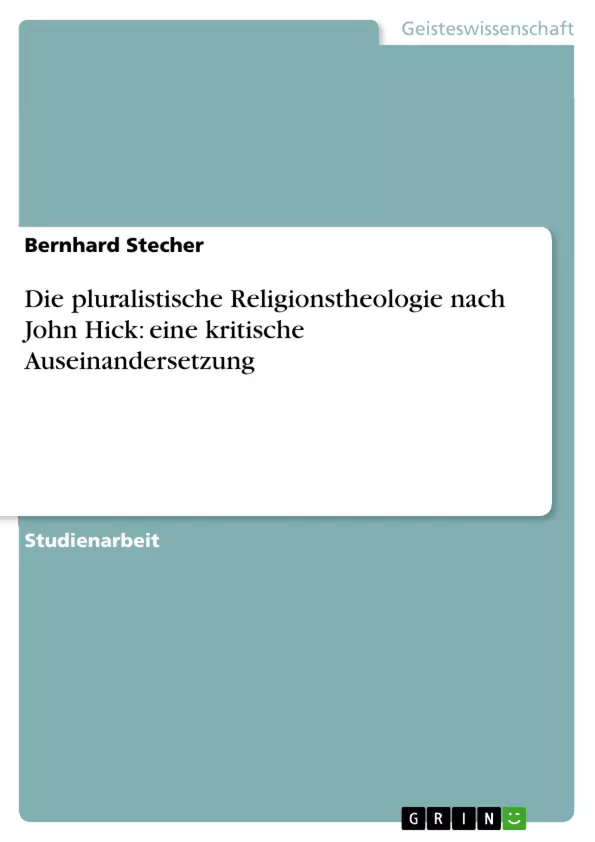In seinem Buch „Die Welt ist flach“ beschreibt der renommierte Kolumnist der „New York Times“ und dreifache Pulitz-Preisträger Thomas Friedman die zentralen Faktoren der Globalisierung, deren Dynamik sowie deren Auswirkungen auf die global gewordene Gegenwart. Seiner Analyse zufolge haben der Zusammenbruch des Kommunismus, das Aufkommen von modernen Kommunikations- und Verkehrsmitteln sowie der Siegeszug der Informationstechnologien, insbesondere im Bereich des Computers und des Internets, zu einer Art „Einebnung der Welt“ und einer Verzahnung der wirtschaftlichen und kulturellen Austauschbeziehungen geführt. In diesem „global village“, in dem Daten und Kapitalströme in sekundenschnelle von einem Winkel der Erde in einen anderen verschickt werden können, dominieren die Regeln der wirtschaftlichen Effizienz und der technischen Innovation, während „starre“ nationale, kulturelle und religiöse Bindekräfte zunehmend an Bedeutung verlieren, sich überlappen oder komplementär wirken. All diese Entwicklungen schlagen sich auch zwangsläufig auf das Zusammenleben unterschiedlicher Kulturen und Religionen nieder, die dazu genötigt werden, ihr eigenes Selbstverständnis und ihr Verhältnis mit- und zueinander aufgrund des direkten Kontakts mit dem Anderen neu zu bestimmen. Angesichts dieser Entwicklungen, die im Rahmen dieser Arbeit nur grob skizziert werden können, steht das Christentum vor der Herausforderung, in einen interreligiösen Dialog einzutreten, ohne seine eigenen Wurzeln aufzugeben bzw. eine Dialogform zu finden, die „zwischen der eigenen Identität und einer dialogfähigen Offenheit“ pendelt. Prima facie scheint das Konzept der pluralistischen Theologie der Religionen ein fruchtbarer Ansatz und Kompass zur „Lösung“ dieser Frage zu sein, das sich nahtlos in die pluralistische Postmoderne mit ihrem Hang zur Ästhetisierung des Denkens einweben lässt, weshalb es im Mittelpunkt dieser Arbeit stehen soll. Ziel der vorliegenden Arbeit ist es, das Gedankenkonzept der pluralistischen Religionstheologie von John Hick – dem mit Paul F. Knitter wohl renommiertesten Vertreter dieser Denkrichtung – zu entfalten, kritisch zu prüfen und auf seine Anwendbarkeit bzw. Praxistauglichkeit im Hinblick auf ein friedliches und fruchtbares Zusammenleben der unterschiedlichen Religionen zu analysieren.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- 1. Vom Umgang mit der religiösen Vielfalt
- 2. Die philosophischen und ideengeschichtlichen Wurzeln des Pluralismus und ihre Bedeutung für die pluralistische Religionstheologie.
- 3. Das Gedankengebäude der pluralistischen Religionstheologie nach John Hick.
- 4. Abgrenzung vom Relativismus: das soteriologische Kriterium
- 5. Kritik an der pluralistischen Religionstheologie von John Hick.
- 5.1 Kritik am soteriologischen Basiskriterium.
- 5.2 Innerchristliche Kritik
- 5.3 Kritik an der Dialogfähigkeit
- 6. Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit analysiert das Konzept der pluralistischen Religionstheologie von John Hick. Sie untersucht die historischen Wurzeln des Pluralismus und beleuchtet die zentrale These, dass alle Religionen gleichermaßen Heilsvermittlung ermöglichen. Die Arbeit betrachtet auch die kritischen Einwände gegen diese Sichtweise, insbesondere im Hinblick auf die Christologie und die Frage der Praxistauglichkeit im interreligiösen Dialog.
- Der Umgang mit der religiösen Vielfalt in modernen Gesellschaften
- Die philosophischen und ideengeschichtlichen Wurzeln des Pluralismus
- Die zentrale These der pluralistischen Religionstheologie nach John Hick
- Kritik an der pluralistischen Religionstheologie von John Hick
- Die Relevanz des pluralistischen Modells im Rahmen der interreligiösen Beziehungen
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung stellt die Relevanz des Themas der religiösen Vielfalt in der modernen Welt dar und führt in die zentrale Problemstellung der Arbeit ein. Sie skizziert den Zusammenhang zwischen Globalisierung, Pluralismus und dem interreligiösen Dialog.
- 1. Vom Umgang mit der religiösen Vielfalt: Dieses Kapitel beleuchtet die unterschiedlichen theologischen Perspektiven auf die religiöse Vielfalt und stellt die Modelle des Exklusivismus, Inklusivismus und Pluralismus vor.
- 2. Die philosophischen und ideengeschichtlichen Wurzeln des Pluralismus: Dieses Kapitel untersucht die philosophischen und ideengeschichtlichen Grundlagen der pluralistischen Religionstheologie. Es betrachtet die Entwicklung der Gedanken von der Ekklesiozentrik zur Theozentrik und Soteriozentrik.
- 3. Das Gedankengebäude der pluralistischen Religionstheologie nach John Hick: Hier wird das zentrale Konzept der pluralistischen Religionstheologie nach John Hick dargestellt und analysiert. Es werden die Grundzüge des Gedankengebäudes und die wichtigsten Argumentationslinien beleuchtet.
- 4. Abgrenzung vom Relativismus: das soteriologische Kriterium: Dieses Kapitel geht auf die Abgrenzung der pluralistischen Theologie vom Relativismus ein und erläutert das soteriologische Kriterium, das zur Beurteilung der unterschiedlichen Religionen herangezogen wird.
Schlüsselwörter
Die Arbeit fokussiert auf die zentralen Themen der religiösen Vielfalt, des Pluralismus und des interreligiösen Dialogs. Wichtige Schlüsselbegriffe sind Exklusivismus, Inklusivismus, Pluralismus, Christologie, Soteriologie, Globalisierung, Modernisierung und die pluralistische Religionstheologie nach John Hick.
Häufig gestellte Fragen
Was ist die zentrale These der pluralistischen Religionstheologie nach John Hick?
Hick postuliert, dass alle großen Weltreligionen verschiedene, aber gleichermaßen gültige Wege zur selben letztgültigen Realität („das Reale“) sind und gleichermaßen Heilsvermittlung ermöglichen.
Wie unterscheidet sich der Pluralismus vom Exklusivismus?
Während der Exklusivismus behauptet, nur die eigene Religion sei wahr, erkennt der Pluralismus die religiöse Vielfalt als legitim an und lehnt einen absoluten Wahrheitsanspruch einer einzelnen Religion ab.
Was versteht Hick unter dem „soteriologischen Kriterium“?
Es ist ein Maßstab zur Bewertung von Religionen: Eine Religion ist dann „wahr“ oder wertvoll, wenn sie die Transformation des Menschen von der Selbstzentriertheit zur Realzentriertheit (Soteriologie/Heil) fördert.
Welche Kritik gibt es an Hicks Modell aus christlicher Sicht?
Kritiker bemängeln, dass die Einzigartigkeit Christi (Christologie) aufgegeben wird und der interreligiöse Dialog durch die Einebnung von Unterschieden an Substanz verliert.
Welchen Einfluss hat die Globalisierung auf die Religionstheologie?
Durch die engere Vernetzung im „global village“ müssen Religionen ihr Verhältnis zueinander neu bestimmen. Der Pluralismus bietet hierbei einen theoretischen Rahmen für ein friedliches Zusammenleben.
- Quote paper
- Bernhard Stecher (Author), 2007, Die pluralistische Religionstheologie nach John Hick: eine kritische Auseinandersetzung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/170365