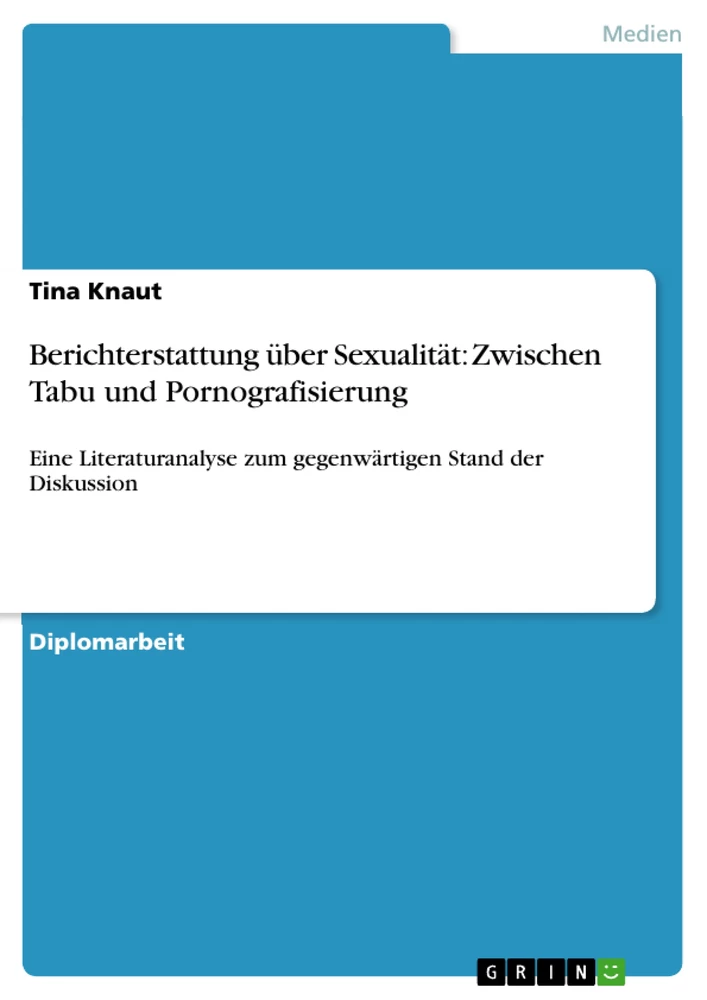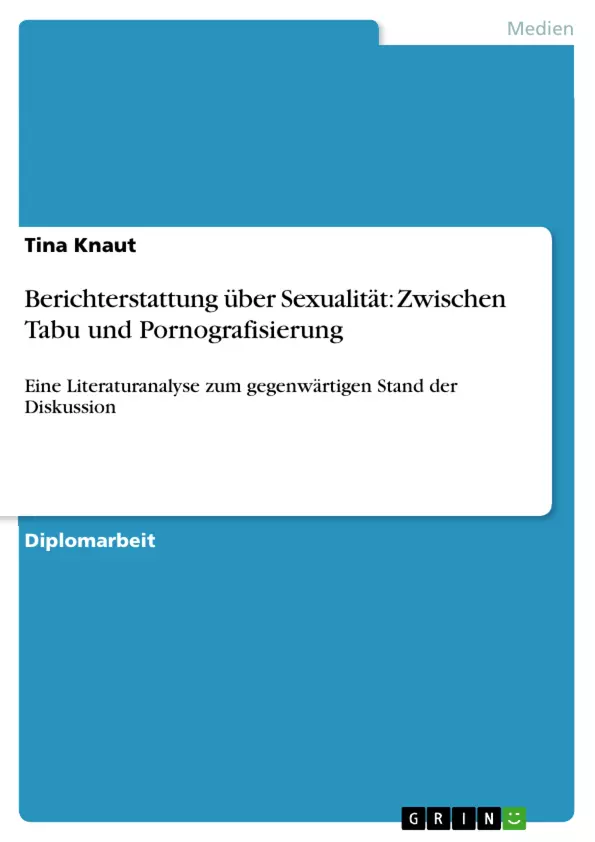Die Diplomarbeit „Berichterstattung über Sexualität: Zwischen Tabu und Pornografisierung“ liefert Erkenntnisse über die Darstellung von Sexualität in den Medien sowie über den aktuellen Forschungsstand zur Thematik. Dabei sind zwei Ausgangsfragen zentral für die Untersuchung: Gibt es in unserer sexualisierten Medienlandschaft eine seriöse journalistische Berichterstattung, die auch vormals tabuisierte Themen zur Sexualität umfassend und ausgewogen artikuliert? Und: Wie ist die mediale Darstellung von Sexualität bereits wissenschaftlich erfasst respektive welche Forschungslücken bestehen noch? Das Ziel dieser Arbeit ist es, einen „Übersichtsatlas“ zu schaffen, der die vorhandene wissenschaftliche Literatur zum Thema „Sexualität und Journalismus / Medien“ analysiert und kategorisiert.
Dazu wurden 87 wissenschaftliche Studien, Aufsätze und Monographien aus den Jahren 1985 bis 2010 gesichtet, inhaltlich erschlossen und bewertet. Eine Ausnahme zum vorgegebenen Zeitraum bildet die Analyse von zwei Werken aus den Jahren 1977 und 1980. Insgesamt erwiesen sich 31 Publikationen als relevant sowie thematisch passend. Sie wurden anhand einer Literaturanalyse erörtert, durch ein Stichwortverzeichnis kategorisiert und in verschiedene Koronen eingeteilt: Journalismus und Sexualität, Medieninhaltsforschung, Medienwirkungsforschung, Publikums- und Mediennutzungsforschung, Medien- und Sexualpädagogik sowie Kulturgeschichte. Wichtig war hierbei ein interdisziplinäres Vorgehen, das über die Journalistik hinausreicht. Durch die Analyse der Literatur auf einer Metaebene (Was wird von den Autoren vorrangig untersucht?) konnten Erkenntnisse zum gegenwärtigen Forschungs- und Diskussionsstand gewonnen werden.
Der theoretische Teil der Diplomarbeit beschäftigt sich eingehender mit einer Begriffsbestimmung zur Sexualität, mit der Bedeutung der Medien für die sexuelle Sozialisation und mit der Darstellung sexueller Medieninhalte. Dabei wird vor allem die journalistische Berichterstattung über Sexualität in den Fokus gerückt. Zudem wird erläutert, wo die Medien zwischen Pornografisierung auf der einen und (immer noch existenter) Tabuisierung auf der anderen Seite zu verorten sind. Der literaturanalytische Teil der Arbeit fasst in kompakten Abstracts zusammen, was andere Forscher bislang in ihren Studien zu Medien und Sexualität untersucht haben, wie methodisch vorgegangen wurde, was die wichtigsten Resultate sind und wie die jeweilige Studie zu bewerten ist.
Inhaltsverzeichnis
- Abstract
- English Abstract
- Abkürzungsverzeichnis
- 1 EINFÜHRUNG
- 1.1 Problemdarstellung
- 1.2 Gegenstand und Ziel der Untersuchung
- 1.2.1 Erkenntnisinteresse
- 1.2.2 Forschungsfragen
- 1.3 Methodik und Vorgehensweise
- 1.3.1 Untersuchungsdesign
- 1.3.2 Literaturanalyse
- 1.3.3 Zur Literaturauswahl
- 1.4 Konzeption und Struktur der Arbeit
- 2 SEXUALITÄT UND SEXUELLE MEDIENINHALTE
- 2.1 Eine Begriffsbestimmung zur Sexualität
- 2.2 Sexuelle Sozialisation durch Medien
- 2.3 Mediale Darstellungen von Sexualität
- 2.3.1 Journalistische Berichterstattung über Sexualität
- 2.3.2 Zwischen Pornografisierung und Tabuisierung
- 3 LITERATURANALYSE
- 3.1 Erste Korona: Journalismus und Sexualität
- 3.2 Zweite Korona: Medieninhaltsforschung
- 3.3 Dritte Korona: Medienwirkungsforschung
- 3.4 Vierte Korona: Weitere Forschungsgebiete
- 3.4.1 Publikums- und Mediennutzungsforschung
- 3.4.2 Medien- und Sexualpädagogik
- 3.4.3 Kulturgeschichte
- 4 RESÜMEE UND DISKUSSION
- 4.1 Fazit und Zusammenfassung der Literaturanalyse
- 4.1.1 Ergebnisse zur medialen Darstellung von Sexualität
- 4.1.2 Ergebnisse zum aktuellen Forschungsstand
- 4.2 Implikationen für den medialen Umgang mit Sexualität
- 4.3 Limitationen und Ausblick
- 5 LITERATURVERZEICHNIS
- 6 STICHWORTVERZEICHNIS
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Diplomarbeit untersucht die journalistische Berichterstattung über Sexualität im 21. Jahrhundert. Durch die Analyse von 31 wissenschaftlichen Publikationen werden die medialen Darstellungsformen von Sexualität beleuchtet und der aktuelle Forschungsstand zum Thema aufgezeigt. Darüber hinaus werden mögliche Forschungslücken identifiziert.
- Die mediale Darstellung von Sexualität in journalistischen Medien
- Der Einfluss von patriarchalen Sichtweisen auf die Berichterstattung über Sexualität
- Die Rolle von Pornografisierung und Tabuisierung in der Medienlandschaft
- Der aktuelle Forschungsstand zur medialen Darstellung von Sexualität
- Mögliche Forschungslücken und zukünftige Forschungsbedarfe
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die die Problemstellung, das Erkenntnisinteresse und die Forschungsfragen darlegt. Kapitel 2 beleuchtet den Begriff der Sexualität und die Rolle von Medien in der sexuellen Sozialisation. Kapitel 3 präsentiert die Ergebnisse der Literaturanalyse, die in vier Koronen gegliedert ist: Journalismus und Sexualität, Medieninhaltsforschung, Medienwirkungsforschung und weitere Forschungsgebiete. Die Ergebnisse der Literaturanalyse werden in Kapitel 4 zusammengefasst und diskutiert, wobei auch Implikationen für den medialen Umgang mit Sexualität sowie Limitationen und Ausblicke beleuchtet werden.
Schlüsselwörter
Journalistische Berichterstattung, Sexualität, Mediale Darstellung, Pornografisierung, Tabuisierung, Medieninhaltsforschung, Medienwirkungsforschung, Patriarchat, Forschungslücken.
- Quote paper
- Tina Knaut (Author), 2010, Berichterstattung über Sexualität: Zwischen Tabu und Pornografisierung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/170389