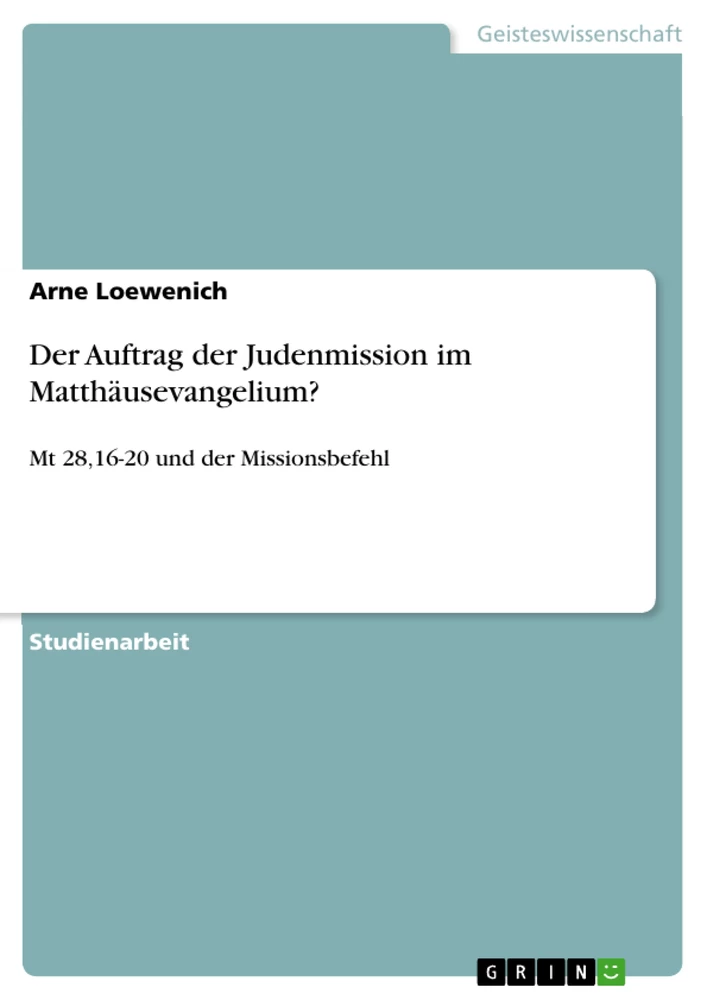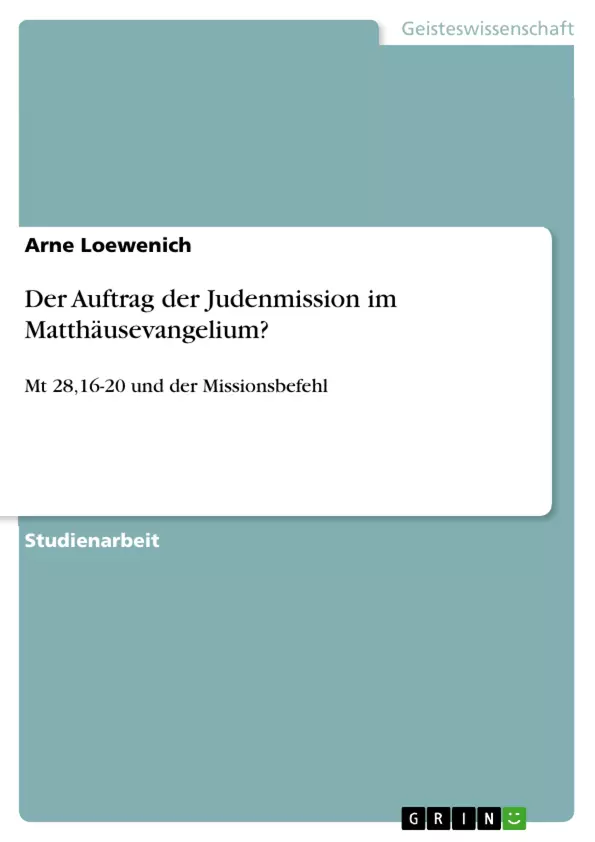In dieser Arbeit werde ich versuchen, die Auslegungsmöglichkeiten der Bibelstelle Mt 28,16-20 aufzuzeigen und diese bewerten. Dabei ist in der Hauptseminarsitzung zur Thematik am 14.01.2010 klar geworden, dass es schwierig ist, eine eindeutige Lösung zu finden, die gegen jedes Argument gewappnet ist. Dennoch sollte ein Theologiestudent sich eine eigene Meinung in dieser Missionsfrage herausarbeiten, um nicht leichtfertig der Übersetzung in der Einheitsübersetzung zu verfallen.
Zu Beginn beschreibe ich die Rahmendaten des Matthäusevangeliums, um einen Überblick darzustellen, in dem die Bibelstelle zu verstehen ist. Danach analysiere ich die Bibelstelle Mt 28,16-20, um sie im Folgenden zu bewerten und verschiedene Lösungsansätze zu skizzieren. Abschließend gehe ich auf einige historische Entscheidungen der römisch-katholischen Kirche ein, um die Brisanz dieses Evangeliumsabschlusses in der Geschichte auch als mahnendes Wort zu verdeutlichen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Einleitende Hintergrundinformationen
- Das Matthäusevangelium
- Umwelt des Matthäus
- Einordnung von Mt 28,16-20 in den Kontext des Evangeliums
- Analyse der Bibelstelle
- Erzählerische Einleitung (Mt 28,16-18a)
- Manifest des Auferweckten (Mt 28,18b-20)
- Das Vollmachtswort (Mt 28,18b)
- Der Sendungsauftrag (Mt 28,19.20a)
- Die Verheißung (Mt 28,20b)
- Bedeutung
- Hinweise im Matthäusevangelium auf die Weltvölkermission
- Auslegungsmöglichkeiten
- Die inklusive Deutung
- Die exklusive Deutung
- Wirkungsgeschichte
- Überblick Judenmission
- Von den Anfängen bis zum Zweiten Weltkrieg
- Das Zweite Vatikanische Konzil
- Aktuelle Diskussionsfelder
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Ziel dieser Arbeit ist es, die Auslegungsmöglichkeiten der Bibelstelle Mt 28,16-20 aufzuzeigen und zu bewerten. Dabei steht die Frage im Mittelpunkt, ob der Missionsbefehl Jesu am Ende des Matthäusevangeliums eine uneingeschränkte Missionierung aller Völker beinhaltet oder ob Israel von diesem Auftrag ausgenommen ist.
- Die Bedeutung des Missionsbefehls im Matthäusevangelium
- Die Rolle des Judentums im Missionsverständnis
- Die Auslegungsmöglichkeiten des Missionsbefehls (inklusive vs. exklusive Interpretation)
- Die historische Entwicklung der Missionspolitik der römisch-katholischen Kirche in Bezug auf die Juden
- Aktuelle Debatten und Herausforderungen im Kontext von Judenmission
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik des Missionsbefehls im Matthäusevangelium ein und stellt die Forschungsfrage nach der Einbeziehung oder Ausgrenzung Israels in den Missionsauftrag Jesu. Im nächsten Kapitel werden wichtige Hintergrundinformationen zum Matthäusevangelium, seiner Entstehung und dem Umfeld des Autors erläutert. Die Analyse der Bibelstelle Mt 28,16-20 beleuchtet die einzelnen Abschnitte des Textes und die darin enthaltenen Botschaften.
Das Kapitel "Bedeutung" widmet sich der Interpretation des Missionsbefehls und den verschiedenen Auslegungsmöglichkeiten, sowohl der inklusiven als auch der exklusiven Deutung. Die Wirkungsgeschichte des Missionsbefehls beleuchtet die historische Entwicklung der Missionspolitik der römisch-katholischen Kirche in Bezug auf die Juden.
Der Abschnitt "Überblick Judenmission" gibt einen Überblick über die Geschichte der Judenmission von den Anfängen bis zur Gegenwart und beleuchtet aktuelle Diskussionsfelder.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit dem Missionsbefehl Jesu im Matthäusevangelium und untersucht die Rolle des Judentums in der Missionspolitik. Die zentralen Themen sind die Auslegungsmöglichkeiten des Missionsbefehls, die historische Entwicklung der Judenmission und die aktuelle Debatte über die Beziehung zwischen Judentum und Christentum.
Häufig gestellte Fragen
Welche Bibelstelle steht im Zentrum dieser theologischen Arbeit?
Die Arbeit befasst sich intensiv mit der Auslegung und Bewertung der Bibelstelle Mt 28,16-20 im Matthäusevangelium.
Was ist die zentrale Forschungsfrage zur Judenmission?
Es wird untersucht, ob der Missionsbefehl Jesu eine uneingeschränkte Missionierung aller Völker beinhaltet oder ob Israel von diesem Auftrag ausgenommen ist.
Was versteht man unter der inklusiven und exklusiven Deutung?
Die inklusive Deutung geht von einer Missionierung aller Völker inklusive Israels aus, während die exklusive Deutung Israel vom Missionsauftrag ausnimmt.
Welche historischen Entwicklungen werden in der Arbeit beleuchtet?
Die Arbeit geht auf die Missionspolitik der römisch-katholischen Kirche, das Zweite Vatikanische Konzil und die Geschichte der Judenmission bis zur Gegenwart ein.
Wie ist der Missionsbefehl in Mt 28 strukturiert?
Die Analyse unterteilt die Stelle in eine erzählerische Einleitung, das Vollmachtswort, den Sendungsauftrag und die abschließende Verheißung.
- Quote paper
- Arne Loewenich (Author), 2011, Der Auftrag der Judenmission im Matthäusevangelium?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/170394