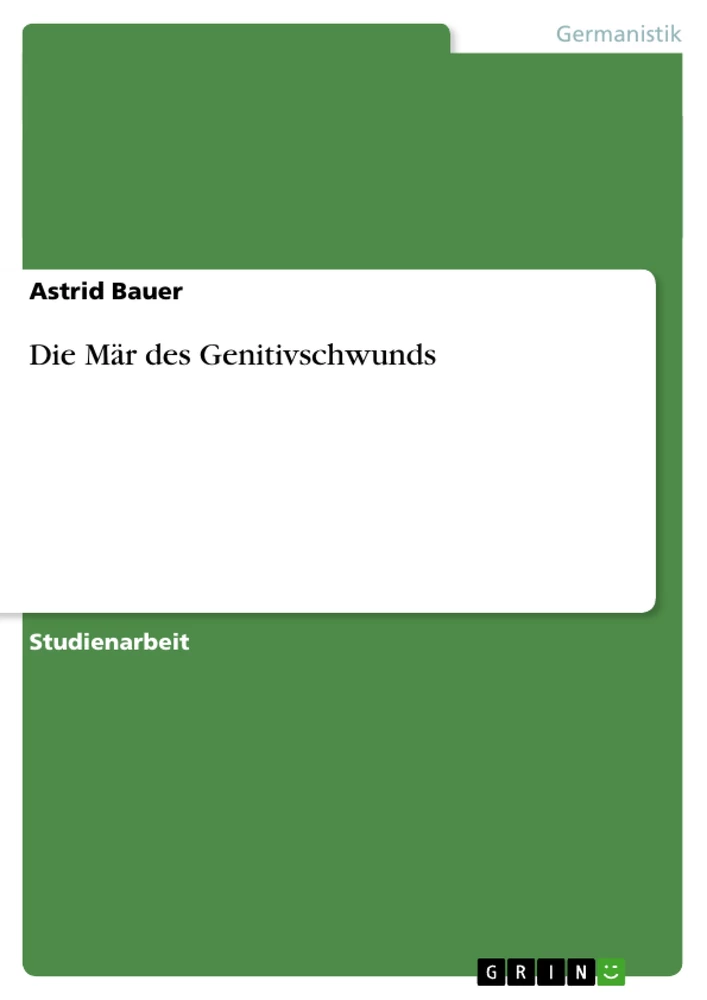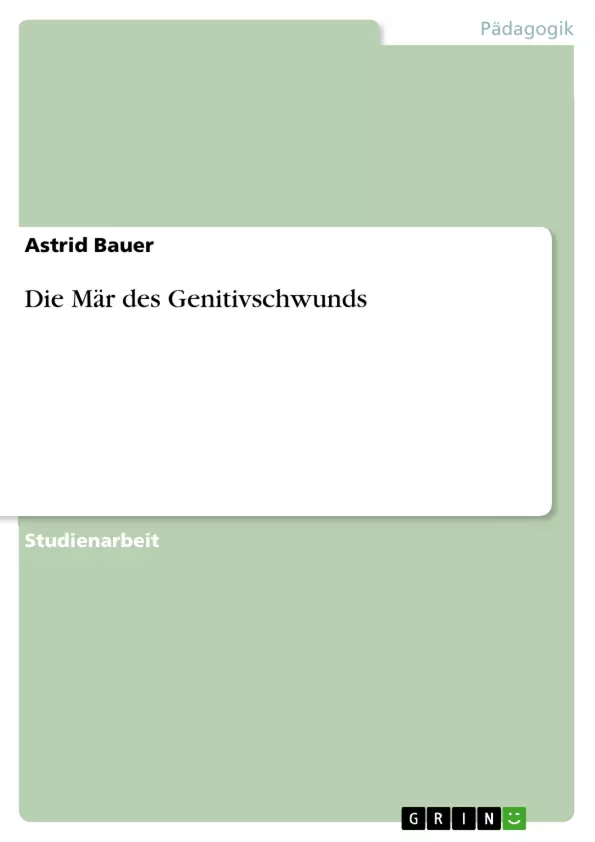„Seit weit mehr als tausend Jahren ist die deutsche Sprache dabei, ihren Sprachbau vom synthetischen zum analytischen Typ zu verändern, d.h. die Sprecher machen immer weniger Gebrauch von Flexion.“ (Schmitz 1990:135). Diese Veränderungen fallen aufmerksamen Sprachbeobachtern insbesondere bei der Verwendung des Genitivs auf.
In dieser Arbeit soll die Frage geklärt werden, ob sich im Deutschen hinsichtlich der Genitivverwendung ein sprachlicher Wandel vollzogen hat oder ob dies von vielen nur angenommen wird, letztlich aus sprachwissenschaftlicher Sicht jedoch gar nicht belegt ist. Zur Klärung dieser Frage werden zunächst konträre Positionen von Wissenschaftlern gegenübergestellt, die den Genitivschwund thematisieren. Als nächstes wird der Rückgang des Genitivs als Objektskasus näher erläutert, wobei an dieser Stelle der Theorie von Leiss besonderer Stellenwert beigemessen wird. Im Hinblick auf Veränderungen des Kasusgebrauchs in der deutschen Sprache soll anschließend der Blick auf die Verwendung des Genitivs bei unterschiedlichen Wortarten gerichtet werden. Zum Schluss dieser Arbeit wird ein Vergleich zweier Dudengrammatiken gewagt. Hier wird der Grammatikduden von 1973 dem aktuellen Exemplar von 2005 hinsichtlich der Genitivregeln gegenübergestellt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Der Genitiv im Fokus der Sprachentwicklung
- Der Rückgang des Genitivs als Objektskasus
- Die Verwendung des Genitivs bei Adjektiven und Präpositionen
- Die Verwendung des Genitivs bei Konjunktionen
- Der Verlust des Genitiv-(e)s
- Fazit
- Deutsche Grammatik früher und heute
- Abschließende Überlegungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die These des Genitivschwunds im Deutschen. Es wird geprüft, ob ein tatsächlicher sprachlicher Wandel stattgefunden hat oder ob es sich lediglich um eine Annahme handelt. Die Arbeit vergleicht unterschiedliche wissenschaftliche Positionen zu diesem Thema und analysiert den Genitivgebrauch in verschiedenen Kontexten.
- Der Rückgang des Genitivs als Objektskasus
- Der Genitivgebrauch bei Adjektiven und Präpositionen
- Der Vergleich der Genitivregeln in Dudengrammatiken verschiedener Jahrgänge
- Die Rolle des Aspekts im Zusammenhang mit dem Genitiv
- Differenzierte Betrachtung des Genitivschwunds und seine Ursachen
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik des Genitivschwunds ein und stellt die zentrale Forschungsfrage nach dem tatsächlichen Ausmaß dieses sprachlichen Wandels. Sie skizziert den methodischen Ansatz der Arbeit, der die Gegenüberstellung konträrer wissenschaftlicher Positionen und die Analyse des Genitivgebrauchs in verschiedenen grammatischen Kontexten beinhaltet. Der Fokus liegt auf der Klärung der Frage, ob der beobachtete Rückgang des Genitivs tatsächlich einen sprachlichen Wandel darstellt oder ob es sich um eine nicht ausreichend belegte Annahme handelt. Die Einleitung bereitet den Leser auf die im Folgenden dargestellten Analysen vor.
Der Genitiv im Fokus der Sprachentwicklung: Dieses Kapitel beleuchtet die kontroversen Positionen in der wissenschaftlichen Diskussion um den Genitivschwund. Es werden einerseits Behauptungen über einen Rückgang des Genitivs, insbesondere in der Umgangssprache, präsentiert, andererseits werden Gegenpositionen angeführt, die die Existenz und Verwendung des Genitivs auch in der heutigen Sprache betonen. Der Fokus liegt auf der Darstellung dieser unterschiedlichen Perspektiven, um die Komplexität der Thematik aufzuzeigen und den weiteren Verlauf der Arbeit zu motivieren. Die zentrale Frage ist, ob der Rückgang des Genitivs ein tatsächlicher Wandel ist, oder nur eine Annahme.
Abschließende Überlegungen: (Dieser Abschnitt wird aufgrund der Anweisung, keine Zusammenfassung des Schlusskapitels zu liefern, hier nicht behandelt.)
Schlüsselwörter
Genitivschwund, deutscher Sprachwandel, Objektskasus, Genitiv bei Adjektiven und Präpositionen, Dudengrammatik, Aspekt, Perfektivität, Imperfektivität, syntaktische Funktion, morphologische Kennzeichnung, wissenschaftliche Kontroverse.
Häufig gestellte Fragen zum Dokument "Genitivschwund im Deutschen"
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Die Arbeit untersucht die These des Genitivschwunds im Deutschen. Es wird geprüft, ob ein tatsächlicher sprachlicher Wandel stattgefunden hat oder ob es sich lediglich um eine Annahme handelt. Die Arbeit vergleicht unterschiedliche wissenschaftliche Positionen und analysiert den Genitivgebrauch in verschiedenen Kontexten.
Welche Themen werden im Detail behandelt?
Die Arbeit behandelt den Rückgang des Genitivs als Objektskasus, den Genitivgebrauch bei Adjektiven und Präpositionen, den Vergleich der Genitivregeln in Dudengrammatiken verschiedener Jahrgänge, die Rolle des Aspekts im Zusammenhang mit dem Genitiv und bietet eine differenzierte Betrachtung des Genitivschwunds und seiner Ursachen.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit besteht aus einer Einleitung, einem Hauptteil ("Der Genitiv im Fokus der Sprachentwicklung") und abschließenden Überlegungen. Die Einleitung führt in die Thematik ein und stellt die Forschungsfrage. Der Hauptteil beleuchtet die kontroversen Positionen in der wissenschaftlichen Diskussion zum Genitivschwund. Die abschließenden Überlegungen werden in der Vorschau nicht zusammengefasst.
Welche konkreten Forschungsfragen werden gestellt?
Die zentrale Forschungsfrage ist, ob der beobachtete Rückgang des Genitivs tatsächlich einen sprachlichen Wandel darstellt oder ob es sich um eine nicht ausreichend belegte Annahme handelt. Weiterhin werden die unterschiedlichen Perspektiven auf den Genitivgebrauch in verschiedenen grammatischen Kontexten untersucht.
Welche Methoden werden angewendet?
Die Arbeit vergleicht unterschiedliche wissenschaftliche Positionen zum Genitivschwund und analysiert den Genitivgebrauch in verschiedenen grammatischen Kontexten. Ein Vergleich von Dudengrammatiken verschiedener Jahrgänge wird ebenfalls durchgeführt.
Welche Schlüsselbegriffe sind relevant?
Schlüsselbegriffe sind: Genitivschwund, deutscher Sprachwandel, Objektskasus, Genitiv bei Adjektiven und Präpositionen, Dudengrammatik, Aspekt, Perfektivität, Imperfektivität, syntaktische Funktion, morphologische Kennzeichnung, und wissenschaftliche Kontroverse.
Gibt es eine Zusammenfassung der Kapitel?
Ja, die HTML-Datei enthält Zusammenfassungen der Einleitung und des Kapitels "Der Genitiv im Fokus der Sprachentwicklung". Die Zusammenfassung des Schlusskapitels wird jedoch nicht bereitgestellt.
Wo finde ich ein Inhaltsverzeichnis?
Das Dokument beinhaltet ein detailliertes Inhaltsverzeichnis mit den einzelnen Kapiteln und Unterkapiteln.
- Citation du texte
- Astrid Bauer (Auteur), 2007, Die Mär des Genitivschwunds, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/170402