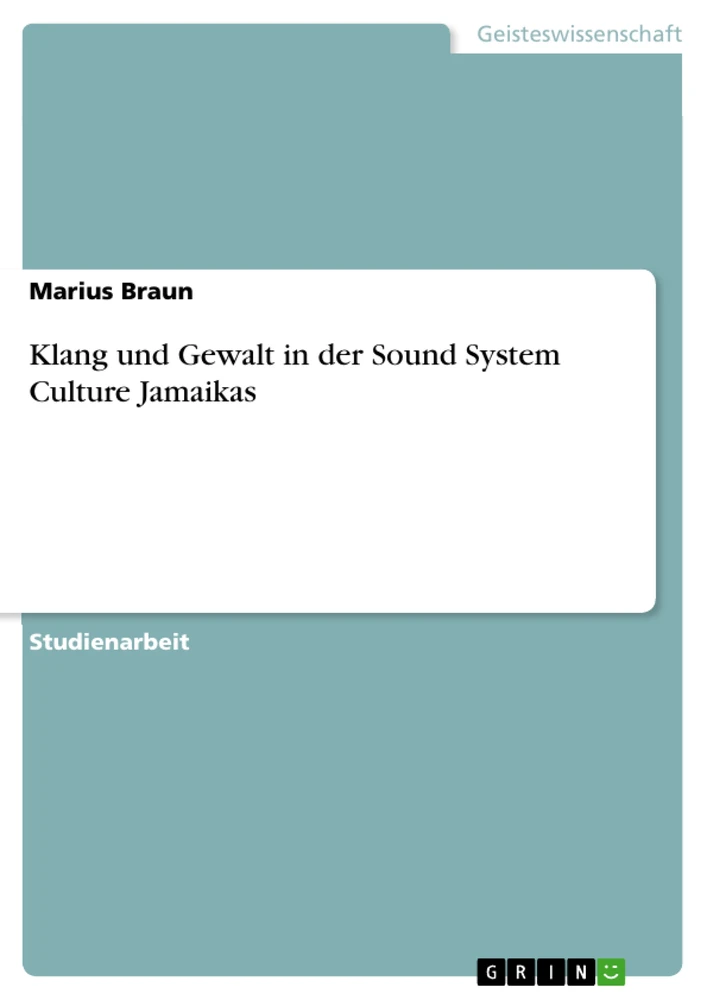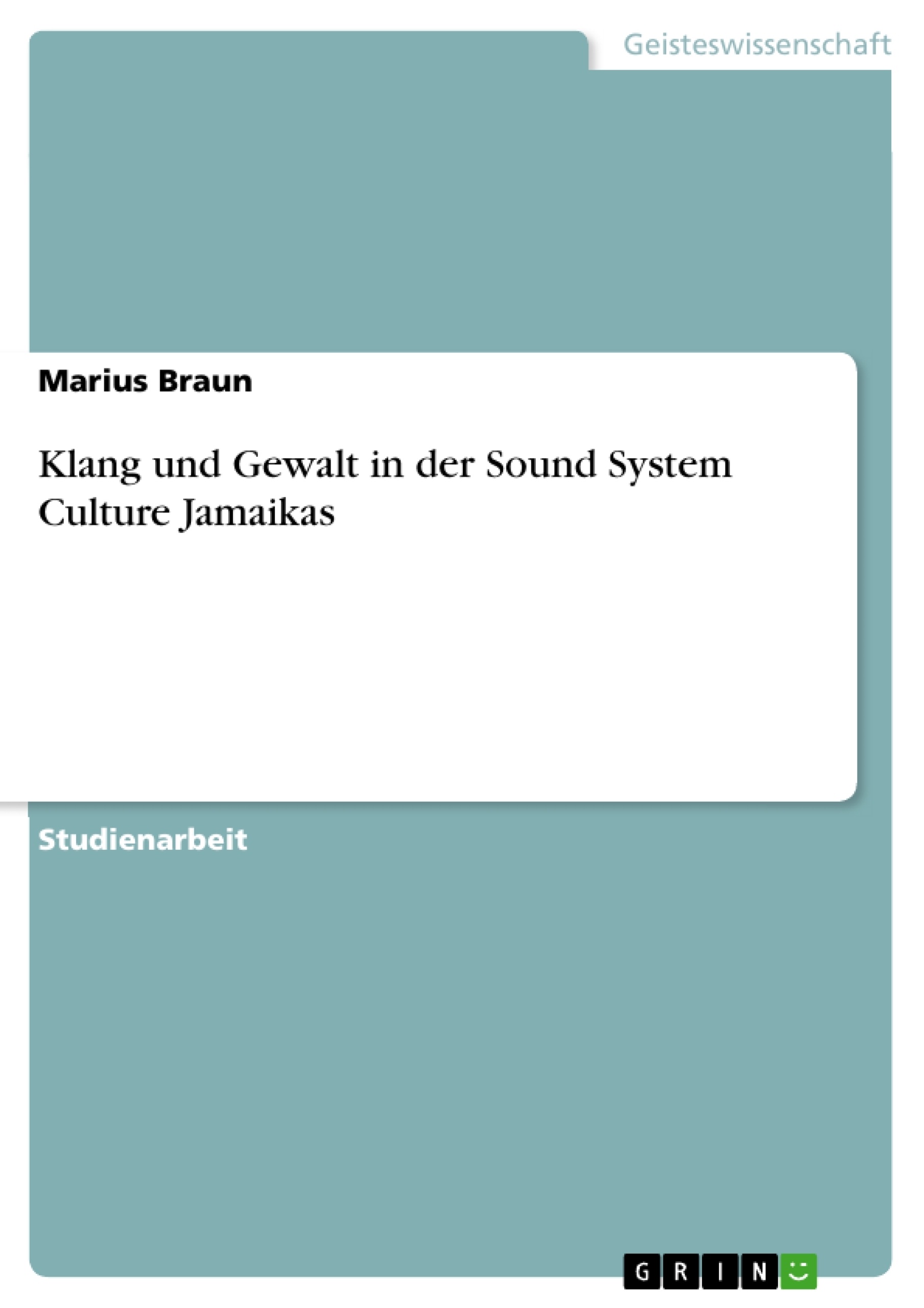Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich im Folgenden mit der Entwicklung und Ausprägung der Sound System Culture innerhalb der jamaikanischen Musikkultur. Dabei werden vor allem die Dance Hall und das Sound System mit ihren soziokulturellen Hintergründen und Einflüssen betrachtet, die eine besondere Rolle spielen. Die Verbindung von Klang und Gewalt, die sich in dieser Kultur in vielen Variationen präsentiert, ist ebenfalls ein Thema. Insbesondere wird auf die Versuche eingegangen Gewalt und Ungerechtigkeit mittels Sound zu kompensieren und aufgezeigt, ob und wenn ja wie sich die Problematik auf diesem Wege lösen lässt.
Da jede Kultur mit ihren Riten und Verhaltensweisen sehr komplex ist, kann leider nicht jeder Aspekt berücksichtigt werden. Es wird jedoch versucht.
Um Verwirrungen, die während der Recherche zu dieser Arbeit wiederholt auftauchten, vorzubeugen wird in dieser Arbeit als Ort für musikalische Aufführungen das Wort Dance Hall gebraucht, während für das entsprechende Reggae Subgenre die Version Dancehall benutzt wird. Von den zwei Begriffen Sound System und Soundsystem, deren Bedeutung die selbe ist, wird nur der erste verwendet.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Frühe Formen der Dance Hall
- Die Transformation der Dance Hall
- Das Sound System
- Sound System Clashes
- Slackness, Homophobie und Murder Music
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit analysiert die Entwicklung und Ausprägung der Sound System Culture in Jamaika, wobei der Fokus auf der Dance Hall und dem Sound System liegt. Es werden die soziokulturellen Hintergründe und Einflüsse dieser Kultur untersucht, insbesondere die Verbindung von Klang und Gewalt und die Frage, ob und wie Gewalt und Ungerechtigkeit mittels Sound kompensiert werden können.
- Die Entstehung und Entwicklung der Dance Hall als Ort musikalischer Aufführungen
- Die Rolle des Sound Systems in der Transformation der Dance Hall
- Die Verbindung von Klang und Gewalt in der Sound System Culture
- Soziokulturelle Einflüsse auf die Entwicklung der jamaikanischen Musikkultur
- Die Frage der Kompensation von Gewalt und Ungerechtigkeit mittels Sound
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Arbeit stellt die Thematik der Sound System Culture in Jamaika vor und fokussiert auf die Dance Hall und das Sound System, mit ihren soziokulturellen Hintergründen und Einflüssen.
- Frühe Formen der Dance Hall: Dieses Kapitel beschreibt die verschiedenen Dance Hall-Orte auf Jamaika, die sich je nach sozialer Schicht unterscheiden.
- Die Transformation der Dance Hall: Hier wird die Veränderung der Dance Hall durch die Einführung der Sound Systems und ihre nomadische Natur erläutert.
- Das Sound System: Das Kapitel geht auf die Geschichte und die Entwicklung der Sound Systems ein, von ihren Anfängen bis hin zu den großen, mobilen Einheiten.
- Sound System Clashes: Dieser Abschnitt beleuchtet die Bedeutung und die Auswirkungen von Sound System Clashes, die Teil der jamaikanischen Kultur sind.
- Slackness, Homophobie und Murder Music: Dieses Kapitel behandelt die Themen Slackness, Homophobie und Murder Music im Kontext der Sound System Culture.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf die Themen Dance Hall, Sound System, jamaikanische Musikkultur, soziokulturelle Einflüsse, Klang und Gewalt, Kompensation von Gewalt, Slackness, Homophobie und Murder Music.
- Quote paper
- Marius Braun (Author), 2011, Klang und Gewalt in der Sound System Culture Jamaikas, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/170413