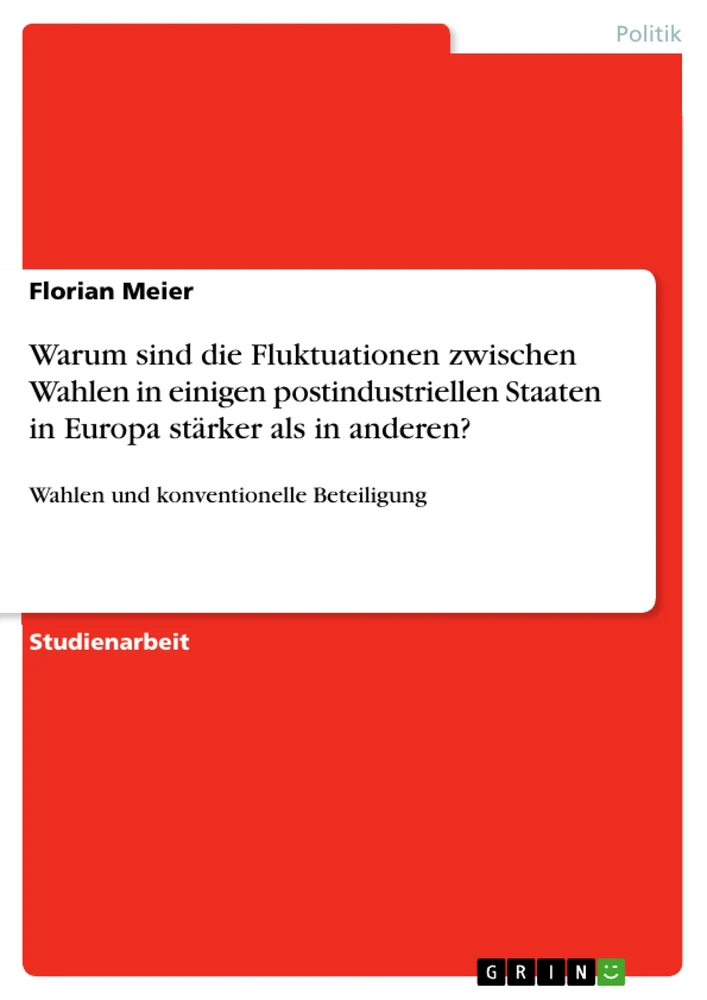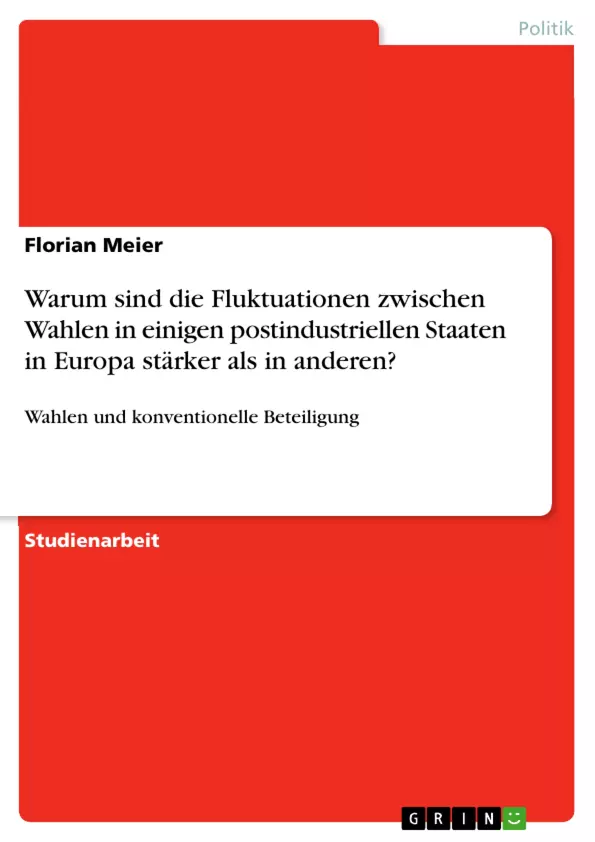„Es war wohl die erste wirkliche Überraschung der Sachsen-Anhalt-Wahl, als am Sonntagnachmittag bekannt wurde, dass die Wahlbeteiligung deutlich gestiegen war [...] 53 Prozent – noch immer mick-rig, aber doch deutlich höher als befürchtet.“ (www.zeit.de)
Dieser Absatz aus einem Online-Artikel der Zeitung „Die Zeit“ zur Landtagswahl 2011 in Sachsen-Anhalt beschreibt ein Phänomen, das medial ziemlich selten Aufmerksamkeit ge-schenkt bekommt. Die üblichen Meldungen bezüglich der Wahlbeteiligung gleichen eher schlagwortartigen Schreckensmeldungen, mit Ausdrücken wie „historisches Tief“ oder „zu-nehmende Politikverdrossenheit“, an die Verkündung einer angestiegenen Partizipation bei Wahlen kann man sich dagegen nur schwer erinnern. Dies scheint aber nicht nur den Men-schen in Deutschland so zu gehen, sondern es gibt auch eine ganze Reihe von wissenschaftli-chen Publikationen, die sich mit der Entwicklung der Wahlbeteiligung international auseinan-dersetzen und hier ebenso kontrovers diskutieren, inwieweit sie in Staaten steigt, sinkt oder sich einfach nur auf einem stabilen Niveau befindet. Ein Anstieg der Wahlbeteiligung um neun Prozent, wie es sich hier im Falle der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt ereignet zu ha-ben scheint (nach vorläufiger Stimmenauszählung), ist bei nationalen Parlamentswahlen eher selten, jedoch gibt es auch hier Schwankungen zwischen Wahlen. Wahlforscher sprechen beim internationalen Vergleich der Wahlbeteiligung in postindustriellen Dienstleistungsge-sellschaften immer wieder davon, dass die zunehmende „Politikverdrossenheit“ ein übergrei-fendes Problem in diesen Staaten sei und sprechen so auch die mögliche Gefährdung der de-mokratischen Grundordnung aufgrund der Verdrossenheit an. Kees Aarts und Bernhard We-ßels fassen das Problem in einem Beitrag aus dem Jahre 2005 zusammen:
„Mündige und emanzipierte Bürger sind sicherlich ein Plus für die Demokratie. Wenn allerdings diese Bürger den Sinn der Wahlen nicht mehr erkennen und von den Wahlurnen fernbleiben, kann das nur ein kritisches Signal sein.“ (Aarts/Weßels 2005: 596).
Steht es so kritisch um die politische Partizipation in postindustriellen Gesellschaften? [...]
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Modernisierungstheoretische Ansätze zur Erklärung der Entwicklung der Wahlbeteiligung
- Die Entwicklung der Wahlbeteiligung in postindustriellen Ländern
- Höhe der Wahlbeteiligung in postindustriellen Staaten
- Zuwächse und Rückgänge der Wahlbeteiligung einzelner Staaten
- Schlussfolgerungen aus den Ergebnissen
- Variationen des „Ceiling-Effects“
- Theoretische Überlegungen zur Ursache von Fluktuationen zwischen Wahlen
- Institutionelle Faktoren
- Auflösung sozialer „Cleavages“: Rückgang traditioneller Bindungen zwischen Bürgern und Gewerkschaften, sowie Kirchen
- Ergebnisse zur politischen Partizipation in Parteien und traditionellen Verbänden in der Gesellschaft
- Der Trend der sinkenden Mitgliederzahlen in postindustriellen europäischen Staaten
- Entfremdung der Bürger gegenüber den Parteien in Europa
- Die Entwicklung der traditionellen „Mobilizing Agencies“ als Bindeglieder zwischen Parteien und Bürgern
- Die Entwicklung der Mitgliedschaft in Gewerkschaften
- Die Entwicklung der Religiosität anhand der Kirchgangshäufigkeit
- Fluktuationen in Staaten aufgrund des Rückgangs traditioneller Bindungen
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit der Frage, warum die Fluktuationen der Wahlbeteiligung zwischen Wahlen in einigen postindustriellen Staaten stärker ausgeprägt sind als in anderen. Dabei wird die Entwicklung der konventionellen Formen politischer Partizipation, insbesondere die Wahlbeteiligung und die Mitgliedschaft in Parteien und traditionellen Verbänden, im Fokus stehen. Die Arbeit untersucht die Ursachen dieser Fluktuationen und analysiert, ob sie durch institutionelle Faktoren, den Rückgang traditioneller Bindungen oder andere Faktoren erklärt werden können.
- Entwicklung der Wahlbeteiligung in postindustriellen Staaten
- Ursachen für Fluktuationen der Wahlbeteiligung
- Rolle institutioneller Faktoren
- Einfluss des Rückgangs traditioneller Bindungen
- Entwicklung der Mitgliedschaft in Parteien und Verbänden
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt das Thema der Arbeit vor und erläutert den Forschungsgegenstand. Sie beleuchtet die Problematik der sinkenden Wahlbeteiligung in postindustriellen Gesellschaften und die Bedeutung der Fluktuationen zwischen Wahlen.
Kapitel 2 behandelt die modernisierungstheoretischen Ansätze zur Erklärung der Entwicklung der Wahlbeteiligung. Es werden die linearen und nicht-linearen Modelle vorgestellt, die die Beziehung zwischen der industriellen Entwicklung und dem Grad der politischen Partizipation beschreiben.
Kapitel 3 beleuchtet die Entwicklung der Wahlbeteiligung in postindustriellen Ländern. Es werden die Höhe der Wahlbeteiligung, die Zuwächse und Rückgänge in einzelnen Staaten sowie die Schlussfolgerungen aus diesen Ergebnissen dargestellt.
Kapitel 4 beschäftigt sich mit theoretischen Überlegungen zur Ursache von Fluktuationen zwischen Wahlen. Es werden institutionelle Faktoren und die Auflösung sozialer "Cleavages" als mögliche Ursachen für diese Fluktuationen betrachtet.
Kapitel 5 präsentiert Ergebnisse zur politischen Partizipation in Parteien und traditionellen Verbänden in der Gesellschaft. Es werden die sinkenden Mitgliederzahlen in postindustriellen europäischen Staaten, die Entfremdung der Bürger gegenüber den Parteien und die Entwicklung der traditionellen "Mobilizing Agencies" analysiert.
Kapitel 6 beleuchtet den Zusammenhang zwischen dem Rückgang traditioneller Bindungen und den Fluktuationen in Staaten.
Schlüsselwörter
Die Arbeit behandelt die Themen Wahlbeteiligung, politische Partizipation, Fluktuationen zwischen Wahlen, postindustrielle Gesellschaften, Modernisierungstheorien, institutionelle Faktoren, soziale "Cleavages", Mitgliedschaft in Parteien und Verbänden, "Mobilizing Agencies", Entfremdung und Politikverdrossenheit.
Häufig gestellte Fragen zur Wahlbeteiligung
Warum schwankt die Wahlbeteiligung in Europa so stark?
Ursachen sind unter anderem institutionelle Faktoren, die aktuelle politische Wetterlage sowie der Rückgang traditioneller sozialer Bindungen.
Was bedeutet 'Politikverdrossenheit'?
Es beschreibt eine Entfremdung der Bürger von politischen Institutionen und Parteien, was oft zu einem Fernbleiben von den Wahlurnen führt.
Welchen Einfluss haben Gewerkschaften und Kirchen auf die Wahl?
Früher fungierten sie als 'Mobilizing Agencies', die ihre Mitglieder zur Wahl motivierten. Mit sinkenden Mitgliederzahlen in diesen Verbänden schwindet auch deren mobilisierende Kraft.
Was besagt der modernisierungstheoretische Ansatz?
Er untersucht, wie gesellschaftlicher Wandel (z. B. Individualisierung) die Formen der politischen Partizipation verändert – weg von traditionellen Parteibindungen hin zu punktueller Beteiligung.
Was ist der 'Ceiling-Effect' bei Wahlen?
Er beschreibt eine Art Obergrenze der Wahlbeteiligung, die in gesättigten Demokratien nur schwer zu überschreiten ist, sofern keine außergewöhnlichen Mobilisierungsthemen vorliegen.
- Quote paper
- Florian Meier (Author), 2011, Warum sind die Fluktuationen zwischen Wahlen in einigen postindustriellen Staaten in Europa stärker als in anderen?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/170513