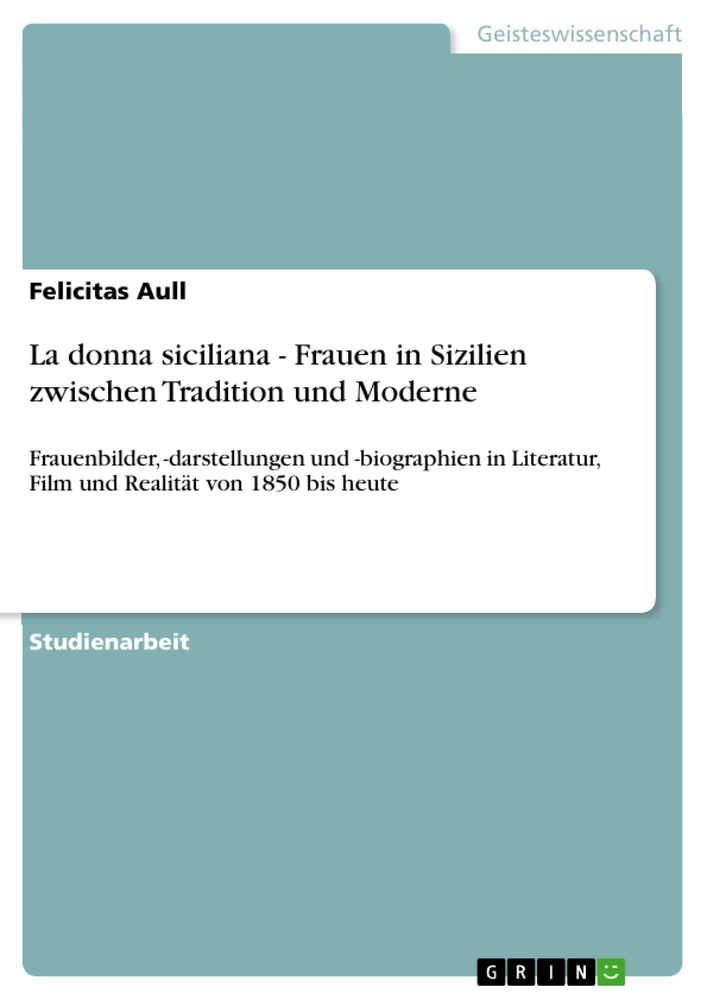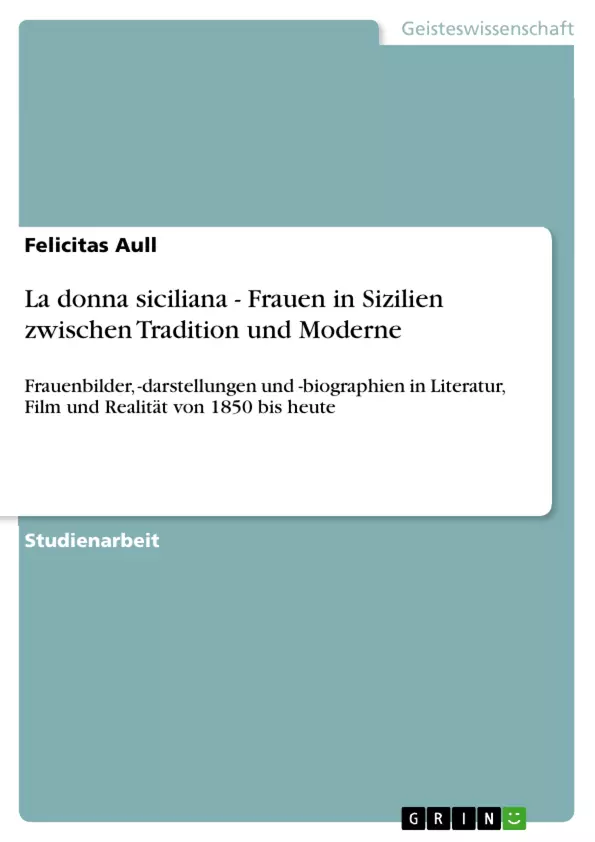Einführung
„Ich kenne keinen anderen Ort, dem es mit der gleichen
Selbstverständlichkeit gelingt, sich als Mythos auszugeben;
keinen, der mit wenigen bedeutungsvollen Sinnbildern die
ergreifende Geschichte des Menschen zusammenfasst und
sichtbar deren verschiedenste Regungen verkörpert, heilige und
profane: das Streben nach Glück, Trunkenheit und Elend der
Sinne, Begehren, Reue, Abwendung, Liebe... Wie eine Frau ist
Sizilien...“
Gesualdo Bufalino
Sizilien ist ein Landstrich, eine Insel, der Emotionen. Nicht umsonst
gebiert das leidenschaftliche Zusammentreffen von üppiger und blühender Landschaft, versengender Hitze und abenteuerlicher Historie
einen kulturellen Schmelztiegel und Menschenschlag, der zwischen den
Extremen sowohl mit aufbrausender Leidenschaft als auch stoischer
Duldung seine Sinne von Geburt an schult, in der ihn umgebenden
Intensität leben und überleben zu können.
Die Menschen spielen dabei stets die Hauptrolle im täglichen Drama der Sizilianer; ganz besonders die Frauen. Sie sind zugleich Mutter, Ehefrau, Geliebte, Jungfrau, Heilige und Tochter; sie bringen Opfer und spenden Kraft, halten die Fäden in der Familie zusammen, versorgen und nähren, lassen sich aber auch aushalten, verwöhnen, fordern und dramatisieren. Eine explosive Mischung, deren Umsetzung im realen Leben, in der Anpassung der eigenen Weiblichkeit an das geforderte tradierte Rollenkonstrukt der Gesellschaft nichts selten zum Scheitern verurteilt ist. Die Besonderheit der sizilianischen Frau hat Bufalino in einführendem Zitat in seiner Grundsätzichkeit erfasst. Es ist ihre Ausprägung eine Entsprechung zu ihrem Geburtsort, ihrem Land, zu ihrer stolzen Natur und Geschichte, zum intensiven Erleben einer Insel der erdverbundenen Bauern in einem katholischen Dorfleben geprägt von tiefreligiöser Doppelmoral. Folgende Arbeit will die vielen Besonderheiten der
sizilianischen Frau in einer patriarchal und katholisch geprägten
Umgebung beleuchten und sowohl ihre jeweilige Darstellung, im Sinne
von Rollenmustern und gesellschaftlichen Entwürfen, als auch ihre
Lebensweise, im Sinne der Umsetzung des Weiblichen am Beispiel
verschiedener Biographien, in unterschiedlichen Epochen analysieren.
[...]
Inhaltsverzeichnis
- Einführung
- Sizilien
- Insel als Utopie
- Religion und Patriarchat
- Christentum
- Volksglaube und Magie
- Die biblische Eva - Schuld und Sünde aller Frauen
- Marienverehrung
- Patriarchat vs. Matriarchat
- Dorfgemeinschaft und Tradition
- Die Ehefrau, 1850-heute
- Die Hochzeitsfalle
- Die sklavische Eva, Luigi Pirandello, 1880
- Hure oder Heilige, Dacia Maraini, 1940
- La Mafiosa
- La Mamma - die Übermutter
- Generationswechsel - moderne Sizilianerinnen wehren sich
- Rita Atria - La Pentita
- Letizia Battaglia - Chronistin und Kämpferin
- Emanzipation, 1960 - heute
- Divorzio all'siciliana von Pietro Germi, 1961
- Handlung
- Christliche Tradition als Sinn- und Lebensideal
- Ansehen und Würde im Patriarchat
- Volevo i pantaloni von Lara Cardella, 1989
- Handlung
- Dilemma der jungen Frau
- Ankunft in der Realität
- Konklusion
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Darstellung und Lebensweise der sizilianischen Frau in einem von patriarchalischen und katholischen Strukturen geprägten Umfeld. Ziel ist es, die Rolle der Frau in der sizilianischen Gesellschaft von 1850 bis heute zu beleuchten und zu analysieren, wie sich die traditionellen Rollenbilder und Lebensentwürfe im Laufe der Zeit verändert haben. Dabei werden sowohl literarische und filmische Darstellungen als auch reale Biographien von Frauen in Sizilien herangezogen.
- Das Spannungsfeld zwischen Tradition und Moderne in der sizilianischen Gesellschaft
- Die Rolle der Frau in einem patriarchalisch geprägten Umfeld
- Die Auswirkungen von Religion und Volksglaube auf die Lebenswelt der Frauen
- Die Herausforderungen und Chancen der Emanzipation für Frauen in Sizilien
- Die Darstellung von Frauen in Literatur und Film als Spiegelbild der gesellschaftlichen Entwicklung
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema ein und stellt die Relevanz der sizilianischen Frau als zentrale Figur in der Geschichte und Kultur Siziliens dar. Kapitel 1 beleuchtet die Rolle der Frau in der traditionellen sizilianischen Gesellschaft und untersucht die Einflüsse von Religion und Patriarchat auf ihr Leben. Kapitel 2 widmet sich der Darstellung der Ehefrau in der sizilianischen Literatur und analysiert die Rolle der Frau in der Familie und Gesellschaft. Kapitel 3 untersucht die Figur der "La Mafiosa" und analysiert die komplexen Rollenbilder, die mit dieser Figur verbunden sind. Kapitel 4 betrachtet die Emanzipation der sizilianischen Frau in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts und analysiert die Veränderungen in den Lebensentwürfen und Rollenbildern von Frauen. Die Konklusion fasst die zentralen Ergebnisse der Arbeit zusammen und reflektiert über die Bedeutung der Geschichte der sizilianischen Frau für die Gegenwart.
Schlüsselwörter
Sizilien, Frauen, Tradition, Moderne, Patriarchat, Religion, Christentum, Volksglaube, Ehefrau, La Mafiosa, Emanzipation, Literatur, Film, Biographien, Rollenbilder, Lebensentwürfe, Gesellschaftliche Entwicklung.
Häufig gestellte Fragen
Welche traditionellen Rollenbilder prägen die sizilianische Frau?
Die sizilianische Frau wird traditionell in Rollen wie Mutter, Ehefrau, Jungfrau oder Heilige wahrgenommen, oft in einem Spannungsfeld zwischen religiöser Moral und patriarchalischen Strukturen.
Wie beeinflusst die Religion das Leben der Frauen in Sizilien?
Das Christentum und die Marienverehrung prägen die Moralvorstellungen, während biblische Motive wie Eva oft genutzt wurden, um Schuld- und Sündenkonzepte auf Frauen zu übertragen.
Wer war Rita Atria und welche Bedeutung hat sie?
Rita Atria ist als "La Pentita" bekannt; sie gehört zur Generation moderner Sizilianerinnen, die sich gegen die Mafia auflehnten und traditionelle Schweigegelübde brachen.
Was thematisiert das Buch „Volevo i pantaloni“ von Lara Cardella?
Das Werk von 1989 beschreibt das Dilemma einer jungen Frau in Sizilien, die versucht, aus den engen traditionellen Rollenmustern auszubrechen und nach Emanzipation strebt.
Welche Rolle spielt die „Mamma“ im Kontext der Mafia?
Die „Mamma“ gilt oft als Übermutter, die innerhalb der familiären Strukturen der Mafia eine zentrale, fädenziehende und kraftspendende Rolle einnimmt.
- Quote paper
- Felicitas Aull (Author), 2010, La donna siciliana - Frauen in Sizilien zwischen Tradition und Moderne, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/170540