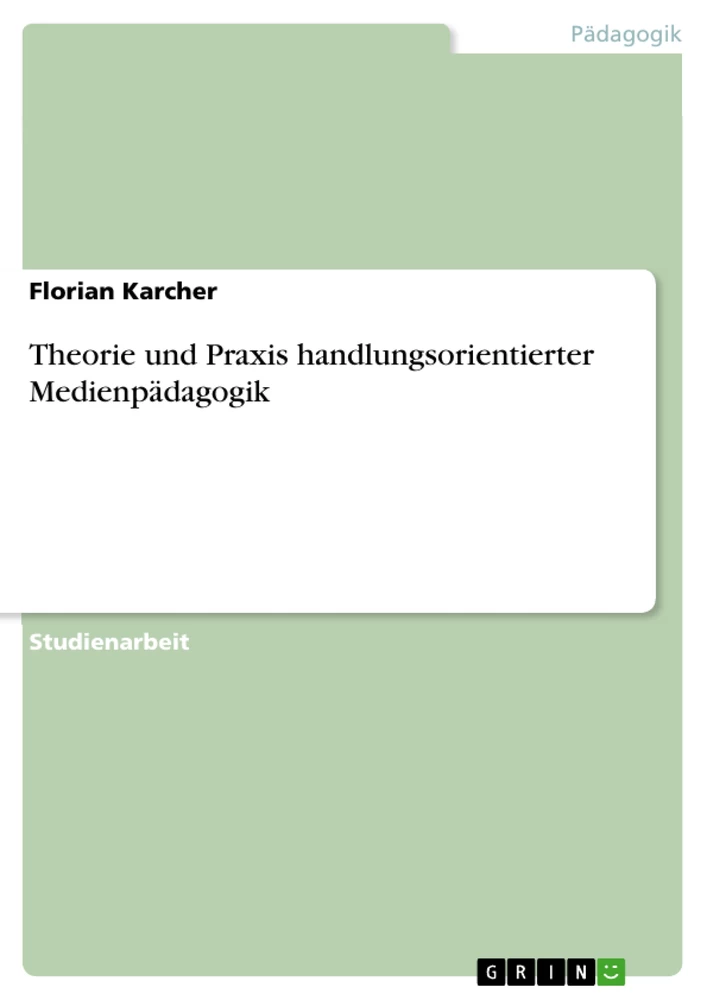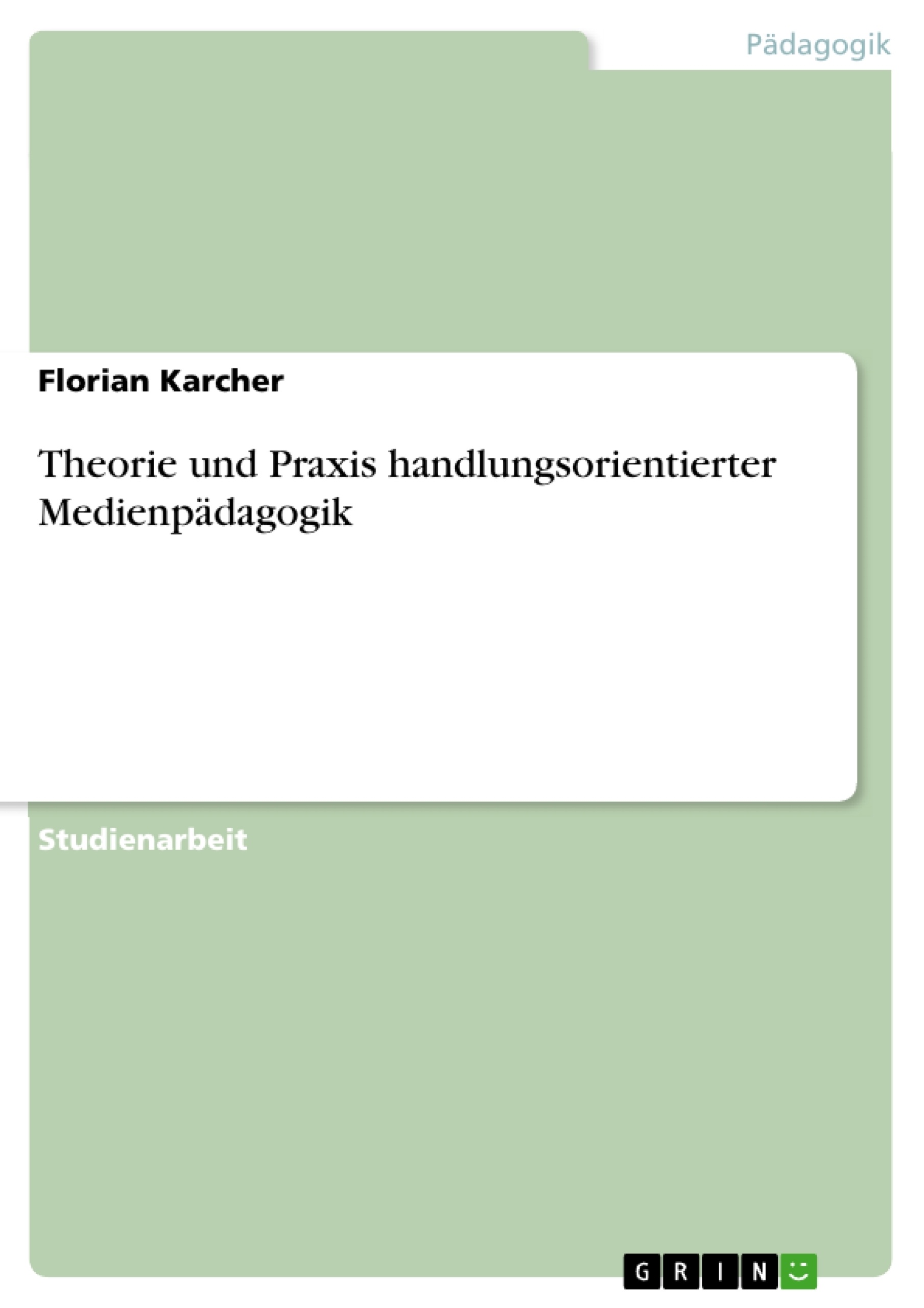Diese Arbeit will die handlungsorientierte Medienpädagogik in ihrer Theorie und Praxis grundlegend darstellen. Dazu soll sie zum einen im Gesamtkontext der Medienpädagogik verortet und dort wo es nötig ist zu anderen Strömungen der Medienpädagogik abgegrenzt werden. Zum anderen sollen die theoretischen Grundbegriffe erörtert und der Forschungsansatz der handlungsorientierten Medienpädagogik dargestellt werden. Abschließend wird der Blick auf die Umsetzung in der medienpädagogischen Praxis, u.a. anhand von Praxisbeispielen, gerichtet und ein Fazit über Möglichkeiten und Grenzen der handlungsorientierten Medienpädagogik gezogen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Handlungsorientierte Medienpädagogik im Kontext integraler Medienpädagogik
- Ausrichtung integraler Medienpädagogik
- Multidisziplinärer Ansatz integraler Medienpädagogik
- Grundlagen der Handlungsorientierten Medienpädagogik
- Historische und inhaltliche Grundlagen
- Medienkompetenz
- Aufgaben der handlungsorientierten Medienpädagogik
- Praxis der handlungsorientierten Medienpädagogik
- Lernprozesse
- Pädagogische Voraussetzungen
- Beispiel für handlungsorientierte Medienpädagogik
- Der Klassiker: Schülerzeitung
- Foto-Storys im Bereich der Religionspädagogik
- Podcast zur Medienpädagogik
- Fazit – Möglichkeiten und Grenzen handlungsorientierte Medienpädagogik
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit setzt sich zum Ziel, die handlungsorientierte Medienpädagogik in ihrer Theorie und Praxis zu beleuchten. Sie soll den Ansatz innerhalb des Gesamtkontextes der Medienpädagogik verorten und von anderen Strömungen abgrenzen. Des Weiteren werden die theoretischen Grundbegriffe erörtert und der Forschungsansatz der handlungsorientierten Medienpädagogik dargestellt. Abschließend wird die Umsetzung in der medienpädagogischen Praxis anhand von Praxisbeispielen betrachtet und ein Fazit über Möglichkeiten und Grenzen der handlungsorientierten Medienpädagogik gezogen.
- Verortung der handlungsorientierten Medienpädagogik im Kontext integraler Medienpädagogik
- Theoretische Grundlagen der handlungsorientierten Medienpädagogik
- Medienkompetenz als zentrales Ziel der handlungsorientierten Medienpädagogik
- Praxisbeispiele für handlungsorientierte Medienpädagogik
- Möglichkeiten und Grenzen der handlungsorientierten Medienpädagogik
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Zielsetzung und den Aufbau der Hausarbeit vor. Kapitel 2 betrachtet die handlungsorientierte Medienpädagogik im Kontext der integralen Medienpädagogik. Es werden die Ausrichtung und der multidisziplinäre Ansatz der integralen Medienpädagogik erläutert. Kapitel 3 beleuchtet die historischen und inhaltlichen Grundlagen der handlungsorientierten Medienpädagogik, darunter die kritische Medientheorie und die Reformpädagogik. Des Weiteren wird das Konzept der Medienkompetenz als zentrales Ziel der handlungsorientierten Medienpädagogik vorgestellt. Kapitel 4 widmet sich der Praxis der handlungsorientierten Medienpädagogik, einschließlich der Lernprozesse, pädagogischen Voraussetzungen und Praxisbeispielen. Das Fazit in Kapitel 5 fasst die Möglichkeiten und Grenzen der handlungsorientierten Medienpädagogik zusammen.
Schlüsselwörter
Handlungsorientierte Medienpädagogik, integrale Medienpädagogik, Medienkompetenz, kritische Medientheorie, Reformpädagogik, Learning-by-doing, kommunikative Kompetenz, Medienaneignung, Praxisbeispiele, Möglichkeiten und Grenzen.
Häufig gestellte Fragen
Was ist handlungsorientierte Medienpädagogik?
Ein pädagogischer Ansatz, bei dem Lernende durch die aktive Produktion eigener Medienbeiträge (z. B. Videos, Podcasts) Medienkompetenz erwerben.
Was ist das Hauptziel dieses Ansatzes?
Das zentrale Ziel ist die Förderung der Medienkompetenz, also die Fähigkeit, Medien kritisch, selbstbestimmt und verantwortungsvoll zu nutzen und zu gestalten.
Nennen Sie Beispiele für die medienpädagogische Praxis.
Klassische Beispiele sind die Erstellung einer Schülerzeitung, Foto-Storys im Religionsunterricht oder die Produktion eines eigenen Podcasts.
Auf welchen theoretischen Grundlagen basiert dieser Ansatz?
Er stützt sich auf die kritische Medientheorie, die Reformpädagogik (Learning-by-doing) und Konzepte der kommunikativen Kompetenz.
Was sind die Grenzen der handlungsorientierten Medienpädagogik?
Grenzen liegen oft in der technischen Ausstattung der Schulen, dem zeitlichen Aufwand sowie der Notwendigkeit spezifischer Qualifikationen der Lehrkräfte.
Wie unterscheidet sie sich von rein bewahrender Medienpädagogik?
Während die bewahrende Pädagogik vor Gefahren schützen will, setzt die handlungsorientierte auf Befähigung und aktive Teilhabe an der Mediengesellschaft.
- Quote paper
- Florian Karcher (Author), 2010, Theorie und Praxis handlungsorientierter Medienpädagogik, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/170550