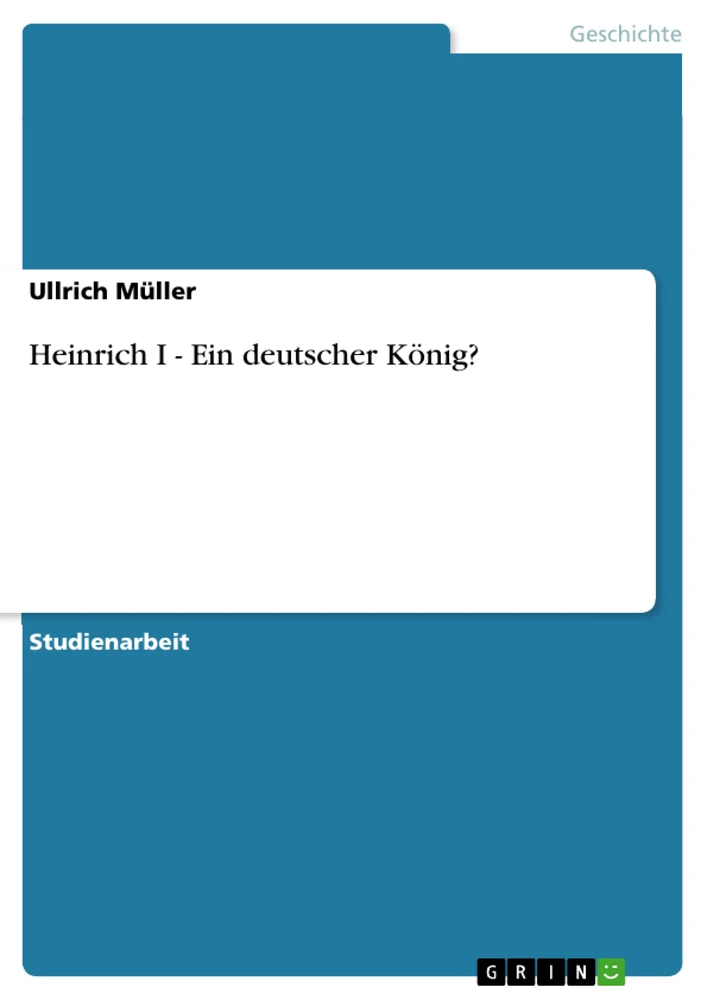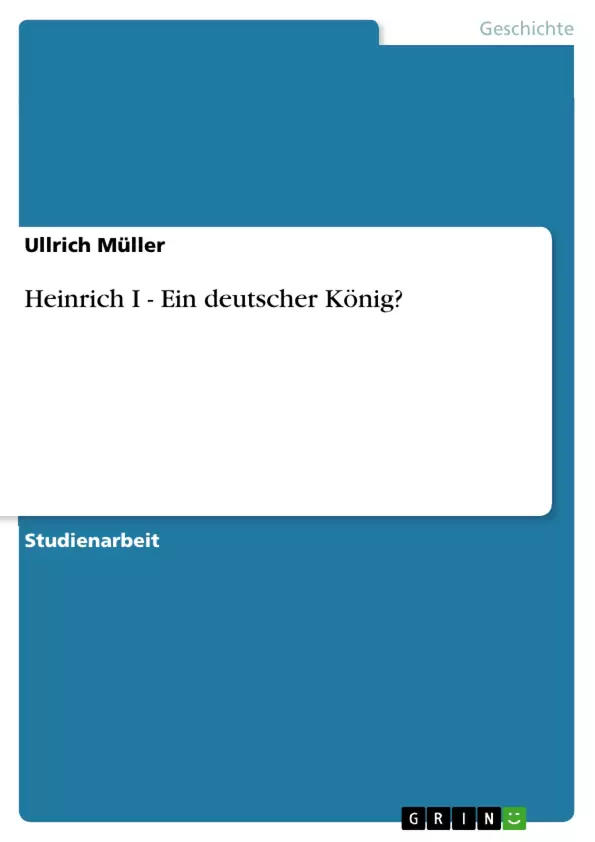„Hört! Grafen, Edle, Freie von Brabant!
Heinrich, der Deutschen König, kam zur Statt,
mit euch zu dingen nach des Reiches Recht.
Gebt ihr nun Fried' und Folge dem Gebot?“
Mit diesen Worten des Heerrufers beginnt Richard Wagners Oper „Lohengrin“, die im Jahr 1850 in Weimar uraufgeführt wurde. Wagner, der die Libretti seiner Opern selbst verfaßte, kann in seinem Schaffen getrost als (Spät-)Romantiker bezeichnet werden. Seine Werke sind oft in ein historisches Umfeld eingebettet, das sich geschichtswissenschaftlich gesehen am Historismus des 19. Jahrhunderts orientiert. Schließlich verfolgte Wagner durch Teile seines Schaffens durchaus auch seine politischen Vorstellungen und Wünsche, besonders deutlich wird dies anhand der „Meistersinger von Nürnberg“. In gewisser Weise verbanden diese Wünsche Wagner mit den Historikern seiner Zeit, die, mit dem Historismus, das zu be- und ergründen versuchten, was Wagner in seinen Opern künstlerisch zum Ausdruck brachte: Eine gemeinsame deutsche Identität, die die Widersprüche deutscher Kleinstaaterei überwinden sollte. Aus heutiger Sicht haben Wagners Werke somit nicht nur eine politische sondern auch eine historische Relevanz und es stellt sich die Frage, ob der „Deutschen König“ Heinrich wirklich ein ebensolcher gewesen ist, oder ob das Lohengrin-Libretto hier nur eine Projektion der Vorstellungen und Wünsche des 19. Jahrhunderts zu Ton bringt.
Heinrich der Vogler, Heinrich der Burgenbauer und Städtegründer - aber auch Heinrich, der Deutschen König? Dies soll im wesentlichen die Kernfrage dieser Arbeit sein. Dabei wird nicht versucht eine Kritik des Historismus vorzunehmen, sondern es werden lediglich anhand einiger Fragestellungen ausgewählte Quellen und Literatur auf die Stichhaltigkeit der These hin überprüft, daß es sich bei Heinrich I. um einen deutschen König handelte. Dabei soll unter Betrachtung der Bedingungen der Ausgangslage des späteren Regierungsgebietes Heinrichs auf das Selbstverständnis des Herrschers, das seines Volkes und auch jenes des mehr oder weniger zeitgenössischen Chronisten eingegangen werden.
Zugleich wird jedoch auch der Versuch unternommen, Heinrichs Politik auf Hinweise bezüglich der Fragestellung zu untersuchen. Als wichtig wird hier vor allem die Außenpolitik erachtet werden, die bekanntermaßen durch stetige äußere Gefahren gekennzeichnet war.
Ein abschließendes Fazit wird die Ergebnisse zusammenfassen und die finale Position des Autors dieser Arbeit darlegen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Heinrich I. - Ein deutscher König?
- 2.1. Ausgangslage
- 2.2. Selbstverständnis des Königs Heinrich
- 2.3. Das Volk Heinrichs I.
- 2.4 Exemplarische Betrachtung der Politik Heinrichs unter Berücksichtigung der Fragestellung.
- 2.5 Heinrich I. aus Sicht des Chronisten (am Beispiel Widukinds von Corvey)
- 3. Schlußfolgerungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Frage, ob Heinrich I. als „deutscher König“ bezeichnet werden kann. Anhand ausgewählter Quellen und Literatur wird die These geprüft, ob Heinrich I. tatsächlich ein deutscher König war. Die Analyse betrachtet die Ausgangslage, das Selbstverständnis Heinrichs und seines Volkes, sowie die Politik Heinrichs I., insbesondere seine Außenpolitik. Der Blickwinkel eines zeitgenössischen Chronisten wird ebenfalls einbezogen.
- Legitimation des Königtums Heinrichs I.
- Heinrichs Selbstverständnis als Herrscher
- Das Verhältnis Heinrichs I. zu seinem Volk
- Die Rolle der Außenpolitik in der Regierungszeit Heinrichs I.
- Die Darstellung Heinrichs I. durch zeitgenössische Chronisten
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung beginnt mit einem Zitat aus Wagners Oper "Lohengrin", das die Figur Heinrichs als "Deutschen König" darstellt. Die Arbeit stellt die Frage nach der historischen Genauigkeit dieser Bezeichnung in den Mittelpunkt und kündigt die methodische Vorgehensweise an: Eine Überprüfung der Quellen und Literatur zur Legitimität der Behauptung, Heinrich I. sei ein deutscher König gewesen. Die Analyse wird die Ausgangslage, das Selbstverständnis des Königs und seines Volkes, sowie dessen Politik betrachten, um die Kernfrage zu beantworten.
2. Heinrich I. - Ein deutscher König?: Dieses Kapitel untersucht die Frage nach Heinrichs I. Legitimität als König. Es vergleicht seine Herrschaft mit der seines Vorgängers, Konrad I., der seine Legitimation aus seiner fränkischen Abstammung und seiner Herzogswürde bezog. Im Gegensatz dazu basierte Heinrichs Legitimität vornehmlich auf seiner Macht als Herzog der Sachsen. Das Kapitel analysiert die Krise des Königtums unter Konrad I. und wie Heinrich diese Krise überwand, ohne auf die karolingischen Traditionen zurückzugreifen. Die Frage, ob Heinrichs Reich bereits als deutsches Reich bezeichnet werden kann, wird aufgeworfen.
2.1. Ausgangslage: Dieser Abschnitt beschreibt die politische Situation zu Beginn des 10. Jahrhunderts im ostfränkischen Reich, charakterisiert durch die zunehmende Macht der Stammesherzöge. Es wird der Unterschied in der Legitimationsbasis zwischen Konrad I. (fränkische Wurzeln) und Heinrich I. (sächsische Machtbasis) herausgestellt. Die Schwäche Konrads und seine Entscheidung, Heinrich zum Nachfolger zu bestimmen, wird im Kontext der damaligen politischen Gegebenheiten analysiert.
2.2. Selbstverständnis des Königs Heinrich: Dieser Abschnitt befasst sich mit dem Selbstverständnis Heinrichs als König. Im Gegensatz zu den Karolingern verzichtete er auf die Königssalbung, was auf eine Veränderung im herrschaftlichen Selbstverständnis hinweist. Dieser Verzicht auf die traditionelle Legitimation wird im Kontext seiner sächsischen Herkunft und seiner Machtbasis interpretiert. Der Abschnitt analysiert, wie Heinrich eine neue Legitimationsbasis für seine Herrschaft schuf, die sich von den karolingischen Traditionen abhob.
Schlüsselwörter
Heinrich I., deutsches Königtum, Legitimation, Sachsen, Franken, Karolinger, Ostfränkisches Reich, Außenpolitik, Chronisten, Widukind von Corvey, Selbstverständnis, Ethnogenese.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Heinrich I. - Ein deutscher König?
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Frage, ob Heinrich I. als „deutscher König“ bezeichnet werden kann. Sie analysiert seine Legitimation, sein Selbstverständnis, seine Politik und die Darstellung durch zeitgenössische Chronisten, um diese Frage zu beantworten.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Legitimation des Königtums Heinrichs I., sein Selbstverständnis als Herrscher, sein Verhältnis zu seinem Volk, die Rolle der Außenpolitik in seiner Regierungszeit und die Darstellung Heinrichs I. durch zeitgenössische Chronisten, insbesondere Widukind von Corvey.
Wie ist die Arbeit aufgebaut?
Die Arbeit besteht aus einer Einleitung, einem Hauptteil mit einer detaillierten Analyse von Heinrichs I. Herrschaft und Schlussfolgerungen. Der Hauptteil unterteilt sich in Abschnitte zur Ausgangslage, zum Selbstverständnis Heinrichs I., zum Verhältnis zu seinem Volk, zur Außenpolitik und zur Darstellung durch Chronisten.
Welche Quellen werden verwendet?
Die Arbeit basiert auf ausgewählten Quellen und Literatur zur Regierungszeit Heinrichs I. Genannt wird explizit Widukind von Corvey als zeitgenössischer Chronist. Weitere Quellen und Literatur werden im Text selbst zitiert und referenziert (diese sind in der hier vorliegenden HTML-Version nicht vollständig enthalten).
Wie wird die Frage nach der "deutschen Königswürde" Heinrichs I. untersucht?
Die Arbeit vergleicht Heinrichs Herrschaft mit der seines Vorgängers Konrad I., um Unterschiede in der Legitimationsbasis aufzuzeigen. Sie analysiert, wie Heinrich I. seine Macht trotz des Verzichts auf die traditionelle Königssalbung festigte und eine neue Legitimationsbasis schuf. Die Frage, ob sein Reich bereits als deutsches Reich bezeichnet werden kann, wird kritisch diskutiert.
Welche Schlussfolgerungen werden gezogen?
(Die konkreten Schlussfolgerungen sind in diesem Auszug nicht enthalten. Die Arbeit selbst enthält einen abschließenden Kapitel "Schlussfolgerungen", das die Ergebnisse der Analyse zusammenfasst und die eingangs gestellte Frage beantwortet.)
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt?
Schlüsselwörter sind: Heinrich I., deutsches Königtum, Legitimation, Sachsen, Franken, Karolinger, Ostfränkisches Reich, Außenpolitik, Chronisten, Widukind von Corvey, Selbstverständnis, Ethnogenese.
- Quote paper
- Ullrich Müller (Author), 2004, Heinrich I - Ein deutscher König?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/170615