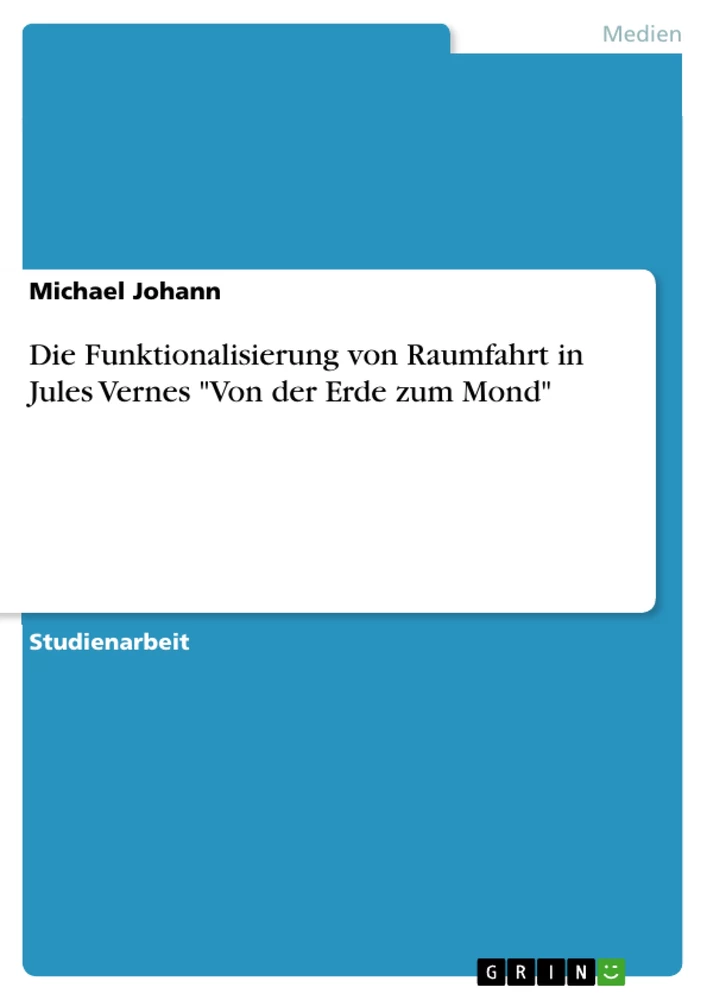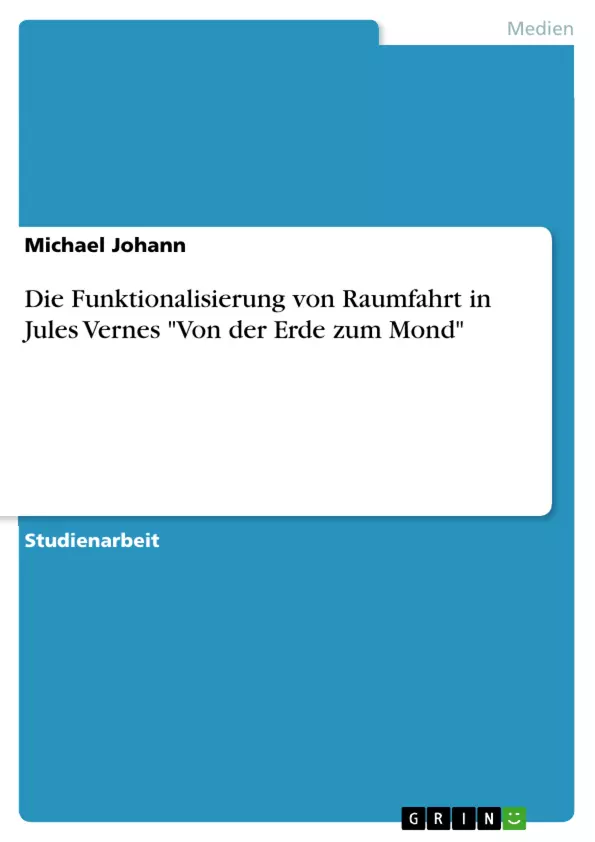Das Ende des 19. Jahrhunderts gilt als der Höhepunkt der industriellen Revolution. Jules Vernes 62 Werke umfassende ‚voyages extraordinaires‘ liefern einen eindrucksvollen Beleg, wie das damals gesellschaftsdurchdringende Innovations-bestreben geradezu als Quelle für literarische Ideen der damaligen Schriftsteller diente. Dabei stellt Vernes beinahe prophetisch anmutender Roman Von der Erde zum Mond ein zentrales Werk dar, wenn es um die Frage nach dem „Warum“ der Verwendung des Paradigmas Raumfahrt geht. Volker Dehs, einer der führenden deutschen Jule-Verne-Forscher, liefert hierzu folgende Erklärung:
„Die symbolische Bedeutung der Reise verlagert sich bei Verne mit der Schilderung der realen wissenschaftlichen Voraussetzungen von der politischen Allegorie scheinbar auf rein materielle Bewältigung des Vorhabens, stellt jedoch immer zugleich die Frage nach dem Verhältnis von Mittel und Zweck beim Vorstoß ins Unbekannte, thematisiert die ideologischen Implikationen des Anspruchs auf Beherrschung von Raum und Zeit.“
Ob und inwieweit sich diese These aufrecht erhalten lässt, wird die dieser Arbeit zu Grunde liegende Textanalyse zeigen. In das Zentrum der Untersuchung rücken dabei die Funktionalisierung der Raumfahrt und die bedeutungstragenden Ausprägungen dieser im Roman Von der Erde zum Mond.
Inhaltsverzeichnis
- Jules Verne und seine,Voyages Extraordinaires'.
- Die Funktionalisierung von Raumfahrt in Von der Erde zum Mond.....
- Ansatz zur Metakommunikation......
- Amerika: Leichtigkeit und Problemlosigkeit der Technik.....
- Ökonomische und soziale Dimension.
- Moralische Dimension..........\n
- Zwischenfazit: Raumfahrt als Problemlöser.
- Raumfahrt als narratives Mittel zur Ideologiebeschreibung.....
- Militarismus und Expansionsbestreben..\n
- Der Amerikaner Impey Barbicane.
- Der Franzose Michel Ardan..\n
- Oppositionsbildung und Problemlösung..\n
- Nivellierung...\n
- Fazit: Das Modell von Welt in Von der Erde zum Mond
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit analysiert die Funktion der Raumfahrt im Roman Von der Erde zum Mond von Jules Verne und beleuchtet, wie Verne diese für die kritische Auseinandersetzung mit gesellschaftlichen und politischen Themen nutzt.
- Die Rolle der Raumfahrt als Metakommunikation
- Die Darstellung Amerikas als technisches Genie und Problemlöser
- Die kritische Auseinandersetzung mit Militarismus und Expansionsbestreben
- Die Darstellung unterschiedlicher Charaktere und ihrer Positionen zur Raumfahrt
- Die Konstruktion eines Modells von Welt im Roman
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1: Einleitung und Einführung in Jules Vernes,Voyages Extraordinaires'. Der Text zeigt die Aktualität des Themas Raumfahrt im Kontext der industriellen Revolution auf und stellt Jules Vernes Roman Von der Erde zum Mond als ein zentrales Werk dar.
- Kapitel 2: Die Funktionalisierung der Raumfahrt in Von der Erde zum Mond: Die Arbeit beleuchtet die unterschiedlichen Textpositionen zu Raumfahrt im Roman und zeigt auf, wie sie als narratives Mittel für die kritische Auseinandersetzung mit verschiedenen Themen fungiert.
- Kapitel 2.1: Ansatz zur Metakommunikation: Dieses Kapitel untersucht die Verwendung der Raumfahrt als Vehikel zur Kommunikation über technische Fortschritte, die Zukunft der Menschheit und andere gesellschaftliche Themen.
- Kapitel 2.2: Amerika: Leichtigkeit und Problemlosigkeit der Technik: Hierbei analysiert der Text die Darstellung Amerikas als technisches Genie, das Probleme und Herausforderungen scheinbar mühelos löst.
- Kapitel 2.3: Raumfahrt als narratives Mittel zur Ideologiebeschreibung: In diesem Abschnitt wird die Funktionalisierung der Raumfahrt im Roman als Mittel zur Darstellung von Militarismus und Expansionsbestreben beleuchtet.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf die Analyse der Raumfahrt als narrative Strategie in Jules Vernes Roman Von der Erde zum Mond. Zu den zentralen Themen gehören die Darstellung von Amerika, die Kritik an Militarismus und Expansionsbestreben, die Bedeutung der Metakommunikation und die Konstruktion von Raumfahrt als Mittel zur Ideologiebeschreibung.
Häufig gestellte Fragen
Welche Rolle spielt die Raumfahrt in Jules Vernes Werk?
In „Von der Erde zum Mond“ dient die Raumfahrt als narratives Mittel zur Ideologiebeschreibung und thematisiert den Anspruch auf Beherrschung von Raum und Zeit.
Warum wird Amerika im Roman als technisches Genie dargestellt?
Verne nutzt die Darstellung Amerikas, um die Leichtigkeit und Problemlosigkeit der Technik sowie deren ökonomische und moralische Dimensionen zu beleuchten.
Was kritisiert Verne durch das Thema Raumfahrt?
Der Roman setzt sich kritisch mit Militarismus, Expansionsbestreben und dem Verhältnis von Mittel und Zweck beim Vorstoß ins Unbekannte auseinander.
Wer sind die zentralen Figuren des Romans?
Zentrale Charaktere sind der Amerikaner Impey Barbicane und der Franzose Michel Ardan, die unterschiedliche Ideologien und Herangehensweisen verkörpern.
Was bedeutet „Raumfahrt als Metakommunikation“?
Es beschreibt die Nutzung der Raumfahrt als Vehikel, um über technischen Fortschritt, gesellschaftliche Herausforderungen und die Zukunft der Menschheit zu kommunizieren.
- Arbeit zitieren
- B.A. Michael Johann (Autor:in), 2009, Die Funktionalisierung von Raumfahrt in Jules Vernes "Von der Erde zum Mond", München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/170796